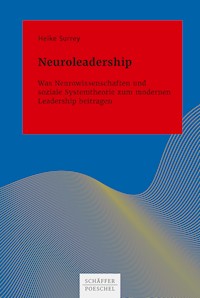
43,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schäffer Poeschel
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Systemisches Management
- Sprache: Deutsch
Wie können notwendige Systemwechsel "gemanaged" werden, wenn die etablierten Führungsansätze an heutigen Entwicklungen vorbeigehen? Das Buch beschäftigt sich mit dem Ansatz des Neuroleadership, der einen Beitrag leisten kann, Führungskonzepte weiterzuentwickeln. Dieser neue Ansatz erweitert die bisherigen Konzepte durch die Verknüpfung von Neurosciences, Leadershiptheorie und Systemtheorie. Leadership wird dabei vor allem als beratende und unterstützende Funktion gesehen, für die Kompetenzen im hybriden systemischen Neurocoaching benötigt werden. Ein spezieller Fokus liegt auf den Einflüssen durch Digitalisierung, Intuitive, Künstliche und Web-Intelligenz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
[7]Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum UrheberrechtCopyright PageVorwortVerzeichnis der Abkürzungen und Akronyme1 Einführung1.1 Relevanz und Problemstellung der Forschung1.1.1 Status quo in der Theorie sozialer Systeme1.1.2 Status quo in der Leadership-Forschung1.1.3 Zwischenfazit1.2 Forschungsparadigmen1.3 Ziel und Aufbau2 Forschungsdimensionen: Leadership und Neurosciences 2.1 Leadership als Forschungsinteresse2.1.1 Neuroleadership 2.1.2 Systemisches Leadership2.2 Neurosciences als Gegenstand der Leadership-Forschung2.2.1 Neurosciences in den Wirtschaftswissenschaften2.2.2 Neuro- und Socialsciences 2.2.3 Neurosciences und (Natural-)Sciences3 Systemtheorie als Erklärungsvariable3.1 Paradigmenwechsel I (Luhmann)3.1.1 Technische Systeme3.1.2 Komplexe Systeme3.1.3 Autopoietische Systeme3.1.4 Soziale Systeme3.1.5 Bezugsrahmen3.2 Paradigmenwechsel II: Intelligenz (Fokus im Buch)3.2.1 Psychische Systeme3.2.2 Intuitive Systeme3.2.3 Künstliche Systeme3.2.4 Web-Systeme4 Leadership im Spiegel der Neurosciences und der Systemtheorie4.1 Ansätze des Neuroleadership4.1.1 Vier-Quadranten-Modell des Gehirns (Herrmann)4.1.2 SCARF Model (Rock)4.1.3 Gehirngerechte Führung (Hüther)4.1.4 AKTIV-Modell und PERFEKT-Schema (Peters und Ghadiri) 4.1.5 Sieben Grundregeln (Elger)4.1.6 Dodekaeder-Modell (Reinhardt)4.1.7 Neuroprojektmanagement (Prieß und Spörer)4.1.8 Fazit4.2 Ansätze des Systemischen Leadership4.2.1 Integriertes Management-Modell (Bleicher)4.2.2 Malik Management Systeme®4.2.3 Sozialfokus in der Führung (Luhmann)4.2.4 Postheroische Führung (Baecker)4.2.5 Leadership in Social Enterprises (Surrey)4.2.6 Dysfunktionalitäten5 Coaching und Consulting im Licht der Neurosciences und der Systemtheorie5.1 Formen des Neurocoaching und der Neuroberatung 5.1.1 Neurocoaching (Rock und Page)5.1.2 Neuroimagination®Coaching (Kraemer)5.1.3 mNeurofeedback (Birbaumer)5.1.4 mBiofeedback (Lubar)5.1.5 Neurocoaching und -beratung (Roth und Ryba) 5.2 Formen der Systemischen Beratung und des Systemischen Coaching (Systemtheorie)5.2.1 Unternehmensberatung (Luhmann)5.2.2 Distinction Map (Hans)5.2.3 Systemic Design Thinking (Korflesch)5.2.4 Systems Archetypes (Senge)5.3 Formen des Systemischen Neurocoaching und der -beratung5.3.1 Personzentrierte Systemtheorie (Kriz)5.3.2 Lösungsorientierte Konfliktberatung und Mediation (Ronzani)5.4 Kritische Würdigungen5.4.1 Wirksamkeitsforschungen 5.4.2 Consulting- und Coachingsciences 6 Neuro-based View of Leadership6.1 Neuroleadership6.1.1 Neurokompetenzmanagement (Competenced-based View)6.1.2 Neuroleadership-Cube6.2 Neuro-based View of Leadership in Intuitive, Artificial or Web Systems6.2.1 Neuro-based View6.2.2 Neuro-based View of Leadership6.2.3 Neuro-based View Coaching and Consulting7 Schlussfolgerung, Black Box und AusblickLiteraturAuswahl weiterer aktueller Literatur zu weiterführenden Neuro-PerspektivenGlossarLesepfad SachwortregisterÜber die AutorinHinweis zum Urheberrecht:
Alle Inhalte dieses eBooks sind urheberrechtlich geschützt.
Bitte respektieren Sie die Rechte der Autorinnen und Autoren, indem sie keine ungenehmigten Kopien in Umlauf bringen.
Dafür vielen Dank!
Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft - Steuern - Recht GmbH
[4]Reihe Systemisches Management
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Print:
ISBN 978-3-7910-5642-5
Bestell-Nr. 10841-0001
ePub:
ISBN 978-3-7910-5646-3
Bestell-Nr. 10841-0100
ePDF:
ISBN 978-3-7910-5647-0
Bestell-Nr. 10841-0150
Heike Surrey
Neuroleadership
1. Auflage, Juli 2022
© 2022 Schäffer-Poeschel Verlag für Wirtschaft · Steuern · Recht GmbH
www.schaeffer-poeschel.de
Produktmanagement: Dr. Frank Baumgärtner
Lektorat: Dr. Angelika Schulz, D.A.S.-Büro, Zülpich
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere die der Vervielfältigung, des auszugsweisen Nachdrucks, der Übersetzung und der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, vorbehalten. Alle Angaben/Daten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit.
Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart
Ein Unternehmen der Haufe Group SE
Sofern diese Publikation ein ergänzendes Online-Angebot beinhaltet, stehen die Inhalte für 12 Monate nach Einstellen bzw. Abverkauf des Buches, mindestens aber für zwei Jahre nach Erscheinen des Buches, online zur Verfügung. Ein Anspruch auf Nutzung darüber hinaus besteht nicht.
Sollte dieses Buch bzw. das Online-Angebot Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte und die Verfügbarkeit keine Haftung. Wir machen uns diese Inhalte nicht zu eigen und verweisen lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung.
[5]Vorwort
Eigentlich lernen wir nur von Büchern, die wir nicht beurteilen können. Der Autor eines Buchs, das wir beurteilen könnten, müßte von uns lernen. Goethe 1749 – 1832
Das Erstere trifft bei Luhmann zu! Wer dennoch die Schlüsselwerke Luhmanns (1996) nach den »blinden Flecken« durchstöbert, findet diese im (Neuro-)Leadership (Wimmer 2012, S. 376), weil psychische Systeme »nicht näher betrachtet« (Luhmann 2020, S. 461) werden sollen. Als Funktion wird Leadership demnach kaum erwähnt. Der Fokus des Organisierens, das autopoietische Selbstreproduzieren, erfragt das Organisationsproblem, das existieren muss, damit Leadership (er spricht von Managern) eintritt? Was betreibt Leadership in dem sich selbst organisierenden System? Zwei erhebliche Probleme sollen erwähnt sein: Krisen – wie die Pandemie oder der Klimawandel – sind das Problem, in denen sich die Systeme ad hoc für personelle Entscheidungen öffnen, aber auch der Stellenwechsel ist nach Luhmann (2019) das Organisationsproblem, in dem Leadership bestimmend ist.
Weiterführende Fragen sind zu stellen: Was ist den Ursachen zuzuschreiben, was kann einem Leadership zugerechnet werden? In welcher Situation würde sich nicht jeder andere (Leader) genau so verhalten? Was liegt davon in dem Fortschreiben einer Kommunikation der neu zu besetzenden Stelle? Reaktionen in der Organisation auf den Systemwechsel sind vielfach sehr indirekt, auch emotional und brauchen selbstverständlich Mechanismen wie die Sicherheit und den Konsens: Neurowissenschaftliche Forschungen üben sich derzeit darin, neue biologische und neurophysiologische Erkenntnisse zu eruieren. Die Systemtheorie setzt Ansätze daraus – v.a. im Autopoiesiskonzept und Kybernetikansatz (das Beobachten zweiter Ordnung) – ein.
Daraus leitet sich ab: Gehirne richten sich zeitlebens darauf aus, Wandel zu bewältigen, ja, diesen sogar selbst zu erzeugen und als kerngesundes und sicheres Vermögen anzusehen. Die aktuellen Forschungen, die Neurosciences und das Leadership verjüngen, regen deswegen an, das Gedächtnis zunächst von den gegebenen Bedrohungen zu befreien und es mit Belohnungen zu aktivieren. Hier setzt ein Neuroleadership an, indem Führung hirngerecht zu gestalten wäre. Wie passiert es? In der Arbeit stellen die psychischen Systeme (Gehirne) sofort den Drehpunkt dar, die Konstante KI zu erkennen, denn so können die Neuroleadership-Formen etabliert werden. Hierzu sind die ersten Ansätze der jungen Disziplin vorgestellt – der ein SCARF-Ansatz (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness und Fairness) von Rock seit 2009 vorauseilt, die ersten Publikationen dazu folgten. In diesem Buch werden die Erkenntnisse vergleichend betrachtet und Kriterien [6]für den »Neurobased View of Leadership« entworfen. Neu ist, mit der Systembrille Luhmanns die Künstliche, Intuitive und Web-Intelligenz zu beobachten und für Entscheidungen im bewusst(er)en Leadership-Können (-gedächtnis) kenntlich zu machen.
Hierfür ist Knappheit der wichtigste Grund: Bisher wird die Ressource Zeit als knappes Gut und Entscheidungsproblem (Entscheidung unter Zeitknappheit) dargeboten. Erst jetzt stellt sich die Frage neu nach der Zeit und Kapazität zu bewusster Entscheidung (Entscheidung unter Knappheit von Bewusstsein) – der »nicht erweiterungsfähige[n] anthropologische[n] Konstante« (Luhmann 2016, S. 93). Daran merkt man, dass in den Ausführungen von Luhmann (2017, S. 122 f.) zum Gedächtnis der Gesellschaft die Eigenschaft von Zeit als eine Doppelorientierung gestaffelt wird und zwar: in Gedächtnis und in Zukunft, ein Oszillieren zwischendrin. Hierin ist eine Wucht der digitalen Medien zu deuten, die das Verzahnen von Vergangenheit und Zukunft (Gedächtnis- und Oszillatorfunktion) zu leisten vermag, wenn die Gegenwart, die über keine Zeit verfügt, eintritt. Damit hat Neuroleadership eine Medienfunktion von Redundanz und Varietät zu setzen.
Das stimmt zudem darauf ein, dass die KI menschliche Hirne ersetzen wird – ganz wie das Internet of Things die körperliche Arbeit und das mittelständische Handwerk. In der Weise verleiht der Neurobased View of Leadership die Vorstellung, wie forsch die Neurosciences die »Zuordnung von Hirnleistungen zu Hirnstrukturen« (Wandtner 2009) terminieren und bis zum Jahr 2050 anstreben, die menschliche Hirnen in der Braincloud (Musk/Neuralink 2019) zu vernetzen und durch KI »anzureichern«. Die Visionen eines Neurocapitalism – Gehirne sind der Marktplatz für Wettbewerbsarenen in sozialen Gebilden, so Meckel (2019, 2022) – erkennen, dass demnächst deutliche Zielvorstellungen zum Neuroleadership zu erbringen sind. In der »New Work« können – auch nach der Pandemie – die hybridesten Formen im Virtuellen Leadership oder Leaderships on demand nicht hinreichend bleiben, wenn das Zurück zu einer Präsenzarbeitszeit für die meisten Organisationen bereits außer Frage steht. Dann ist die Frage bedeutsam, wer will – und kann – in dem »Metaversum« immer immersiver arbeiten und managen?
Mein herzlicher Dank gilt Herrn Prof. Dr. Dr. Viktor Tiberius für den moralischen Beistand. Ich bedanke mich zudem beim Schäffer-Poeschel Verlag und besonders bei Herrn Dr. Frank Baumgärtner für das Publizieren in seiner Reihe zum Systemischen Management. Für ein Lektorat bedanke ich mich bei Frau Dreiseitel und Frau Dr. Schulz.
Potsdam, im April 2022
Dr. Heike Surrey
[11]Verzeichnis der Abkürzungen und Akronyme
AIArtificial IntelligenceALSamyotrophe LateralskleroseCLISCompletely Locked-in SyndromeBDHIHerrmann BrainDominance InstrumentBICBrain-Computer-InterfacesBOLDblood oxygen level dependentBWLBetriebswirtschaftslehreCTComputertomographieDTDesign ThinkingEEGElektroenzephalographieEKGElektrokardiogrammEKSEngpasskonzentrierte StrategieENSEnterisches NervensystemF&EForschung und EntwicklungfMRTFunktionelle MagnetresonanztomographiefNIRSfunktionelle NahinfrarotspektroskopieGPTPGolden Personality Type ProfilerHBMHarvard Business ManagerHDIHerrmann-Dominanz-InstrumentIQIntelligenzquotientKIKünstliche IntelligenzKMUKleine und mittlere UnternehmenKWTKognitionswissenschaft und KognitionstechnikLSOLuhmanns Schriften zur OrganisationMBTIMeyers-Briggs-TypenindikatorMRTMagnetresonanztomographieNIRSNahinfrarotspektroskopieOCAOccupational-Choice-AnsatzPETPositronen-Emissions-TomographiePZSPersonzentrierte SystemtheoriePIMSProfit Impact of Market StrategiesSCPSlow Cortical PotentialSESocial EnterprisesSEDTSystemic Entrepreneurial Design Thinking[12]SGMMSt. Galler Management-ModellSMRSensomotorischer RhythmusSTSystems ThinkingVSMViable System ModelVRVirtual RealityWebWorld Wide Web[13]1Einführung
1.1Relevanz und Problemstellung der Forschung
1.1.1Status quo in der Theorie sozialer Systeme
Luhmann (1984, 1996) unterscheidet in seiner Theorie sozialer Systeme zwischen den Maschinen (das sind nun die KI, das Brainreading, der Neuro-Chip im Kopf, Musk/Neuralink 2020), den biologischen Systemen (das Nervensystem) und den psychischen Systemen (das menschliche Bewusstsein) – diese drei Systeme sind eng verzahnt im Neuroleadership (z. B. Rock 2009, Purps-Pardigol/Kehren 2018) und sollen vorwiegend der Gegenstand dieses Buches sein. Dafür ist es erforderlich den Status quo festzulegen, was die Theorie – im Eiltempo der Maschinenintelligenz – zu leisten vermag.
Die Theorie Sozialer Systeme (Systemtheorie, Luhmann 1996) wird auch als »Theorie empirischer Systeme« (Bolz 2012, S. 23) bezeichnet. Luhmann (1996) fragt: »Es gibt Systeme. Aber wer gibt?«. Die Antwort heißt ›das System‹. Systeme geben (sich) die Daten in Form von von Programmen. Systeme wählen aus, sie geben sich also Werte, Geschichten, Dynastien oder Normen, mit denen sie die Werte, Geschichten, Dynastien und Normen gesetzmäßig machen (ebd.). Der Inbegriff von Systemen sind Immunsysteme, welche das ignorieren, was existent scheint und real einzutreten droht. Die Vorzüge sind Reduktion und Indifferenz – wie Macht und Geld –, die das »generalized media of interchange« (Parson 1937; Bolz 2012, S. 24) abbilden.
Somit stellt Luhmann (1996) den Einzelfall dar; wenn er es schafft, die Theorie an die Führungslehre anschlussfähig zu machen, dann wird zu konstatieren sein, dass es an Forschergeist wie Equipment mangelt, welche das Forschungsgebiet repräsentativ vertreten (Esposito/Hörl 2015). Wird den Führungsforschungen im deutschsprachigen Raum keine erhebliche Initiative zugeschrieben, weil solche Autoren1, die seit den 1970er Jahren konstatieren, welche Paradigmenwechsel anstehen und den Homo Oeconomicus zuschreiben, zu streitbar konstruieren? Während die deutschsprachige Führungsforschung tradiert, nehmen die angelsächsischen und asiatischen Formen unvermindert »an Fahrt auf«. Es ist zu fragen, warum die brauchbaren Forschungen insgesamt nur am Rande betrieben werden, während solche Forschungsalternativen im Ausland revolutionäre, vorzeigbare Resultate erzielen, deren Medien weitreichende Nutzer in aller Welt erreichen (Esposito/Hörl 2015)? [14]Der Vergleich unter Einbezug der Literatur vermittelt den Eindruck der relativen Homogenität und des Gleichklangs in Fragen, die auch die Forschungen von Luhmann (1984; 1996) betreffen: Zu Beginn wird Weber (1922) genannt, der führungszentrierte Ansätze postuliert, die rudimentär Zustimmung finden (patriarchalische, autokratische, bürokratische, charismatische Führungsstile). Die Autoren Ulrich (1987) und später Bleicher (1996) fördern einen zentralen Fokus des ganzheitlichen Führungsansatzes, der durch Norm, Strategie und Operation gekennzeichnet ist. Malik (2015; 2019a-c) setzt Kybernetik an zentraler Stelle des Leadership ein. Probst und Gomez (1991) entwickeln kybernetische Gesetzeshypothesen für Gestaltungs- und Lenkungsmechanismen. Bald veröffentlicht Wunderer (2011 [1997]) zu dem Aspekt Führung als Zentrum der Zusammenarbeit. Luhmann (2020a) selbst reflektiert die potenziell kreative Rolle von Paradoxien. Baecker (2015) pointiert postheroische Führung im Alltag und lehnt heroische Anleitungen, die er als dysfunktional beziffert, ab (vgl. außerdem Mitzberg 1973; 2019). Alle Autoren ziehen eine Vielzahl an Beobachtungsebenen heran, die nützlich sind, um das Phänomen Leadership zu erklären. Als Luhmann (1996) die Gesellschaftstheorie vorstellt, sind seine zentralen Themen Selbstorganisation, Komplexität, Offenheit und Geschlossensein, Natur und Gesellschaft und beziehen sich »Wiener, Varela, von Neumann, Shannon, Ashby« (Esposito/Hörl 2015, S. 2). Weiter wird ausgeführt, »[i]m deutschen Bereich sind die Verweise auf die Kybernetik expliziter. Es gibt eine rege Arbeit an der Wissens- und Mediengeschichte der Kybernetik und Lektüren des Kybernetisierungsprozesses« (ebd., S. 4). Dazu zählt von Foerster (1995) mit Beispielen der Neurophysiologie, die in die Theorie zur Kybernetik 2. Ordnung münden. Die soziologische Systemtheorie wird von Luhmann (1984) erstellt, der solche Prinzipien der Autopoiesis und der Beobachtung 2. Ordnung betrachtet, welche sowohl in die Ausführungen des gesellschaftlichen Lebens als auch in die ›Gesellschaft der Gesellschaft‹ (Luhmann 1997) einflossen:
Aber es gibt Luhmanns monumentales Werk ›Soziale Systeme‹. Er suchte vor allem bei Nichtsoziologen Inspiration und hatte vor allem bei Nichtsoziologen Erfolg. Die Gründe für die Luhmann-Inflation der letzten Jahrzehnte liegen auf der Hand. Seine Systemtheorie war und ist konkurrenzlos, weil niemand sonst den Mut zur Gesellschaftstheorie hat [...] Luhmann hatte den fabelhaften Mut, dieses Vakuum mit einem fünfundzwanzigjährigen Alleinunternehmen zu füllen. Bolz 2017
Von Luhmanns Schriften ausgehend haben sich Diskussionen äußerst begrenzt auf die globale, wissenschaftliche Gemeinschaft ausgebreitet (Esposito/Hörl 2015). Luhmann (1997) ist innig davon überzeugt, dass es den »Space of Flow« gibt, der die Kommunikation in jedem sozialen System sicherstellt: ganz im Sinne von Organisationen, die offen sind, und im Gegenteil zu Ländereien, Nationen oder Gesellschaften. So wird fest[15]gestellt: »›Globalisierung‹ ist die Wahrnehmung der Weltgesellschaft« (Bolz 2012, S. 14). Nach Bolz hat Luhmann
andere Anschlüsse gesucht, zum Beispiel bei Talcott Parsons und George Herbert Mead, oder bei Heinz von Foerster und Humberto Maturana. Damit ist das deutsche Denken weltweit wieder anschlussfähig geworden – aber doch nur um den Preis der Verschüttung und Tabuisierung jener ›spezifisch deutscher Traditionen‹ [...]. Dass man das Deutsche nicht mehr nennen kann, schafft eine Distanz, aus der das Faktum ›Weltgesellschaft‹ erkennbar wird.
ebd.
D. h., Luhmann nimmt es vorweg und sieht jene Vorteile der Zerstörung (»Unnennbarkeit« einzelner deutscher Sitten), die auf der Hand liegen: »Gerade wir Deutsche sind in der Lage die weltweiten Entwicklungen der Retribalisierung und des ethnischen Narzissmus auf Distanz zu halten und ›nur als Zuschauer mitzuvollziehen‹« (ebd.).
Es bleibt zu verankern,
dass sich die Systemtheorie im deutschsprachigen Wissenschaftsraum nach wie vor eines gewissen Zuspruchs erfreut, außerhalb dieses Raumes jedoch zunehmend in Vergessenheit gerät. Einen Systemtheoretiker kann das nicht wirklich erschüttern, weil er um die […] nachgewiesene jahrhundertealte Untergründigkeit systemtheoretischen Denkens weiß […] [D]ie Systemtheorie oder das, was man ihr zurechnen kann, [hat sich] jedoch von Anfang an zwischen alle Stühle gesetzt.
Baecker 2016, S. 7
In jedem Fall sollte festgestellt werden: Die Leitgedanken der General System Theory von Bertalanffy begründe »eine reguläre Disziplin […] und ein neues Paradigma« (de Zeeuw 2016, S. 64). Und weiter wird ausgeführt:
Von Bertalanffys Ideen haben im Gegensatz zum Begriff des Systems bis jetzt noch keinen Eingang in den Mainstream der Wissenschaft gefunden. Dennoch, die Deutlichkeit, mit der über bestimmte Probleme zur richtigen Zeit und am richtigen Platz gesprochen wurde, vermittelte den Menschen Hoffnung, nicht nur zu Lösungen der gesellschaftlichen Probleme der Politiker beizutragen, sondern auch, soziales Wissen zu würdigen und seinen instrumentellen Ge- und Missbrauch zu vermeiden.
ebd., S. 61
[16]Dem ist hinzuzufügen:
Im Unterschied zu Erdnussbutter kann man Kühe nicht in Teile schneiden, die selbst (kleine) Kühe sind ... Das Konzept der Systeme verhalf dazu, diese Erfahrungen als Ergebnis ›organismischer‹ Wechselwirkungen zu begreifen.
ebd., S. 65
Durch ein Anlehnen an die Systemtheorie, die als »fruchtbar« und »Glücksfall« betitelt wird, bauen die Kognitionswissenschaften vor. Denn
[e]s erschien eine ganze Reihe von »Schlüsselwerken«[,] in denen man für einen Moment den Eindruck haben konnte, dass die Systemtheorie zum theoretischen und methodischen Zentrum eines neuen Typs von Wissenschaft werden konnte, die vom ungeahnten Erfolg der Neurophysiologie ebenso profitierte wie […] vom Auftauchen des Computers. Das ist inzwischen wieder vorbei, die Systemtheorie hat die Konkurrenz um Lehrstühle, Forschungsmittel und Verlagsprogramme gegen die Kognitionswissenschaften, an deren Grundlegung sie mitgearbeitet hatte, weitgehend verloren, aber noch sind ihre Spuren nicht alle getilgt.
Baecker 2019a, S. 8 f.; Hervorh. d. Verf.
Die Kognitionswissenschaften vermochten sich durchzusetzen, mehr als angenommen, wegen der Wurzeln, denen sie sich widmen. Ist zu berichten, welchem modernen Wissenschaftsansatz sich bedient wird,
hat der Konstruktivismus Furore gemacht, wenngleich eher in den Geistes- und Sozialwissenschaften als in den Natur- und Biowissenschaften einschließlich der Psychologie, denen er eigentlich entstammt, wenn man an Autoren wie Jean Piaget, Paul Watzlawik, Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster, Humberto Maturana und Francisco Varela denkt (wobei letztere Drei sich nie als Konstruktivisten verstanden). Vieles von dem, was diese Autoren an Vorstellungen und Modellen entwickelten, ist heute fester Bestandteil der Kognitions- und Neurowissenschaften, was nicht verwundert, weil Piaget, Maturana und Varela selbst aktive Kognitionsforscher waren.
Roth 2018, S. 213; Hervorh. d. Verf.
[17]Es geht als der neurobiologische Konstruktivismus in die Forschung ein (ebd.). Roth unterstellt, dass die
»Erlebniswelt«, die Wirklichkeit, ein Konstrukt des Gehirns ist. Freilich kann so etwas auch ein erkenntnistheoretischer kritischer Realist akzeptieren […], vorausgesetzt unser Gehirn »re-konstruiert« aufgrund von Sinnesdaten, Gedächtnisinhalten und Denkprozessen die Realität zumindest ungefähr so, wie sie tatsächlich ist. Das entspricht dann einer kritischen Abbildtheorie. Brisant wird es erst, wenn man aus den sinnesphysiologisch-neurobiologischen Erkenntnissen folgern muss, dass das Gehirn gar nichts abbilden kann, also nicht re-konstruiert, sondern konstruiert.
ebd., Hervorh. d. Verf.
Indessen drückt dieser Absatz eine Kritik an den bildgebenden Verfahren (der »Abbildtheorie«) als nachgerückte Wissenschaft aus (Abschn. 4.1.8.2). Roth (2018) formt einen Essentialismus. Es ist bekannt, dass Widersprüche allgemein nicht zu bejahen sind. Es bedingt das Abwenden von Erkundigungen, die nach dem »Wesen der Dinge« fragen (ebd.). Dies ist in der Leadership-Forschung ebenfalls zu betrachten, wenn der Erfolg von Leadership thematisiert würde. Es gibt so ein Modell nicht, das sicherzustellen vermag, dass Leadership zu Erfolgen – deren Art ebenso unbestimmbar ist – lenkt (vgl. Surrey 2018a). Es wird mit Fragen von Esposito und Hörl resümiert, was neben den Neurosciences die Forschungsperspektive darstellen soll:
Kann es nützlich sein, sie [Kybernetik und Systemtheorie, Anm. d. Verf.] heute zu reaktivieren – in Zeiten der neuen Herausforderungen durch das Internet der Dinge, von Webintelligenz, sozialen Medien, algorithmischer Gouvernementalität und einer neuen Ökonomie des Verhaltens, schließlich von sich ausbreitenden Technoökologien, allgemeiner gesagt in Zeiten, die infolge des Eindringens von Formen der Informationsverarbeitung (und der Kommunikation) und der allgemeinen Kybernetisierung der Existenzweisen die traditionelle Trennung zwischen Technik (und Natur) auf der einen Seite und Bewusstsein (oder Gesellschaft) auf der anderen herausfordern? Kann angesichts der vergessenen gemeinsamen Ausgangspunkte womöglich gerade die Verschiedenheit der Forschungsrichtungen eine gegenseitige Anregung für die dringliche Auslegung unserer gegenwärtigen technologischen Bedingung bringen, anstatt ein bloßes Hindernis darzustellen?
Esposito/Hörl 2015, S. 4
[18]1.1.2Status quo in der Leadership-Forschung
Was Luhmann zu Leadership erforschte, ist zu wenig von der Öffentlichkeit angenommen oder wahrgenommen worden. Beobachtet man die einschlägigen Leadership-Themen und -Arbeiten seit den 2000er Jahren, so ist augenscheinlich, dass sich diese überwiegend an den englischsprachigen A-Journals und der »Scientific Community« orientieren (bspw. Wimmer 2016; Kruschwitz et al. 2021; s. Kasten am Ende des Abschnitts und Harvard Business Manager 2019). Aber dies gilt auch anders herum: So intensiv weiterhin nach dem Leadership-Typ der Zukunft gesucht wird, so sehr die unzähligen Veröffentlichungen die Szene und eine Leadership-Science prägen werden, so ist die Suche nach »diese[n] Aspekte[n] in Luhmanns Überlegungen« vergeblich: Luhmann ist diese Antwort auf die Frage, wie das Organisationsproblem lautet, auf das Leadership antwortet, »schuldig geblieben« (Wimmer 2016, S. 376). Was getan werden müsste, um dem Gemenge ein Ende zu bereiten, ist das Grundlegende zu erklären – nämlich einen Status quo.
Ausgehend von dieser Überlegung gilt zusehends das Leadership als eine Funktion, die »im Oszillieren zwischen Selbst- und Fremdreferenz« spezialisiert wird. Eine Organisation »mit jenem Maß an Beunruhigung zu versorgen« und diese mit »Aufmerksamkeit auszustatten« (ebd.), ist das Ziel, wenn es um Fragestellungen zur »eigenen Passung« und den unternehmerischen Erfolgsindizes geht (die sozialen Unternehmen verfolgen indes weitreichendere Ziele, vgl. dazu Surrey 2020). Hier sind zwei Komponenten gleich erwähnt, die für das neue Neuroleadership sprechen: die Unruhe i. S. v. irritabel und die Aufmerksamtkeit i. S. v. Achtsamkeit oder Mindfulness. Weil das »konsequent ›entpersonalisierte‹ Verständnis« (ebd.) von Leadership nicht zutreffend sein wird (oder die Idee »kaum Eingang gefunden« hat), können die nachstehenden Ausführungen dazu beitragen, Leadership als »Sinnstreben« bzw. als »sinnstiftendes Ziel« (Peters 2015, S. 12) zu demonstrieren. Es bleibt weiterhin ein äußerst schwierig zu umreißender Begriff,
da zahlreiche Führungstrends ständig neue Leadership-Konzepte hervorbringen […,] die Leadership-Forschung [sich] im Wandel befindet und permanent neue Ausprägungen entdeckt werden können. Insbesondere unter dem Begriff »New Leadership« haben sich neue Leadership-Ansätze etabliert, die eine stärkere Betonung der emotionalen Komponente in den Vordergrund stellen
ebd., S. 13
Hierzu zählen bspw. (in alphabetischer Reihung): Authentic, Cultural, Cross, Distance, Diversity, Ethical, Mindful, Self, Servant, Shared und Virtual Leadership (ebd.; Surrey [19]2018a). Mit der Leadership-Forschung folgt der Paradigmenwechsel. In Diskussionen, in denen die Termini wie »Programm, System, Speicher, Kontrolle, Maschine sich nicht oder nicht in erster Linie auf technische Fragen bezogen, sondern eine außergewöhnliche wissens- und theoriepolitische Reichweite hatten und zu Chiffren einer Infragestellung der überlieferten epistemologischen und ontologischen Überzeugungen avancierten« (Esposito/Hörl 2015, S. 2), kam eine Kybernetik- und Managementlehre auf. In deutschsprachigen Arbeiten mussten die Interessen von Wandel in den Annahmen und den Konsequenzen erst geweckt werden, um sich den oben genannten Herausforderungen zu stellen.
Mitte der 1970er Jahre publizierte Heinen (1976; 1992) zur betriebswirtschaftlichen Führungslehre als dem entscheidungsorientierten Ansatz. Die Interessen innerhalb der Führungslehre spalteten sich, da dieser fordert, das Individuum in den Mittelpunkt der Organisationen zu stellen. Sein Ansatz geht ein, als »späte Entdeckung des Humanismus durch die Betriebswirtschaftslehre... Aber auch hier musste man dann feststellen, dass der Humanismus zwar eine intellektuelle Bewegung, aber keine Wissenschaft und erst recht keine Handlungslehre ist« (Baecker 2018b, S. 50). Als Soziologe legt Baecker (ebd., S. 49 f.) dem »Betrieb« die Beweggründe nahe, weil er weiß, dass Gutenberg (1929; 1958) über »ökonomische Intelligenz« verfügt, denn dieser gab bekannt: »[D]ie BWL [muss] die tatsächliche Komplexität einer Organisation einklammern […], um sie so in einen ›Betrieb‹ zu verwandeln«. Die Sichtweise, »[d]ie heutige BWL scheint das zuweilen vergessen zu haben« (ebd., S. 50), sei allein durch den Irrtum zu erklären, die Betriebswirtschafts- und die Führungslehre (Effizienzlehre) wären obsolet und würden maximal in der »Betriebstechniklehre« (Effektivitätslehre) versickern. Die Führungslehre (neudeutsch ›Leadership‹) ist daher »keine Gegenbewegung, sondern ein Supplement, eine Ergänzung. Die Betriebswirtschaftslehre [inkl. Leadership, Anm. der Verf.] hält einen mehr oder minder losen Kontakt zur Wissenschaft, je loser, desto normativer sie ist, die Betriebstechniklehre, die es nicht gibt, glänzt derweil durch eine anwendungsbezogene Forschungspraxis« (ebd., S. 50).
Den zentralen Fokus bilden die Gestaltungs- und Lenkungsbemühungen zur schnellen Findung der Leistungsfähigkeit des Unternehmens als vielschichtige und -dimensionale soziale Ganzheit. Damit stellt Ulrich »sich mit dieser Konzeptualisierung des Gegenstandes wissenschaftlicher Betrachtung scharf gegen die charakteristische Engführung auf rein wirtschaftliche Fragestellungen des Betriebs, wie sie sich in der Tradition der deutschsprachigen BWL im Anschluss an Gutenberg (paradigmatisch prägend seine Habilitationsschrift aus dem Jahr 1929) allgemein durchgesetzt hat« (Wimmer 2016, S. 361). In der DACH-Region wurde ein einzelner Forschungszweig avisiert, die Management- und Leadership-Debatten zu forcieren und Facetten wie die Kybernetik, die zirkuläre Kausa[20]lität und die Feedbackschleifen etc. zur Hilfe zu nehmen. Mit dem Entkräften, dass dem Management reines Zweckinstrumentarium (Zweck heiligt das Mittel) wichtig sei, bildeten sich zentrale Leadership- und Managementschulen an der FU Berlin und danach im »Valley« St. Gallen heraus. Der Systemansatz wurde durch die St. Galler Wissenschaftler Bleicher, Malik, Krieg, Gomez, Probst, Oeller, Siegwart, Dyllick u. a. um den Gründungsvater Ulrich (1968, Unternehmung als soziales System überarbeitet (vgl. Wimmer 2016, S. 362). Zu den wesentlichen Neuerungen zählen die Förderung eines Systemverständnisses, das von komplexen und dynamischen Kontexten abhängig ist, einer Problemlösungsmethodik für die Umsetzung von Managemententscheidungen und eines normativen, strategischen, operativen Führungskonzeptes (Schwaninger 2016, S. 356). Die revolutionäre Horizonterweiterung wird als Leistung für den Aufbau einer führungsorientierten Betriebswirtschaftslehre herausgestellt. Diese Erweiterungen sind: die mehrdimensionale Betrachtung von Unternehmen und Management, das umweltintegrative Gehäuse, das wertebasierte und normative Führungssystem, die wissenschaftsinduzierten Formen der Naturwissenschaften, der systemische und ganzheitliche Ansatz, die vielseitige Managementbildung und das soziale System öffentlicher Organisationen, Non-Profit-Organisationen und Shareholder (ebd., S. 356 f.; Wagner 1993; 1994; Wagner/Nolte 1996).
Die Diskussion ist indes wegen der beschnittenen Forschungsmöglichkeiten zwischen den angelsächsischen und deutschsprachigen Akteuren schwierig, da letztere nur gelegentlich übersetzt werden. In den wichtigsten Abhandlungen beziehen sich beide auf dieselben Referenzautoren, Begriffe und Probleme der altbekannten Phänomene wie Autonomie, Selbstorganisation, Rekursivität, Paradoxien. Zuweilen nehmen die Akteure an den elitären Forschungstreffen teil, die die Community für sich behält. Welche Publikationen werden als interessant erachtet und differenzieren eigene Sichtweisen? Welche nationalen wie internationalen Forscher bzw. Teams beziehen sich derzeit auf die Urhebermaterialien der Autoren Ulrich, Bleicher, Malik und Luhmann? Die zentralen Forschungsergebnisse sind eigentlich nicht international publiziert (übersetzt) worden und dann sind bedeutende Erkenntnisse populär dargestellt worden, um sie zu marginalisieren. Der Harvard Business Manager (2019) kürte die renommiertesten Autoren in der Leadership- wie der Managementforschung (vgl. Box ›Praxisaspekt‹). Mit Google-Expertise ist sichtbar geworden, dass Maxwell (2019) und Godin (2012) die Liste der Experten für Leadership anführen (Haden 2014). Deutschsprachige Verfasser finden keine Erwähnung. Die Ausführungen von Drucker (1963; 1996) und Luhmann (1984; 1996) werden in demselben Atemzug benannt (Bolz 2012). Die Parallelen sind Begriffe wie die ›nächste Gesellschaft‹ und die ›Postmoderne‹. Baecker (2018b, S. 11) setzt auf weitere Forschungen i. S. v. Integrationen und spricht von der »nächsten Gesellschaft«. Diese muss die Frage beantworten können, wie die moderne Gesellschaft in der Digitalisie[21]rung »funktioniert«. Die ›nächste Gesellschaft‹ »wird immer nur versuchen, Anschluss zu finden« (die Anschlussfähigkeit im Luhmannschen Sinn) und »im Fluss zu bleiben. Zwar geht nicht alles, aber alles ging, und die Frage lautet nur: Wie geht es weiter? Finde den Anschluss« (ebd., Hervorh. d. Verf.).
Praxisaspekt
Der Harvard Business Manager kürte die wichtigste Autoren und Zentren der letzten 40 Jahre Leadership- sowie Managementforschungen. In diesem Feld »tummeln« sich diese renommierten Wissenschaftler und Praktiker: Peter F. Drucker und John P. Kotter (Führung); Michael E. Porter und C. K. Prahalad/Gary Hamel (Strategie); David P. Norton/Robert S. Kaplan und Michael Hammer (Organisation); J. Sterling Livingston und Dave Ulrich (Personal); Joseph L. Bower/Clayton M. Christensen und Steve Blank (Innovation) (vgl. HBM 2019).
1.1.3Zwischenfazit
Baecker (2015) erörtert, wie erforderlich es ist, die heroische durch die postheroische Führung zu entkräften.2 Das Konzept postheroischer Führung ist relevant, da »bestimmte Annahmen der Moderne […,] Organisationen als die rationale Form der Umsetzung von Zielen und Aufträgen in dazu passende Mittel und Wege zu verstehen, fragwürdig wurden« (Baecker 2015, S. 3). Luhmann (1984) fordert, den Blick auf anderes zu lenken, als es die BWL vorgibt. Die Organisation profitiere, da sie zu der suchenden und ergründenden Funktion in der BWL würde. Die Organisationstheorie
konzipiert Organisationen daher nicht mehr als zieldefinierte, sondern als zielsuchende Systeme […]. Die postheroische Führung korrespondiert mit einer postklassischen Organisation, […] wo die klassische Organisation nur Entscheidungen kannte: bei der Trennung hierarchischer Ebenen, bei der Ziehung von Abteilungsgrenzen, bei der Einrichtung der Arbeitsteilung, bei der Zuweisung von Kompetenzen und nicht zuletzt bei der Kontrolle von Erfolg und Misserfolg. Postheroische Führung besteht darin, ihrer Organisation bei der Suche nach jenen Zielen zu helfen, die nicht vorab definiert sind, sondern gesetzt, getestet und verantwortet werden müssen.
Baecker 2015, S. 4 f.; Hervorh. d. Verf.
[22]Wimmer (2016, S. 371) erkennt Ulrichs (1968; 1987) Versuch an, den Systemansatz in die BWL zu integrieren, jedoch sind sie von »Vertretern dieser Disziplin nicht wirklich aufgegriffen worden«. Stattdessen wird in Frage gestellt, ob »die Betriebswirtschaftslehre und die Managementlehre […] ›überhaupt viel miteinander zu tun haben‹ […]. Mit Blick auf Management braucht es einen anderen Begründungszusammenhang, eine andere theoretische Fundierung, als sie von der BWL bislang zur Verfügung gestellt wurde« (Wimmer 2016, S. 363). In der wissenschaftlichen Argumentation stelle diese Sicht die »Außenseiterposition« (ebd., S. 371) dar. Malik (z. B. 2020) nahm das »enorme denkerische Potenzial der ›Kybernetik 2. Ordnung‹ (von Foerster 1995)«, aber auch die Verbreiterung »dieses Potenzials in der Soziologie eines Niklas Luhmann nicht zur Kenntnis« (ebd.). In der Folge kam es »zu keiner wechselseitigen Befruchtung mit jenen Forschungsaktivitäten, die sich im Rahmen der Theoriearchitekturen der neueren Systemtheorie speziell mit Organisations- und Führungsfragen beschäftigt haben«. So beklagen die jungen Forschungsströmungen die »konsequente Nichtrezeption« (ebd.). Aus heutiger Sicht war die frühere Betriebs- und Führungslehre – geprägt von Schmalenbach (1949) und Gutenberg (1958) – praxisfern (HBM 2019, S. 2). Die St. Galler Management Schule, wie sie Ulrich (1968) und später Bleicher (1996) entwerfen, hat sich »in den angloamerikanisch geprägten Mainstream der Management Sciences erfolgreich eingepasst« (Wimmer 2016, S. 371).
Im Zuge dieser postheroischen Führung ist zu erwähnen, dass Luhmann »souveräne Politiker, mutige Unternehmer, charismatische Propheten, große Autoren und geniale Künstler […] wegerklär[t hat]. [...] Der Heroe ist der ›Zufall, den die Gesellschaft auswählt‹. An die Stelle tritt ›der große Evolutionsmechanismus von Variation und Selektion, von Auflösung und Rekombination‹« (Bolz 2017). Dasselbe trifft für Luhmann (1996) als Begründer einer »Supertheorie« zu. Dieser »stellte sich nicht als Urheber seiner Werke dar, sondern als eine Art Zufallsgenerator, der ein Gewebe von Kombinationsmöglichkeiten im Universum der Wissenschaft produziert. [...] Sein Cogito lautet: Der Zettelkasten denkt« (Bolz 2017; sinnhaft 2012, S. 12). So betrachtet ist Luhmann der »Computer, der selektiert und kombiniert«, die wissenschaftlichen Erfolge sind »in Wahrheit Zufälle« und Erfinder sind eine »Zufallssortiermaschine« (ebd.). Bezogen auf die Forschungen zur KI braucht es nach Esposito und Hörl (2015, S. 2) sogar die »hochmediatisierte« und »hyperkybernetisierte Kondition […] für die dringliche Aufgabe der Neubeschreibung«.
Merke
In den späten 1980er Jahren hat sich unter dem Label der »systemischen Führung« ein klares Segment innerhalb des Spektrums Führung firmiert. Der Begriff »systemisch« kennzeichnet, dass Leadership die Urteilsfähigkeit der anzugehenden Aufgaben (Komplexität, [23]Kreativität, Wandel etc.) aus dem systemtheoretischen Background schöpft und dass sich das Systemwissen als Bestandteil von Leadership eignet. Gleichwohl regt die Anwendung der mit dieser Art von Leadership erlangten Erkenntnisse die Theoriebildung an (vgl. Abschnitt 5.4.2).
1.2Forschungsparadigmen
Werden Formulierungen wie, »die Organisation mit Maß an Beunruhigung zu versorgen« und mit »Aufmerksamkeit auszustatten« (Abschn. 1.1.2), im Kontext von Führung gewählt, sind relevante Kriterien für die Neuerungen im Leadership zu erkennen, die jetzt für Neuroleadership-Forschung einstehen und gegenwärtig die besondere Bedeutung kennzeichnen. Es können Attribute wie das Unruhestiften (Irritation) und die Aufmerksamkeit (Achtsamkeit) sein, die als neuwertig gelten und das Neuroleadership pushen und kreieren helfen.
Ein Fortschreiten von Leadership hin zu Neuroleadership ist mit dem Paradigmenwandel in den Forschungen etwaiger Leadership-Ansätze zu erzielen. Es wird zu prüfen sein, ob die Debatte »Neuro-Leadership: alter Wein in neuen Schläuchen?« (Surrey 2018a, S. 165 ff.) verpufft und Reinhardts (2015) forsches Formulieren obsolet würde, da die Erkenntnis- und die Verwertungsinteressen vorliegen – bezogen auf die Aussage: »›Neuro‹ hat beste Chancen, sich zu einem Hype zu entwickeln: ›Hype‹ meint, dass die Indizierung mit dem Präfix ›Neuro‹ zu einer erhöhten Akzeptanz entsprechender Konzepte führt, ohne dass diese kritisch hinterfragt werden: ›Neuro‹ dient als Gütesiegel« (ebd., S. 18).
Ein Wechsel hin zu Neuroleadership ist mit dem Paradigmenwandel in der Soziologie gleich zu erklären bzw. zu verschmelzen. Dieser Systemwechsel bezieht sich auf die »Begriffsbildung, Beobachtung und Apparaturen« (Kuhn 1976, S. 57). Die Paradigmen induzieren auf den Gebieten der wirtschafts-, der human- wie den sozial- oder den naturwissenschaftlichen Forschungen wichtige Erkenntnisse für die Neurosciences im Allgemeinen und das Neuroleadership im Besonderen. Die Abbildung 1.1 zeigt Schnittmengen und Verästelungen in den Fachdisziplinen der Natur- und Geisteswissenschaften. Es wird sichtbar, dass die Forschungen über das Gebiet keinesfalls überschneidungsfrei bleiben, sondern Strömungen einfließen, die Eingang finden in das zu analysierende Neuroleadership. In diesem Buch sind das die jungen Neurosciences und die neue Systemtheorie nach Luhmann (1996) sowie zwei fachferne Dimensionen der Leadership-Ansätze, die bislang kaum Berücksichtigung finden konnten (Rock/Schwartz 2006). Die Ergebnisse aus den Forschungsbemühungen fließen ein in das Neuroleadership, das Neuroconsulting und das Neurocoaching (Kapitel 6).
Abb. 1.1: Bezugsrahmen des Buchs
Das Buch wird die Leser durch drei Fragen leiten:
Welche Annahmen der Neurosciences und der neuen Systemtheorie extrapoliert das Neuroleadership auf dem Weg zum Neuro-based View?Welche Kenntnisse liegen hierzu vor – welche Konzepte und Ansätze sind forschungsrelevant?Welche Gütekriterien formen ein neurobasiertes Leadership-Denken und -Verhalten?Wirtschaftswissenschaften
Seit die neuronale Plastizität (Hebb 1949)3 entdeckt wurde, sind unzählige Versuche unternommen worden, diese Formbarkeit des Gehirns, die unabhängig vom Alter besteht, zu entwickeln. Die Potenziale liegen so auf der Hand: Neuronale Verkettungen, die jederzeit neu gebildet werden können, ermöglichen es, die gewohnten Arbeits- und Denkweisen durch neue Prozesse zu verbessern (Hebbsche Lernregel). Im Leadership ist dies als der Heilansatz betrachtet worden, so dass Reinhardt (2014b, S. 40) ausführt: [25]»Eine ›gehirngerechte‹ Perspektive leitet die Diskussion über die Veränderbarkeit von Verhalten […], da dieser Forschungsansatz die grundsätzliche Änderbarkeit auch von tief verankerten personenbezogenen Merkmalen belegt«. Zudem ist gezeigt worden, dass die negativen sozialen Reize mit den physischen Beschwerden gleichempfunden werden. Das bedeutet wiederum, diese sind im limbischen System aktiviert und, »[d] a durch negative soziale Reize dieselben Gehirnregionen stimuliert werden wie bei physischem Schmerz, lassen sich dieselben Verhaltenskonsequenzen ableiten, wie in diesem Fall Rückzug, mangelnde Motivation und schließlich Leistungszurückhaltung« (ebd.).
Insbesondere das Ordnungsprinzip der Gehirne, das Minimierungsprinzipien von Bedrohungen bzw. Maximierungsprinzipien von Belohnungen vorsieht (Grawe 2004; Rock/ Schwartz 2006; Ringleb/Rock 2009), wird indes für das Leadership eingesetzt. Das Gehirn aktiviert die Belohnungen und lehnt die Bedrohungen ab. Es sind die folgenden zwei Ansätze zu unterscheiden: Die negative emotionale Bewertung aktiviert das Vermeidungssystem, die positive Wertung das Annäherungssystem. Beide Motive sind fähig zu korrespondieren, so dass Verhinderungsstrategien eintreten, oder sie werden unabhängig voneinander aktiviert. Je weniger diese Unabhängigkeit besteht und je mehr Vermeidungs- oder Annäherungssysteme gebahnt werden, umso mehr sind Aktivitäten zu attestieren, weil Individuen häufig diese ablaufenden Prozesse beschränkt bewusst und selbst steuern. Zudem wird festgestellt (s. auch Abschn. 4.1.2.2):
Das Erleben von Bedrohung wird deutlich intensiver und andauernder erlebt als die durch Belohnung ausgelösten Reaktionen, da Erstere zum einen wesentlich schneller verarbeitet werden und zum anderen in besonders hohem Maße Kapazitäten des Gehirns beanspruchen, die dann nicht mehr für logische Denkprozesse und zur Problemlösung zur Verfügung stehen können.Reinhardt 2014b, S. 40
Human- und Sozialwissenschaften
Luhmann (1996, S. 346 ff.) beteuert die Individualität psychischer Systeme. In der Hinsicht wird es sich zur Aufgabe gemacht, die Randgebiete zu erforschen, da diese in den »Ambitionen der Philosophie des Bewußtseins« (ebd., S. 299) liegen. Baecker (2019a, S. 82) konstatiert, dass im 19. Jahrhundert die Neurosciences »an die Stelle der Theologie und Philosophie« traten. Ein Begriff der Intuition erkennt eine Welt der Objekte und des Körpers, die in Relation zueinander stehen, an. Es fehlt die Definition; es gilt »schon deswegen als intuitiv […], weil kein überlieferter Begriff die Sache trifft« (ebd., S. 81). Ein Begriff der Intuition soll indes befürwortet werden, da dieser
[26]die Unmittelbarkeit der Anschauung (lat. intuitio) mit der Genauigkeit des Hinsehens (lat. intuen) verbindet und somit in der Tat methodisch davon ausgeht, dass es in der jeweiligen Gegenwart eines kognitiven Akts hochgradig differenzierte und vermittelnde Prozesse zu entdecken gibt. In der Tradition hatte man dafür den Begriff der divinatio, der göttlichen oder magischen Zeichen, die ebenso evident wie schwierig zu entschlüsseln sind.
ebd., S. 81 f.
Infolgedessen wird Luhmann (1996) als Initiator für die Betrachtung einer Individualität in psychischen Systemen zitiert, indem er nebst sozialen Systemen »›biologische Systeme‹ – bezogen auf Organismen, Zellen, Nervensysteme, Immunsysteme – und ›psychische Systeme‹ – bezogen auf das menschliche Bewusstsein« – (Berghaus 2004, S. 32; Abschn. 3.2.1) beobachtet. In der Systemperspektive sind Individuen keine Einheit, die es zu beachten gilt, denn »[s]ein Körper ist ein biologisches, sein Bewusstsein ein psychisches System […] und soziale Systeme lassen sich in menschliche Handlungen dekomponieren« (ebd.). Es fehlt der Systemtypus, der das vereinen kann, weil Menschen »keine Analyseeinheit« sind (ebd.). Als Luhmann (1996) die Systemtheorie vorlegt, verzichtet er auf die altbekannten Differenzierungen der Systeme und beanstandet historische Traditionen mit dem radikalen antihumanistischen Gesellschaftsbegriff, denn wer Schemen wie Massenmedien und -kommunikationen, öffentliche Meinungsbilder, KI etc. kritisch zu analysieren beabsichtigt, muss sich zwangsläufig von den Individuen »als Analyseeinheit verabschieden« (Berghaus 2004, S. 34). Von Luhmann (1996) wird es als eine Randoption beschrieben, »die wir hier nur ganz knapp und nur zur Klärung grundlegender Optionen skizzieren können« (ebd.; Urban 2013, S. 89 f.).
Manche Autoren (Luhmann 1996; Rock/Schwartz 2006; Ringleb/Rock 2009; Boyatzis/ Jack 2018) wenden sich der Frage zu, wie das Gehirn zu entklassifizieren ist – wie ein »soziales Organ« bzw. ein »social brain« « Die Annahme besteht in dem Zusammenlegen von Gehirn und sozialem Organ, sie sind ein und dasselbe (Hüther 2009a). Die Gehirne sind demnach individuelle Perspektiven, die als soziales Handeln erlebbar werden können. Das unterstützt der Systemkybernetiker Stafford Beer (1954) und entwickelt mit »Brain of the Firm« (1972 [1984]) ein Standardwerk für die Managementforschung, das durch »The Heart of Enterprise« (1979 [1995]) ergänzt wird. Daran schließen sich Fragestellungen zu Neuroleadership an. Wird die Frage gestellt: ›Hirn oder Herz, was wird die entscheidende Komponente für die Führung in der Zukunft sein?‹, antwortet Herbst in der Weise:
Hirn, und zwar weil Herz im Hirn sitzt. […] Emotion und Intuition sind für die Zukunft entscheidend, weil nämlich darauf das Verhalten von Menschen basiert und unser Gehirn am Ende des Tages über alles entscheidet. Das heißt, wenn wir [27]Menschen bewegen und verändern wollen, müssen wir uns davon verabschieden, dass wir über Appelle und rationale Argumente Menschen bewegen wollen.
Herbst 2019, S. 7; Hervorh. d. Verf.
Naturwissenschaften
Des Weiteren ist das Gehirn als »intelligentes Organ« und das »Hypothesengenie« bezeichnet worden, indem vorausgeschickt wird, das »ureigene Prinzip: ›Was macht das Gehirn intelligent?‹ ist bisher noch nicht verstanden« worden (Muckli interviewt von Hubert 2014). Die Verfechter um Muckli stellen die These auf, »dass das Gehirn vor allen Dingen eine Vorhersagemaschine ist, die versucht, alle zu erwartende Information herauszufiltern« (ebd.). Friston (interviewt von Hubert 2014; Luhmann, H. 2020, S. 77 ff.) teilt die Auffassung, indem er das Hirn als den Vorhersagekünstler im »Prinzip der freien Energie« tituliert. In dieser
Fassung handelt es sich nicht mehr um die thermodynamische freie Energie, wie sie in der statistischen Physik berechnet wird. Nur formal gesehen handelt es sich um das gleiche mathematische Konzept. Ich übertrage es einfach auf die Informationstheorie. […] Das Prinzip der freien Energie besagt, dass alle Organismen, die überleben, der natürlichen Tendenz zur Unordnung und Auflösung widerstehen. Ein Weg, das zu gewährleisten, besteht darin, in einer Weise mit der Welt in Kontakt zu treten, dass wir eine innere Struktur aufrechterhalten. Wir streben nach Konstanz und möchten Überraschungen vermeiden.
ebd.
Friston entwickelt Thesen, die darlegen, wie Gehirne arbeiten, um Energieeinsätze zu initiieren. Dies wird mit »eleganten Formeln« (Hubert 2014) belegt. Danach sind Gehirne bestrebt, den eigenen Energieeinsatz zu transformieren, so dass diese autopoietisch (Luhmann 1984) zu bewerten sind. Die ganz neue »neurowissenschaftliche Weltformel« lautet demzufolge: »Lebendige Systeme müssen Unordnung vermeiden […]« (ebd.). Weiter erforscht Friston (interviewt von Hubert 2014), »dass die Areale der Großhirnrinde hierarchisch gegliedert sind. Dass das Gehirn Feedbackschleifen braucht. Oder dass die Kontrolle von Bewegung auf der Vorhersage von Körperempfindungen beruht. Umgekehrt besteht überhaupt kein Grund mehr zur Veränderung, wenn zwingende Körpersignale ausbleiben«.
Walter (interviewt von Hubert 2014) erläutert indes die Forschungen zur Gesichtserkennung: »›Free energy‹ […] erklärt uns fast alles, was wir vorher anders auch erklären [28]konnten, aber nicht so gut«. In dem abstrakten Mathematikentwurf werden als solches die Probleme gesehen, denn
mit komplizierter Mathematik kann man alles erklären, und die Frage ist, wie stark spiegelt das die Realität wieder. Da gibt es einige Hinweise, zum Beispiel die Verschaltung von Kolumnen, die Verschaltung des Gehirns, manche Befunde aus Verhalten und Neurowissenschaften. Aber eine Frage ist, zum Beispiel: Wenn die Theorie falsch wäre, wie könnte man sie denn als falsch erweisen?
ebd.
Dazu kann resümierend festgehalten werden, dass Informationsasymmetrien vorherrschend sein können (Beer 1954; Bleicher 1996; Malik 2019a-c), bis kaum zu übersehen ist, dass »die Welt komplex ist, [von daher] fehlen uns immer Informationen. Weil Informationen fehlen, sind wir immer unsicher. Weil wir unsicher sind, gibt es für uns keine wahre Antwort, sondern nur den Konflikt der Meinungen. Zwietracht, Widerstreit, Dissens. Deshalb müssen wir ohne Grundlagen leben und Abschied vom Prinzipiellen nehmen« (Bolz 2017). Da zahlreiche Arbeiten zum Leadership und zu den Neurosciences diese Aufgaben bewältigen wollen, schließt sich das vorliegende Werk dem – unter Hinzuziehen der Systemtheorie – an. Seit Luhmann den Begriff der Organisation erörtert hat, sind Intuitionen wie folgend zukunftsgerichtet dargestellt:
Die relative Unabhängigkeit von formaler und informaler Ordnung bedeutet nicht, daß Verbindungen und kausale Wechselwirkungen fehlen, sondern nur, daß beide Ordnungen relativ unabhängig voneinander variierbar sind. Ihr Änderungsstil ändert sich. Informale Erwartungen ändern sich kontinuierlich, langsam und unmerklich […]. Ihr Inhalt, ihre Sicherheit und Normstärke, der wahrgenommene Konsens kann sich verschieben; ihre Begründung, ihr Zusammenhang mit anderen Erwartungen wandeln sich in vielfältige Umdeutungen. Formale Erwartungen sind dagegen an scharf geschnittene Identitäten geknüpft. Sie gelten oder sie gelten nicht. […] Diese Unterschiede des Änderungsstils führen notwendig zu Differenzen und Widersprüchen.
Luhmann 2016, S. 18 f.
In ein Leadership überführt, kann dies bedeuten, die Organisation wird nicht existent sein ohne das Einsetzen von (stetig neuen) Leadern. Die Mitglieder der Organisation »reagieren […] zunächst emotional« (ebd., S. 19, Hervorh. d. Verf.). In der Arbeit wird selbiger Begriff durch intuitiv ersetzt (in Anlehnung an Baecker 2019a; Abschn. 3.2.2). Zudem wird weiter das Konstrukt Intelligenz in zwei Versionen integriert, die Künstliche und die Web-Intelligenz, so dass die Fähigkeit zur Erneuerung der Organisation gegeben ist.
[29]Merke
Wirtschaftswissenschaften: Die zukünftigen Entwicklungen zeigen in Richtung »Neurocapitalism«, anstelle von Produkt oder Dienstleistung ist ein Gehirn der Marktplatz, die Arena für Wettbewerb (vgl. Meckel 2022).Human- und Sozialwissenschaften: Die Zukunftsvisionen visualisieren jetzt ein »Harz IV-Gehirn« und das »Hirnprekariat«, in dem sich die Frage stellt, wer es sich mittels Technology Enhance (Superhirne) leisten kann, das Gehirn »auf Vordermann zu bringen«? Es zeigt die Bewegung an: Nach dem »Social und Digital Divide« kommt der »Neuro Divide«.Naturwissenschaften: Hier ist plausibel zu erklären, wie es geschafft wird, die gedankengesteuerte Kommunikation – (Brainreading) – zu entwickeln, so dass der futuristische Plan, ›im Kopf reden zu können‹ und den Input, das Denken, im Computer zu erblicken, stimmt.1.3Ziel und Aufbau
Die grundlegenden Überlegungen lassen sich für das Forschungsprojekt zu Neuroleadership in drei Wissenschaftsthemen bündeln:
Oeconomics und Neurosciences: Dieses Verhältnis kann den elementarsten Beitrag für die Forschungen i. S. v. ursprünglichen Effekten im Neuroleadership (Erzielen von Wettbewerbsvorteilen durch Neuroeconomics, -accounting, -finance, -marketing, -entrepreneurship, Consumer Neurosciences u.v.a.; Welpe et al. 2014; Kenning 2020) darstellen.Social- und Neurosciences: Die Idee von »Sollbruchstellen« in diesen Erkenntnissen will die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede re-sozialisieren helfen, indem Beobachtungen der 2. Ordnung (Luhmann 1984) heranziehbar werden.(Natur-)Sciences und Neurosciences: Es sollen die Gebiete Neurobiologie, -mathematik, -informatik und Quantenforschung (siehe Abb. 1.2) instrumentalisiert werden, da »die Forschungsergebnisse der Quantenphysik und der Hirnforschung zu einer radikalen Revision des Begriffs der ›Existenz‹ [führen]« (Roth 2018, S. 217) – im betriebswirtschaftlichen System durch Disruptionen in Unternehmungen, in Branchen und auf Märkten repräsentiert.Das Ziel des Werkes ist die Gestaltung des Neuroleadership, die die Aktionsfelder Leadership, Neurosciences und Systemtheorie bestimmt (Abb. 1.2). Aus den Forschungsergebnissen können die Kern»views« im Neuroleadership Verwendung finden. Diese Differenz und genau die gewählte Unterscheidung ermöglichen es, die Beobachtungen, die Beschreibungen und die Neubeurteilungen von Leadership, wie sie in der Distinction Map (Hans 2018) in Abschn. 5.2.2 dargestellt werden, im Neuroleadership zu »spiegeln«. Das Buch gliedert sich in den theoretischen Teil (Kapitel 2 bis 5) und den anwendungsorientierten Teil (Kapitel 6 und 7), wobei in Kapitel 6 die konzeptionellen Darlegungen und in [30]Kapitel 7 der Ausblick auf weitere Forschungen erfolgen soll. Zudem verfolgt das Werk zwei interdependente Forschungsdimensionen: die theoretische und die praxeologische.4
Abb. 1.2: Formkalkül: Neuroleadership
Zur Zielerreichung wird in Kapitel 3 die moderne Systemtheorie als die Erklärungsvariable herangezogen. Dabei werden die vier technischen, komplexen, autopoietischen und sozialen Systeme erörtert, bis der Paradigmenwechsel die individuen-bezogenen psychischen Systeme vermehrt aufgreift, so dass die Intuitiven, Künstlichen und Web-Intelligenzen (vgl. Baecker 2019a) als entscheidende Elemente in die neuere Systemtheorie eingehen. In Abschnitt 3.2 werden die Trends für Neuro-based Views of Leadership (NBV-L) bemessen. Darauf aufbauend erfolgt in Kapitel 4 die Darstellung etablierter Leadership-Ansätze im Spiegelbild a) der Neurosciences und b) der Systemtheorie. Zuerst sind die Ansätze, die in den Business Economics zu Neuroleadership vorliegen, zu erörtern (Abschn. 4.1). Zudem werden die systemtheoretischen Leadership-Ansätze beleuchtet, die durch die Systems Theory und Business Economics geprägt wurden (Abschn. 4.2), so dass Rückschlüsse für das zu kreierende Modell in diesem Werk möglich sind.
In Kapitel 5 werden die Beratungswissenschaften im Spannungsfeld von Neurosciences und Systemtheorie gewürdigt. Gewöhnlich sind die Modelle der Neuroberatung und des -coachings (Abschn. 5.1) und der Systemberatung wie des -coachings (Abschn. 5.2) vorhanden und zu verwerten. Resümierend findet eine Darstellung beider Seiten statt. Das extrahierende Systemische Neurocoaching liefert den entscheidenden Beitrag für Neuroleadership (Abschn. 5.3).
[31]Die Erkenntnisse des theoretischen Forschungsbemühens fließen in den konzipierenden Ansatz des Neuro-based View of Leadership ein. Vorlagen sind dabei vorherige Publikationen der Verfasserin (Surrey 2018a; 2020). Der View ist im Kapitel 6 dargestellt: Ein Ergebnis zeigt den Neuroleadership-Cube (Abschn. 6.1), in dem Neuroleadership in den sozialen Kontexten wie Intuitiver, Künstlicher und Web-Intelligenz (Abschn. 6.2) kommunizierbar wird (empirische Anschlussfähigkeit dieses Werkes). Ein weiteres Ergebnis besteht in solch unterstützenden Formen wie Neuroberatung und -coaching zur Ausgestaltung von Neuroleadership. Das Kapitel 7 zeigt das Fazit, die »chronische Herausforderung« von Black-Box-Formaten sowie den Ausblick.
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.
2 Mintzberg diskutiert sowohl »The Nature of Managerial Work« (1973) als auch neuerdings das »Engaging Management« (2019) anstelle von »Heroic Leadership«. Das Phänomen fasst Drucker (1996; 2020) am Ende seines Schaffens zusammen als »Management is doing things right; leadership is doing the right things« (siehe ebenfalls Cohen 2009).
3 Plastizität beziffert in den Neurosciences die »Veränderbarkeit in der neuronalen Struktur und Funktion und ist üblicherweise auf Modifikationen in den Signalübertragungseigenschaften von chemischen Synapsen zurückzuführen. Synapsen sind dynamische Strukturen, die ihre Funktion kontinuierlich ändern und den jeweiligen Erfordernissen anpassen. Kurzzeitige Modifikationen in den synaptischen Übertragungseigenschaften im Bereich von einigen Sekunden werden als Kurzzeitplastizität bezeichnet […]« (Luhmann, H. 2020, S. 55).
4 Es wird die Frage erhoben, wie gewinnt die Praxis als solche Erkenntnisse über sich selbst. Mit Klein (2018, S. 9) wird bemerkt »was die Praxis meint, wenn sie sich als Praxis von Theorie abgrenzt. Es gilt das gesprochene Wort«. Und weiter bezogen auf die in Anspruch genommene Systemtheorie: Diese »erlaubt es, mehr zu sehen und vor allem nicht nur ontologisch zu beobachten, sondern ebenso die Epistemologie sozialer Systeme in den Blick zu bekommen. In der Beobachtung der […]. Intervention kann dabei dann nicht nur von dem Was auf das Wie umgeblendet werden, sondern es kommen zusätzlich die Bedingungen der Möglichkeit einer Praxis in den Blick und damit nicht nur der Kontext selbst, sondern zudem dessen Kontingenz und Veränderbarkeit« (ebd., S. 8).
[33]2Forschungsdimensionen: Leadership und Neurosciences
2.1Leadership als Forschungsinteresse
2.1.1Neuroleadership
Neuroscience has a promising future ahead – according to PubMed, the number of published papers with the word brain in the title increased from fewer than 3,000 per year in 1960 to more than 60,000 in 2010. [...] Due to significant findings and important implications from neuroscientific research, the field of neuroleadership has an important current role and hopeful future.
Nordlund et al. 2018





























