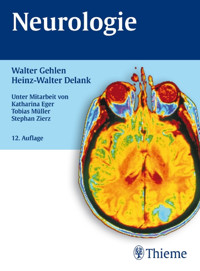
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Thieme
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Aktuell - praxisorientiert - prüfungsrelevant! - Grundlage ist der aktuelle Gegenstandskatalog - Alle prüfungs- und damit studentenrelevanten Inhalte kurz und übersichtlich dargestellt - Merksätze und Tipps sorgen für die unentbehrliche Praxisnähe Inhalt: - Neurologische Untersuchung: Klinisch-neurologische Untersuchung, Zusatzdiagnostik (z.B. EEG, Liquor) - Neurologische Syndrome: Z.B. Rückenmarksyndrome, neuropsychologische Syndrome - Neurologische Erkrankungen - Die Neurologie handlich und dennoch komplett - perfekt für den Einstieg, zum raschen Nachschlagen und zur Prüfungsvorbereitung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 732
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Auf einen Blick
1 Anamnese und neurologische Untersuchung
2 Allgemeine Untersuchung
3 Untersuchung von Kopf und Hirnnerven
4 Untersuchung der Motorik und Reflexe
5 Koordinationsprüfungen
6 Prüfung der Sensibilität
7 Prüfung der vegetativen Funktionen
8 Psychischer und neuropsychologischer Befund
9 Die Untersuchung des bewusstlosen Patienten
10 Technische Hilfsuntersuchungen (Übersicht)
11 Hirntoddiagnostik
12 Syndrome des peripheren Nervensystems
13 Zerebrale Syndrome
14 Rückenmarksyndrome
15 Hirnnervensyndrome
16 Meningeale Syndrome und Hirndrucksyndrome
17 Neuropsychologische Syndrome
18 Zerebrale Durchblutungsstörungen und spontane Blutungen
19 Bewegungsstörungen
20 Demenzen
21 Multiple Sklerose (MS)
22 Vaskulitiden des ZNS
23 Entzündliche Erkrankungen des Nervensystems
24 Tumoren
25 Anfallsleiden
26 Traumatische Schädigungen
27 Metabolische Erkrankungen
28 Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen
29 Liquorzirkulationsstörungen
30 Kopfschmerz, Gesichtsschmerzen und Neuralgien
31 Schwindel (Vertigo)
32 Schlafstörungen und Schlafapnoe-Syndrom
33 Krankheiten des Rückenmarks, der Kauda und der Rückenmarkhüllen
34 Krankheiten und Schäden des peripheren Nervensystems: Polyneuropathien (PNP)
35 Degenerative Motoneuronenerkrankungen mit vorwiegendem Rückenmarkbefall
36 Neuromuskuläre Übertragungsstörungen
37 Myopathien
38 Beteiligung des Nervensystems bei extraneuralen Grundkrankheiten
39 Allgemeine Therapie neurologischer Krankheiten
40 Wichtige Leitsymptome und mögliche neurologische und nichtneurologische Ursachen
Sachverzeichnis
Neurologie
Walter Gehlen Heinz-Walter Delank †
unter Mitarbeit von Katharina Eger Tobias Müller Stephan Zierz
12., vollständig überarbeitete Auflage
214 meist farbige Abbildungen96 Tabellen
Bibliografische Information der
Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Auflage 1978
2. Auflage 1981
3. Auflage 1983
4. Auflage 1985
5. Auflage 1988
6. Auflage 1991
7. Auflage 1994
8. Auflage 1999
9. Auflage 2001
10. Auflage 2004
11. Auflage 2006
1. bulgarische Auflage 1996
© 1978, 2010 Georg Thieme Verlag KG Rüdigerstraße 14, 70469 Stuttgart Unsere Homepage: www.thieme.de
Zeichnungen: W. Irmer †; S. Seifert, Stuttgart; K. Baum, Paphos, Zypern
Umschlaggestaltung: Thieme Verlagsgruppe
eISBN: 978-3-13-167722-8
1 2 3 4 5 6
Wichtiger Hinweis: Wie jede Wissenschaft ist die Medizin ständigen Entwicklungen unterworfen. Forschung und klinische Erfahrung erweitern unsere Erkenntnisse, insbesondere was Behandlung und medikamentöse Therapie anbelangt. Soweit in diesem Werk eine Dosierung oder eine Applikation erwähnt wird, darf der Leser zwar darauf vertrauen, dass Autoren, Herausgeber und Verlag große Sorgfalt darauf verwandt haben, dass diese Angabe demWissensstand bei Fertigstellung des Werkes entspricht.
Für Angaben über Dosierungsanweisungen und Applikationsformen kann vom Verlag jedoch keine Gewähr übernommen werden. Jeder Benutzer ist angehalten, durch sorgfältige Prüfung der Beipackzettel der verwendeten Präparate und gegebenenfalls nach Konsultation eines Spezialisten festzustellen, ob die dort gegebene Empfehlung für Dosierungen oder die Beachtung von Kontraindikationen gegenüber der Angabe in diesem Buch abweicht. Eine solche Prüfung ist besonders wichtig bei selten verwendeten Präparaten oder solchen, die neu auf den Markt gebracht worden sind. Jede Dosierung oder Applikation erfolgt auf eigene Gefahr des Benutzers. Autoren und Verlag appellieren an jeden Benutzer, ihm etwa auffallende Ungenauigkeiten dem Verlag mitzuteilen.
Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Das Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Vorwort
Erneut hat sich gezeigt, dass die Fortschritte in der Neurologie innerhalb kurzer Zeit eine weitere Neuauflage erforderlich machten.
Die Herausgeber der 11. Auflage hatten schon vor längerer Zeit darüber diskutiert, wer zukünftig dieses Lehrbuch mitgestalten könne. Zu unserer großen Freude erklärte sich Herr Prof. Dr. St. Zierz, Ordinarius für Neurologie der Universität in Halle/Saale bereit, bei dieser Auflage mitzuwirken.
Zwischenzeitlich ist im Jahr 2007 Herr Prof. Dr. H.-W. Delank nach langer schwerer Erkrankung verstorben. Sein Tod ist für uns ein großer Verlust.
Wenige Tage vor seinem Tod konnte er zu seiner großen Freude noch an der Habilitationsfeier seines Sohnes teilnehmen, der die venia legendi für das Fach Orthopädie erhielt.
In den letzten Monaten vor seinem Tod hat Prof. Dr. Delank uns seine Ideen für die Fortentwicklung dieses Buches mitgeteilt.
Seine große Bedeutung für die Neurologie in Deutschland und insbesondere auch für dieses Lehrbuch veranlasst uns, wesentliche Bereiche seines Werdeganges aufzuzeigen.
Geboren wurde Prof. Dr. Delank am 23. August 1923 in Crange/Westfalen. Nach dem Abitur, das er in Bochum ablegte, musste er 1942 als Soldat in den 2. Weltkrieg ziehen. Nach kurzer Gefangenschaft begann er das Medizinstudium im Wintersemester 1945/1946. Er studierte an den Universitäten in Bonn, Düsseldorf und später in Marburg, wo er das Studium mit dem Staatsexamen beendete. Nach dem Staatsexamen und der Promotion im Jahre 1951 war er im Rahmen der Weiterbildung an den Kliniken in Mainz und Münster tätig. Für 1 Jahr arbeitete er auch am Ernst-von-Behring-Institut in Marburg.
1956 erhielt er die Facharztanerkennung für Neurologie und Psychiatrie.
1957 wechselte er von der Neurologischen Universitätsklinik in Münster als Oberarzt in die Medizinisch-Neurologische Klinik der Berufsgenossenschaftlichen Krankenanstalten „Bergmannsheil Bochum“, wobei zu dieser Zeit die kurzfristige Schaffung einer Neurologischen Klinik unter seiner Leitung bereits feststand. Die Neurologische Klinik wurde dann 1958 eröffnet.
1971 habilitierte sich Prof. Dr. Delank in Essen. Zu dieser Zeit gab es zwar bereits die Ruhruniversität in Bochum, jedoch noch keine Medizinische Fakultät für den klinischen Bereich.
1977 wurde Prof. Dr. Delank zum außerplanmäßigen Professor ernannt. Im gleichen Jahr wurde die Lehrtätigkeit bezüglich der klinischen Fächer an der Medizinischen Fakultät in Bochum und zwar im Rahmen des Bochumer Modells aufgenommen. Es war seinerzeit keine zentrale Universitätsklinik wie in Aachen neu erbaut worden; stattdessen wurden mehrere Schwerpunktkrankenhäuser in Bochum und Umgebung zu Universitätskliniken ausgebaut.
So entstanden im Laufe der Zeit in Bochum drei Neurologien mit universitären Aufgaben, in den Berufsgenossenschaftlichen Krankenanstalten „Bergmannsheil Bochum“, im St. Josef-Hospital und im Knappschaftskrankenhaus. Dies führte dazu, dass die Studentenzahlen gedrittelt werden konnten, so dass selbst bei 232 Studenten eines Semesters ein Unterricht in kleinen Gruppen, auch am Krankenbett, durchgeführt werden konnte.
Die Unterrichtung der Studenten lag Prof. Dr. Delank besonders am Herzen. Anfangs waren es 50 Studierende der Medizin, die Prof. Dr. Delank zum Semesterabschluss im Sommer häufig in sein Haus bzw. in seinen Garten einlud.
Prof. Dr. Delank war später Gründungsmitglied der Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica, wurde 2002 zum Ehrenmitglied der Gesellschaft für Wirbelsäulenforschung ernannt. Seine klinikbezogenen wissenschaftlichen Tätigkeiten führten zu zahlreichenden Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Zeitschriften. Es entstanden mehrere Aufsehen erregende Monographien, u. a. über das Eiweißbild des Liquor cerebrospinalis im Jahr 1965 sowie im Jahre 1970 der Grundriss der Unfallneurologie.
Schon während seiner Lehrtätigkeit hatte Prof. Dr. Delank ein umfangreiches Vorlesungsmanuskript erarbeitet, das Grundlage der Erstauflage dieses Lehrbuches im Jahre 1978 war und das bis zur 8. Auflage von ihm allein herausgegeben wurde. Weitere Monographien, von denen einige auch in andere Sprachen übersetzt wurden (italienisch, spanisch, bulgarisch), waren vor allem für jüngere Ärzte hilfreich wie z. B. die 1988 erschienene Checkliste Neurologische Notfälle, an deren Erstellung er maßgeblich beteiligt war oder die im gleichen Jahr erschienene Monographie über die Neurologische Therapie.
Prof. Dr. Delank bat stets um Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Korrekturhinweise für sein jetzt in der 12. Auflage erscheinendes Lehrbuch, das inzwischen bei Berücksichtigung aller Auflagen eine Auflagenhöhe von 100 000 deutlich überschritten hat.
Wir werden versuchen, das von Prof. Dr. Delank geschaffene Buch in seinem Sinne fortzuführen.
Wir hoffen, dass auch diese Auflage wie die früheren einen großen Zuspruch erfahren wird.
Falls sich in diese Neuauflage Fehler eingeschlichen haben sollten, würden wir uns über eine Mitteilung freuen. Besonders dankbar wären wir den Lesern auch für Hinweise bezüglich gewünschter Ergänzungen oder Präzisierungen bzw. für Verbesserungsvorschläge.
Unser Dank geht an Frau Dr. Katharina Eger und an Herrn Dr. Tobias Müller, die sachkundig und engagiert an dieser Neuauflage mitgewirkt haben. Ferner danken wir Herrn Prof. Dr. Lothar Heuser (Bochum) für seine Hilfe bei der Aktualisierung des Neuroradiologiebereiches und Herrn Prof. Dr. Pasquale Calabrese für die Unterstützung bei der Aktualisierung des Neuropsychologiebereichs sowie Herrn Dr. Ulrich Liebetrau (Köln-Merheim) für seine wertvollen Vorschläge zur Liquordiagnostik.
Aber auch den Mitarbeitern des Thieme Verlages und hier insbesondere Frau Sabine Bartl und Frau Sigrun Rückert sowie Herrn Dr. Jochen Neuberger sei für ihre intensive und hilfreiche Betreuung bei der z. T. erheblichen Umstrukturierung dieses Lehrbuches herzlich gedankt.
Sommer 2010
Walter Gehlen
Heinz-Walter Delank (1923–2007)
Inhalt
TEIL I Neurologische Untersuchung
1 Anamnese und neurologische Untersuchung
Walter Gehlen
2 Allgemeine Untersuchung
Walter Gehlen
3 Untersuchung von Kopf und Hirnnerven
Walter Gehlen
3.1 Untersuchung des Kopfes
3.2 Untersuchung der Hirnnerven
3.2.1 N. olfactorius (I)
3.2.2 N. opticus (II)
3.2.3 N. oculomotorius (III), N. trochlearis (IV), N. abducens (VI)
3.2.4 N. trigeminus (V)
3.2.5 N. facialis (VII)
3.2.6 N. vestibulocochlearis (VIII)
3.2.7 N. glossopharyngeus (IX), N. vagus (X)
3.2.8 N. accessorius (XI)
3.2.9 N. hypoglossus (XII)
4 Untersuchung der Motorik und Reflexe
Walter Gehlen
4.1 Aufbau und Funktion des motorischen Systems
4.1.1 Peripher-motorisches System
4.1.2 Zentral-motorisches System
4.2 Inspektion des Bewegungsapparates
4.2.1 Trophik
4.2.2 Spontane Muskelbewegungen
4.3 Prüfung des Muskeltonus
4.3.1 Spastik
4.3.2 Rigor
4.4 Prüfung der Muskelkraft
4.5 Reflexprüfung
4.5.1 Reflextypen
4.5.2 Eigenreflexe
4.5.3 Fremdreflexe
4.5.4 Übersicht: Kennzeichen peripherer und zentraler Paresen
5 Koordinationsprüfungen
Walter Gehlen
6 Prüfung der Sensibilität
Walter Gehlen
6.1 Aufbau und Funktion des sensiblen Systems
6.2 Spontane sensible Reizzustände
6.2.1 Parästhesien und Dysästhesien
6.2.2 Schmerzformen
6.2.3 Schmerzsyndrome
6.3 Prüfung einzelner sensibler Qualitäten
6.4 Spezielle Befunde
7 Prüfung der vegetativen Funktionen
Walter Gehlen
7.1 Anatomie und Funktion des vegetativen Nervensystems
7.2 Orientierende vegetative Funktionsprüfungen
7.3 Spezielle vegetative Funktionsprüfungen
8 Psychischer und neuropsychologischer Befund
Walter Gehlen
8.1 Einleitung
8.2 Psychischer Befund
8.3 Neuropsychologischer Befund
8.3.1 Kognitive Fähigkeiten, die für den neuropsychologischen Befund zu testen sind
8.3.2 Neuropsychologische Testverfahren
9 Die Untersuchung des bewusstlosen Patienten
Walter Gehlen
9.1 Einteilung der Bewusstseinsstörungen
9.2 Ursachen und Diagnostik von Bewusstseinsstörungen
9.3 Differenzialdiagnose der Bewusstseinsstörung
9.3.1 Apallisches Syndrom (Coma vigile, „Wachkoma“, persistierender vegetativer Zustand)
9.3.2 „Locked-in“-Syndrom
9.3.3 Akinetischer Mutismus
10 Technische Hilfsuntersuchungen (Übersicht)
Walter Gehlen
10.1 Elektroenzephalografie (EEG) und Brain-Mapping
10.1.1 Elektroenzephalografie
10.1.2 Brain-Mapping
10.2 Elektromyografie (EMG) und Elektroneurografie (ENG)
10.2.1 Elektromyografie
10.2.2 Elektroneurografie
10.3 Evozierte Potenziale
10.4 Liquoruntersuchung und pathologische Befunde
10.4.1 Liquoruntersuchung
10.4.2 Pathologische Liquorbefunde
10.5 Biopsien
10.6 Neuroradiologische Untersuchungen
10.6.1 Nativaufnahmen des Schädels und der Wirbelsäule
10.6.2 Computertomografie (CT)
10.6.3 Kernspintomografie
10.6.4 Angiografie
10.6.5 Myelografie
10.6.6 Positronenemissionstomografie (PET und PET-CT)
10.6.7 Single-Photon-Emissions-Computer-Tomografie (SPECT)
10.6.8 Andere Verfahren
10.7 Neurosonografie
10.7.1 Doppler-Ultraschall-Sonografie (Ultraschall-Dopplersonografie, USD)
10.7.2 Duplexsonografie
10.8 Molekulargenetische Diagnostik (Gendiagnostik)
11 Hirntoddiagnostik
Walter Gehlen
TEIL II Neurologische Syndrome
12 Syndrome des peripheren Nervensystems
Walter Gehlen
12.1 Syndrome der peripheren Nervenläsion
12.1.1 Ursachen, allgemeine Symptomatik, Schweregrade und Therapie
12.1.2 Reizerscheinungen bei peripheren Nervenläsionen
12.1.3 Complex regional pain syndrome (CRPS) Typ I und II
12.1.4 Spezielle Symptomatik der wichtigsten Nervenläsionen
12.1.5 Wichtige Nervenkompressionssyndrome
12.2 Syndrome der Plexusläsionen
12.2.1 Allgemeine Charakteristika der Plexussyndrome
12.2.2 Topische Einteilung der Plexusläsionen
12.2.3 Ätiopathogenese der Arm- und Halsplexusläsionen
12.2.4 Ätiopathogenese der Beinplexusläsionen
12.3 Syndrome der Nervenwurzeln
12.3.1 Allgemeine Charakteristika der Nervenwurzelsyndrome
12.3.2 Spezielle Wurzelsyndrome
12.3.3 Ätiopathogenese der Wurzelsyndrome
12.3.4 Therapie der Wurzelerkrankungen
12.4 Polyneuropathische Syndrome
12.4.1 Ätiologisch orientierte Einteilung
12.4.2 Syndromal orientierte Einteilung
12.5 Grenzstrangsyndrome
12.5.1 Aufbau des Grenzstrangs
12.5.2 Oberes Grenzstrangsyndrom
12.5.3 Unteres (lumbales) Grenzstrangsyndrom
12.6 Vertebragene Syndrome
12.6.1 Allgemeines
12.6.2 Halswirbelsäulensyndrom
12.6.3 Brustwirbelsäulensyndrom
12.6.4 Lendenwirbelsäulensyndrom
13 Zerebrale Syndrome
Walter Gehlen
13.1 Zerebrale Allgemeinsymptome
13.1.1 Psychopathologische Symptome und Syndrome
13.1.2 Symptome der Hirndrucksteigerung
13.1.3 Zerebrale Anfälle
13.2 Hirnlokale Syndrome
13.2.1 Allgemeines
13.2.2 Großhirnsyndrome
13.2.3 Hirnstammsyndrome
13.2.4 Extrapyramidale Syndrome
13.2.5 Kleinhirnsyndrome
14 Rückenmarksyndrome
Walter Gehlen
14.1 Neuroanatomische Grundlagen
14.1.2 Aufsteigende Rückenmarkbahnen
14.2 Typen der Rückenmarksyndrome
14.2.1 Syndrom der (totalen) Querschnittlähmung
14.2.2 Halbseitensyndrom des Rückenmarks (Brown-Séquard)
14.2.3 Zentrales Rückenmarksyndrom und Arteria-spinalis-anterior-Syndrom
14.2.4 Hinterstrangsyndrom
14.2.5 Hinterhornsyndrom
14.2.6 Vorderhornsyndrom
15 Hirnnervensyndrome
Walter Gehlen
15.1 Allgemeines
15.2 Klinisch bedeutsame Hirnnervensyndrome
15.2.1 Syndrom der Olfaktoriusrinne
15.2.2 Syndrom des Keilbeinflügels
15.2.3 Syndrom der Orbitaspitze
15.2.4 Foster-Kennedy-Syndrom
15.2.5 Sinus-cavernosus-Syndrom
15.2.6 Syndrome im Schädelbasisbereich
16 Meningeale Syndrome und Hirndrucksyndrome
Walter Gehlen
16.1 Meningeale Syndrome
16.1.1 Akute meningeale Syndrome
16.1.2 Chronische meningeale Syndrome
16.2 Hirndrucksyndrome
16.2.1 Klinische Symptome der Hirndrucksteigerung
16.2.2 Pseudotumor cerebri
17 Neuropsychologische Syndrome
Walter Gehlen
17.1 Gedächtnisstörungen
17.2 Aphasien
17.2.1 Haupt-Aphasieformen
17.2.2 Seltenere Aphasieformen
17.3 Apraxie
17.4 Agnosie und Missidentifikationssyndrome
TEIL III Neurologische Erkrankungen
18 Zerebrale Durchblutungsstörungen und spontane Blutungen
Tobias Müller und Stephan Zierz
18.1 Anatomische Grundlagen der zerebralen Blutversorgung
18.2 Pathophysiologische Grundlagen zerebraler Durchblutungsstörungen
18.3 Ätiologie zerebraler Durchblutungsstörungen
18.3.1 Kardiale Embolie
18.3.2 Arterioarterielle Embolie
18.3.3 Hämodynamische Infarkte
18.3.4 Gefäßverschlüsse bei arterieller Dissektion
18.3.5 Entzündlich bedingte Gefäßverschlüsse
18.3.6 Gerinnungsstörungen
18.3.7 Andere Ursachen zerebraler Durchblutungsstörungen
18.4 Zerebrale Gefäßsyndrome
18.4.1 Arteria-carotis-interna-Syndrom
18.4.2 Arteria-cerebri-media-Syndrom
18.4.3 Arteria-choroidea-anterior-Syndrom
18.4.4 Arteria-cerebri-posterior-Syndrom
18.4.5 Arteria-cerebri-anterior-Syndrom
18.4.6 Vertebrobasiläre Syndrome
18.4.7 Doppelseitiger vollständiger Hirnstamminfarkt
18.4.8 Medulla-oblongata-Infarkt
18.4.9 Ponsinfarkt
18.4.10 Kleinhirninfarkte
18.4.11 Mittelhirninfarkt
18.5 Extrakranielle Hirngefäßsyndrome
18.5.1 Allgemeines
18.5.2 Extrakranielle „Steal-Syndrome“
18.6 Zeitliche Einteilung akuter zerebraler Ischämien
18.6.1 Transitorische ischämische Attacken (TIA)
18.6.2 Hirninfarkt
18.6.3 Vaskuläre Enzephalopathie und vaskuläre Demenz
18.7 Diagnostik und Differenzialdiagnostik zerebraler Ischämien
18.7.1 Differenzialdiagnosen der zerebralen Ischämie
18.8 Therapie zerebraler Durchblutungsstörungen
18.8.1 Behandlung in der Akutphase
18.8.2 Behandlung in der postakuten Phase und Sekundärprophylaxe
18.8.3 Behandlung der chronischen zerebralen Durchblutungsstörungen
19 Bewegungsstörungen
Walter Gehlen
19.1 Morbus Parkinson und Parkinson-Syndrom
19.1.1 Definition und Differenzialdiagnose des Parkinson-Syndroms
19.1.2 Klinische Symptomatik des Parkinson-Syndroms
19.1.3 Klinische Einteilung der Krankheitsbilder mit Parkinson-Syndrom
19.1.4 Diagnostik des Parkinson-Syndroms
19.1.5 Therapie des Parkinson-Syndroms
19.2 Chorea
19.2.1 Chorea Huntington (Chorea major, „Veitstanz“)
19.2.2 Chorea minor
19.2.3 Weitere choreatische Bewegungsstörungen
19.3 Athetosen
19.4 Ballismus und Hemiballismus
19.5 Dystone Syndrome
19.6 Dyskinesien
19.6.1 Akutdyskinesien
19.6.2 Tardive Dyskinesien
19.6.3 Akathisie
19.7 Tic-Krankheiten
19.8 Systematrophien des spinopontozerebellären Systems
19.8.1 Multisystematrophien (MSA)
19.8.2 Sporadische Spätatrophie der Kleinhirnrinde (Atrophie cérébelleuse tardive)
19.8.3 Ataxien
19.9 Restless-Legs-Syndrom (RLS) und periodische Beinbewegungen im Schlaf (Periodic Limb Movement Disorder, PLMS)
20 Demenzen
Walter Gehlen
20.1 Demenzen bei degenerativen und anderen Hirnerkrankungen
20.2 Leitsymptom Demenz und diagnostisches Vorgehen
20.2.1 Allgemeine Definition des demenziellen Syndroms
20.2.2 Diagnostisches Vorgehen
20.3 Demenz vom Alzheimer-Typ (DAT, Alzheimer-Krankheit, AD)
20.4 Weitere Demenzen
20.4.1 Hirnatrophien vaskulärer Genese
20.4.2 Demenz vom Lewy-Körperchen-Typ
20.4.3 Frontotemporale Demenz (Morbus Pick)
20.4.4 Demenzielles Syndrom beim Hydrocephalus aresorptivus (communicans)
20.4.5 Demenz bei HIV-Infektion
21 Multiple Sklerose (MS)
Walter Gehlen
21.1 Ätiologie und Pathogenese
21.1.1 Autoimmunhypothese
21.1.2 Genetische Faktoren
21.1.3 Pathologisch-anatomische Befunde
21.2 Symptomatik
21.3 Verlaufsformen der MS
21.4 Sonderformen der MS
21.5 Diagnostik
21.6 Therapie
22 Vaskulitiden des ZNS
Walter Gehlen
22.1 Allgemeines
22.2 Einzelne Erkrankungen
23 Entzündliche Erkrankungen des Nervensystems
Walter Gehlen
23.1 Meningitiden
23.1.1 Übersicht
23.1.2 Akute eitrige Meningitiden (bakterielle Meningitiden)
23.1.3 Tuberkulöse Meningitis (Neurotuberkulose)
23.2 Embolische Herdenzephalitis
23.3 Hirnabszess
23.4 Borreliose (Neuroborreliose)
23.5 Neurolues (Neurosyphilis)
23.5.1 Klinische Symptomatik der Neurolues
23.5.2 Serodiagnostik und „luisches Liquorsyndrom“
23.5.3 Therapie der Neurolues
23.6 Virale Meningoenzephalitiden
23.6.1 Primäre virale Meningoenzephalitiden
23.6.2 Weitere virale Enzephalitiden
23.6.3 Sekundäre (para-, postinfektiöse und postvakzinale) Meningoenzephalitiden
23.7 Neurologische Erkrankungen bei HIV-Infektion
23.8 Prionenerkrankungen
23.9 Seröse Meningoenzephalitiden durch Pilze, Protozoen und Parasiten
23.10 Nichtinfektiöse Meningitiden und Enzephalitiden
24 Tumoren
Walter Gehlen
24.1 Allgemeines
24.1.1 Ursachen intrakranieller Raumforderungen
24.1.2 Klassifizierung von Hirntumoren
24.1.3 Allgemeine klinische Symptomatik von Hirntumoren
24.1.4 Spezielle klinische Symptomatik von Hirntumoren
24.1.5 Diagnostik von Hirntumoren
24.2 Neuroepitheliale Tumoren
24.2.1 Astrozytome
24.2.2 Oligodendrogliome
24.2.3 Pinealistumoren
24.2.4 Medulloblastome
24.3 Akustikusneurinome
24.4 Tumoren der Meningen
24.5 Tumoren der Sella
24.5.1 Kraniopharyngeome
24.5.2 Hypophysenadenome
24.6 Metastasen
24.7 Raumfordernde intraspinale Prozesse
24.7.1 Allgemeines
24.7.2 Spinale Tumoren
25 Anfallsleiden
Walter Gehlen
25.1 Ätiopathogenese epileptischer Störungen
25.2 Einteilung der Epilepsien
25.3 Klinische Erscheinungsbilder einzelner Anfallstypen
25.3.1 Generalisierte Anfälle
25.3.2 Fokale Anfälle (parzielle, lokale Anfälle)
25.4 Psychische Veränderungen bei Anfallsleiden
25.4.1 Chronische Wesensänderungen
25.4.2 Verstimmungen
25.4.3 Dämmerzustände
25.4.4 Epileptische Psychosen
25.5 Diagnostische Leitlinien bei Anfallsleiden
25.6 Therapie bei Anfallsleiden
25.7 Nichtepileptische Anfälle
25.7.1 Synkopale Anfälle
25.7.2 Stoffwechselbedingte, nicht primär epileptische Anfälle
25.7.3 Psychogene dissoziative Anfälle
26 Traumatische Schädigungen
Walter Gehlen
26.1 Schädelfrakturen
26.1.1 Kalottenfrakturen
26.1.2 Schädelbasisfrakturen
26.1.3 Gesichtsschädelfrakturen
26.1.4 Mittelgesichtsfrakturen
26.2 Hirnverletzungen
26.2.1 Einteilung
26.2.2 Commotio cerebri
26.2.3 Contusio cerebri
26.2.4 Compressio cerebri
26.2.5 Häufige Ursachen einer (posttraumatischen) Hirndrucksteigerung)
26.2.6 Offene und penetrierende Hirnverletzungen (Schussverletzungen)
26.3 Spätschäden nach traumatischen Hirnläsionen
26.3.1 Irreversible Defektzustände
26.3.2 Spätkomplikationen
26.4 Rehabilitation von Patienten nach Hirnverletzungen
26.4.1 Rehabilitation bei neurologischen Defektsyndromen
26.4.2 Rehabilitation bei psychischen Defektsyndromen
26.4.3 Rehabilitation bei epileptischen Anfällen nach Schädel-Hirn-Traumen
26.5 Rückenmarkverletzungen
26.5.1 Pathogenese
26.5.2 Einteilung
26.5.3 Beschleunigungstrauma der Halswirbelsäule
26.6 Elektrotrauma des Nervensystems
26.6.1 Direkte Schäden
26.6.2 Sekundäre Schäden
27 Metabolische Erkrankungen
Walter Gehlen
27.1 Lipoidosen
27.1.1 Morbus Fabry
27.1.2 Metachromatische Leukodystrophie
27.1.3 Tay-Sachs-Krankheit (Amaurotische Idiotie)
27.1.4 Heredopathia atactica polyneuritiformis (Morbus Refsum)
27.1.5 Morbus Niemann-Pick
27.1.6 Morbus Gaucher
27.1.7 Weitere Lipoidosen
27.2 Störungen des Aminosäurestoffwechsels
27.2.1 Phenylketonurie (Fölling-Krankheit)
27.2.2 Ahorn-Sirup-Krankheit
27.2.3 Hartnup-Syndrom
27.3 Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels
27.4 Störungen des Kupferstoffwechsels
28 Fehlbildungen und Entwicklungsstörungen
Katharina Eger und Stephan Zierz
28.1 Konnatale Hirnschädigungen
28.2 Fehlbildungen des knöchernen Schädels und des Gehirns
28.3 Fehlbildungen des kraniozervikalen Übergangs
28.4 Fehlbildungen des Rückenmarks und der Wirbelsäule
28.4.1 Dysrhaphische Fehlbildungen
28.4.2 Syringomyelie
28.4.3 Konnatale Wirbelsäulenveränderungen
28.5 Phakomatosen
28.5.1 Neurofibromatose (NF)
28.5.2 Tuberöse Sklerose (Morbus Bourneville-Pringle)
28.5.3 Enzephalotrigeminale (enzephalofaziale) Angiomatose (Morbus Sturge-Weber)
28.5.4 Retinozerebellare Angiomatose (Morbus von Hippel-Lindau)
28.5.5 Weitere neurokutane Syndrome
28.5.6 Zur Therapie der Phakomatosen
29 Liquorzirkulationsstörungen
Walter Gehlen
29.1 Pseudotumor cerebri (idiopathische intrakranielle Hypertension)
29.2 Normaldruckhydrozephalus (normal pressure hydrozephalus; NPH)
29.3 Liquorunterdrucksyndrom (Syndrom der zerebralen Liquorhypovolämie)
30 Kopfschmerz, Gesichtsschmerzen und Neuralgien
Walter Gehlen
30.1 Allgemeines
30.2 Anfallsartige Kopfschmerzen
30.2.1 Migräne
30.2.2 Trigeminoautonome Kopfschmerzen
30.2.3 Arteriitis temporalis (cranialis)
30.2.4 Kopfschmerzen bei Bluthochdruckkrisen
30.2.5 Gesichtsneuralgien
30.3 Diffuse Dauerkopfschmerzen
30.3.1 Diffuse Dauerkopfschmerzen mit plötzlichem Beginn
30.3.2 Diffuse Dauerkopfschmerzen mit schleichendem Beginn
30.4 Lokalisierte Dauerkopfschmerzen
31 Schwindel (Vertigo)
Walter Gehlen
31.1 Schwindelqualitäten
31.1.1 Peripher vestibulärer Schwindel
31.1.2 Zentral vestibulärer Schwindel
31.1.3 Nichtvestibulärer Schwindel
31.2 Differenzialdiagnose vestibulärer/nichtvestibulärer Schwindel
31.3 Differenzialdiagnose peripher vestibulärer/zentral vestibulärer Schwindel
32 Schlafstörungen und Schlafapnoe-Syndrom
Walter Gehlen
32.1 Klassifikation, Diagnostik und Therapie von Schlafstörungen
32.2 Schlafapnoe-Syndrome
32.3 Narkolepsie
33 Krankheiten des Rückenmarks, der Kauda und der Rückenmarkhüllen
Katharina Eger und Stephan Zierz
33.1 Entzündliche Rückenmarkerkrankungen und Entmarkungskrankheiten
33.1.1 Spinaler Abszess
33.1.2 Spondylitis und Spondylodiszitis
33.1.3 Querschnittmyelitis
33.1.4 Neuromyelitis optica (NMO)
33.1.5 Myelitis necroticans
33.1.6 Poliomyelitis acuta anterior (spinale Kinderlähmung)
33.1.7 Post-Polio-Syndrom (PPS)
33.1.8 Tetanus
33.2 Gefäßkrankheiten des Rückenmarks
33.2.1 Allgemeines
33.2.2 Arteria-spinalis-anterior-Syndrom
33.2.3 Arteria-spinalis-posterior-Syndrom
33.3 Spinale Gefäßfehlbildungen
33.3.1 Arteriovenöse Duralfistel
33.3.2 Spinale arteriovenöse Angiome
33.3.3 Kavernöse Angiome (Kavernome)
33.4 Diagnostik spinaler vaskulärer Prozesse
33.5 Therapie spinaler vaskulärer Prozesse
33.6 Synopsis der wichtigsten Rückenmarkerkrankungen
34 Krankheiten und Schäden des peripheren Nervensystems: Polyneuropathien (PNP)
Walter Gehlen
34.1 Allgemeines
34.2 Metabolisch bedingte Polyneuropathien
34.2.1 Diabetische Polyneuropathie (PNP)
34.2.2 Polyneuropathie bei Porphyrie
34.2.3 Weitere metabolisch bedingte Polyneuropathien
34.3 Exogen-toxisch bedingte Polyneuropathien
34.3.1 Alkohol-Polyneuropathie
34.3.2 Medikamentös-toxische Polyneuropathien
34.3.3 Weitere neurotoxische Substanzen, die eine Polyneuropathie verursachen können
34.4 Polyneuropathie bei Kollagenosen
34.5 Entzündlich bedingte Polyneuropathien
34.5.1 Idiopathische entzündliche Polyneuritis (Polyradikuloneuritis oder Guillain-Barré-Syndrom, GBS; akute inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie, AIDP)
34.5.2 Chronisch inflammatorische demyelinisierende Polyradikuloneuropathie (CIDP)
34.5.3 Infektiös-toxische Polyneuritiden
34.5.4 Parainfektiöse Polyneuritiden
34.6 Weitere seltene Polyneuropathien
34.6.1 Serogenetische Polyneuritis
34.6.2 Multifokal motorische Neuropathie (MMN)
34.6.3 Critical-Illness-Neuropathie
34.7 Hereditäre motorische und sensible Neuropathien (HMSN)
34.7.1 HMSN-Typ I und II
34.7.2 HMSN-Typ III und IV
34.7.3 HMSN-Typ V, VI, VII
34.7.4 Primäre hereditäre Amyloidose
35 Degenerative Motoneuronenerkrankungen mit vorwiegendem Rückenmarkbefall
Walter Gehlen
35.1 Spastische Spinalparalyse (SSP)
35.2 Spinale Muskelatrophien (SMA)
35.3 Amyotrophische Lateralsklerose (ALS)
35.4 Spinozerebelläre Heredoataxie (Friedreich)
36 Neuromuskuläre Übertragungsstörungen
Walter Gehlen
36.1 Myasthenien
36.1.1 Myasthenia gravis pseudoparalytica (Erb-Goldflam)
36.1.2 Symptomatische Myasthenien
36.2 Lambert-Eaton-Syndrom (LES)
36.3 Weitere neuromuskuläre Übertragungsstörungen
37 Myopathien
Walter Gehlen
37.1 Einführung
37.1.1 Einteilung
37.1.2 Allgemeine Kennzeichen
37.1.3 Allgemeines diagnostisches Vorgehen
37.2 Progressive Muskeldystrophien
37.3 Kongenitale Myopathien
37.4 Myotonien
37.4.1 Einführung und Symptomatik
37.4.2 Differenzialdiagnose der Myotonien
37.4.3 Einzelne Myotonieformen
37.5 Myopathien bei Stoffwechselerkrankungen
37.5.1 Familiäre periodische Lähmungen
37.5.2 Myopathien bei Glykogenosen, Lipid- und Purinstoffwechselstörungen
37.6 Mitochondriale Myopathien
37.7 Entzündliche Myopathien (Myositiden)
37.7.1 Polymyositis, Dermatomyositis und Einschlusskörpermyositis
37.8 Weitere Myopathien
37.8.1 Myopathien bei endokrinen Störungen
37.8.2 Exotoxische Myopathien
37.9 Nekrotisierende Myopathien und Rhabdomyolyse
37.10 Maligne Hyperthermie
37.11 Hereditäre neuromuskuläre Erkrankungen (Übersicht)
38 Beteiligung des Nervensystems bei extraneuralen Grundkrankheiten
Walter Gehlen
38.1 Beteiligung des Nervensystems bei Herz-Kreislauf-, Gefäß- und Lungenerkrankungen
38.1.1 Herz- und Kreislauferkrankungen
38.1.2 Gefäßerkrankungen
38.1.3 Beteiligung des Nervensystems bei respiratorischer Insuffizienz
38.2 Beteiligung des Nervensystems bei Erkrankungen der Leber, des Pankreas und des Magen-Darm-Traktes
38.2.1 Enzephalopathien und Myelopathien bei Lebererkrankungen
38.2.2 Pankreatische Enzephalopathie
38.2.3 Enterogene Mangelsyndrome
38.3 Beteiligung des Nervensystems bei Erkrankungen der Niere
38.3.1 Akutes Nierenversagen und chronische Niereninsuffizienz
38.3.2 Progressive Dialyse-Enzephalopathie
38.3.3 Dysäquilibrium-Syndrom bei Hämodialysen
38.4 Beteiligung des Nervensystems bei Endokrinopathien und Stoffwechselkrankheiten
38.4.1 Diabetes mellitus
38.4.2 Hypoparathyreoidismus
38.4.3 Erkrankungen der Schilddrüse
38.4.4 Erkrankungen der Nebennierenrinde
38.5 Beteiligung des Nervensystems bei Blutkrankheiten und immunologischen Erkrankungen
38.5.1 Blutkrankheiten
38.5.2 Immunologische Erkrankungen
38.6 Beteiligung des Nervensystems bei Malignomen (paraneoplastische Syndrome, PNS)
38.6.1 Paraneoplastische Enzephalopathien
38.6.2 Paraneoplastische Myelopathien
38.6.3 Paraneoplastische Polyneuropathien
38.6.4 Paraneoplastische Myopathien
38.7 Beteiligung des Nervensystems bei exogenen Intoxikationen
39 Allgemeine Therapie neurologischer Krankheiten
Walter Gehlen
39.1 Intensivbehandlung
39.2 Schmerztherapie
39.2.1 Medikamentöse Therapie
39.2.2 Neurochirurgische Eingriffe
39.2.3 Aktivierung körpereigener Schmerzhemmsysteme
39.3 Aufgaben und Wege der Rehabilitation
39.4 Therapie häufiger neurologischer Störungen
39.4.1 Therapie von Paresen
39.4.2 Behandlung extrapyramidaler Störungen
40 Wichtige Leitsymptome und mögliche neurologische und nichtneurologische Ursachen
Walter Gehlen
Sachverzeichnis
Anschriften
Prof. Dr. med. Walter Gehlen
ehem. Direktor der Neurologischen
Universitätsklinik
Knappschaftskrankenhaus
In der Schornau 23/25
44892 Bochum
Korrespondenz:
Eichenweg 3
58452 Witten
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Heinz-Walter Delank †
ehem. Direktor der Neurologischen
Universitätsklinik
Berufsgenossenschaftliche Krankenanstalten
„Bergmannsheil“ Bochum
44789 Bochum
Dr. med. Katharina Eger
Praxis für Neurologie
Ludwig-Wucherer-Str. 10
06108 Halle (Saale)
E-Mail: [email protected]
Dr. med. Tobias Müller
E-Mail: [email protected]
Prof. Dr. med. Stephan Zierz
(Universitätsdirektor)
E-Mail: [email protected]
Beide:
Neurologische Universitäts- und Poliklinik
der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg
Ernst-Grube-Str. 40
06097 Halle (Saale)
TEIL I
Neurologische Untersuchung
1 Anamnese und neurologische Untersuchung
Anamnese. Am Anfang jeder neurologischen Untersuchung steht eine ausführliche Anamnese. Sie ist mit besonderer Sorgfalt zu erheben, denn in kaum einem anderen Fach der Medizin hat die Krankheitsvorgeschichte für die Diagnostik einen so eminenten Stellenwert wie in der Neurologie. Die Anamneseerhebung sollte an einem ruhigen Ort durchgeführt werden, der die erforderliche private Atmosphäre und Diskretion gewährleistet. Zu Beginn der Anamneseerhebung benötigt der Patient ausreichend Gelegenheit, seine Beschwerden, Probleme und den Anlass der Konsultation ausführlich zu schildern. Man eröffnet dazu das Gespräch mit einer möglichst allgemein gefassten Frage, etwa: „Was führt Sie zu mir?“ Schon diese ersten Ausführungen des Patienten, die nicht durch Zwischenfragen unterbrochen werden, geben dem geduldig und aufmerksam zuhörenden Arzt sowohl Gelegenheit, die vordergründigen Beschwerden kennen zu lernen als auch die Möglichkeit, einen ersten Eindruck von der Persönlichkeitsstruktur des Patienten zu gewinnen. Erst allmählich steuert dann der Untersucher das weitere Gespräch mit immer gezielteren Fragen, um alle wesentlichen Daten zu Entwicklung und Art des gesamten Beschwerdekomplexes, zu evtl. Vorerkrankungen sowie zur persönlichen, beruflichen, familiären und wirtschaftlichen Biografie zu erfassen.
Eine solchermaßen sorgfältig erarbeitete Eigenanamnese ist dem ganzen bisherigen Lebensweg des Patienten nachgegangen, hat alle möglicherweise relevanten Ereignisse festgehalten und endlich die aktuellen Beschwerden bezüglich ihres Erscheinungsbildes, ihres zeitlichen Auftretens, ihres Verlaufscharakters (attackenartig? schubförmig? chronisch? chronisch-progredient?) und ihrer Abhängigkeiten aufgezeichnet. Sie sollte zudem folgendes umfassen:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























