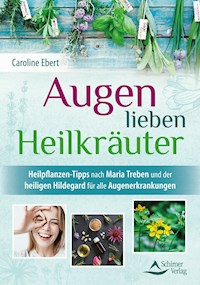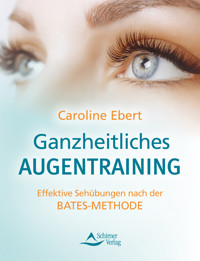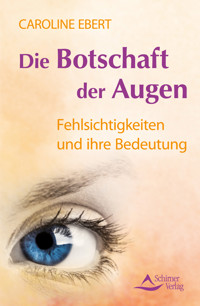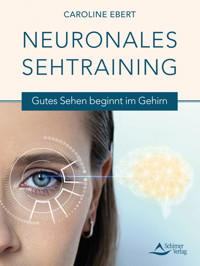
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Schirner Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Unsere Augen sind die Fenster zur Welt. Doch 80 % des Sehvorgangs findet im Gehirn statt. Farben, Formen, Kontraste, Tiefen, Bewegungen … – durch das Zusammenspiel von Abermillionen Neuronen interpretiert unser Gehirn diese Informationen und verknüpft sie mit anderen Sinneseindrücken. Auf diese Weise erhalten wir in Sekundenbruchteilen ein vollständiges, lebendiges Bild von unserer Umgebung. Deshalb ist ein tiefgreifendes Sehtraining auch Hirntraining! Caroline Ebert, Optikermeisterin und erfahrene Sehtrainerin mit eigener Augenschule, zeigt, wie wir mit einfachen, aber wirkungsvollen neuronalen Übungen unser gesamtes visuelles System stärken. Mit der innovativen Methode können wir nicht nur Fehlsichtigkeiten wie Kurz-, (Alters-)Weitsichtigkeit, Hornhautverkrümmung oder Schielen korrigieren, sondern auch Augenerkrankungen wie Makuladegeneration oder grauem Star entgegenwirken. Durch die Integration frühkindlicher Reflexe lösen wir zudem Blockaden auf, die unsere Sehkraft einschränken. So effektiv war Sehtraining noch nie!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Ratschläge in diesem Buch sind sorgfältig erwogen und geprüft. Sie bieten jedoch keinen Ersatz für kompetenten medizinischen Rat, sondern dienen der Begleitung und der Anregung der Selbstheilungskräfte. Alle Angaben in diesem Buch erfolgen daher ohne Gewährleistung oder Garantie seitens der Autorin oder des Verlages. Eine Haftung der Autorin bzw. des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
ISBN Printausgabe 978-3-8434-1559-0
ISBN E-Book 978-3-8434-6539-7
Caroline Ebert: Neuronales Sehtraining Gutes Sehen beginnt im Gehirn © 2024 Schirner Verlag GmbH & Co. KG, Birkenweg 14a, 64295 Darmstadt E-Mail: [email protected]
Umschlag: Hülya Sözer & Anna Twele, Schirner, unter Verwendung von # 2348550837 (© Pavlova Yuliia) und # 1181365240 (© bannosuke), www.shutterstock.com
Print-Layout: Anna Twele, Schirner
Lektorat: Claudia Simon & Bastian Rittinghaus, Schirner
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt, Germany
www.schirner.com
1. E-Book-Auflage Januar 2025
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Funk, Fernsehen und sonstige Kommunikationsmittel, fotomechanische oder vertonte Wiedergabe sowie des auszugsweisen Nachdrucks vorbehalten
INHALT
Vorwort
Einführung
Vom Auge zum Gehirn – ein Überblick
Was ist neuronales Sehtraining?
Entspannung für die Augen
Neuronen in Aktion – der Sehprozess
Sehen ist Nervensache
Teamwork im Gehirn
Das Was und das Wo – die Pfade der visuellen Verarbeitung
Spezielle visuelle Verarbeitungsmechanismen
Ohne sieht man besser: frühkindliche Reflexe
Jetzt wird’s bunt – Sehtraining mit Formen und Farben
Formen
Farben
Anleitung für das Training mit Formen und Farben
Richtungswahrnehmung
Kontrastsehen
Augen in Bewegung
Sakkaden
Locker aus der Hand
Schärfe und Tiefe im Blick
Akkommodation
Fusion
Aus dem Augenwinkel
Alles im Lot – Balance und Bildstabilität
Das Gleichgewicht und das Sehen
Der Nacken und das Sehen
Die Zunge und das Sehen
Mit allen Sinnen sehen
Der Geruchssinn und das Sehen
Der Geschmackssinn und das Sehen
Der Hörsinn und das Sehen
Der Tastsinn und das Sehen
Nachwort
Über die Autorin
Übungsverzeichnis
Bildnachweis
VORWORT
Seit über 25 Jahren beschäftige ich mich nun schon mit den Augen, zunächst als Optikerin, dann als Augenoptikermeisterin und seit 2012 als Sehtrainerin. Zu Beginn schenkte ich den Nerven und Gehirnarealen, die am Sehen beteiligt sind, keine große Beachtung. Mir ging es in erster Linie um eine klare Abbildung des Gesehenen auf der Netzhaut des Auges. Das zu erreichen, sah ich als Sinn und Zweck meines beruflichen Wirkens an. Dieser Fokus hat sich jedoch im Laufe der Zeit gewandelt bzw. erweitert.
Die nervliche Versorgung des Auges ist nicht nur für die Reizweiterleitung ans Gehirn essenziell, sondern z. B. auch für die Steuerung der Augenbewegungen, die Regulation der Pupillenweite oder die Anpassung der Linse zur Scharfeinstellung. Jedoch ist das ein Erkenntnisprozess, auf den man sich erst einmal einlassen muss. Solange man das Auge als eine Art organischen Fotoapparat und vom restlichen Körper isoliert betrachtet, besteht in der Regel wenig Interesse daran, sich mit Neuronen zu beschäftigen.
Ich möchte Ihnen zeigen, dass dieses Thema außerordentlich wichtig ist und in das Sehtraining integriert werden sollte. Denn viele Bereiche des Gehirns sind am Sehprozess beteiligt und können auf unterschiedliche Weise trainiert werden. Es ist höchst spannend, wie alles im Körper zusammenhängt und wir ganz gezielt Einfluss auf ihn nehmen können.
So wünsche ich Ihnen viele neue, tiefe Erkenntnisse und vor allem Erfolg beim Trainieren Ihres Sehsinns.
Caroline Ebert
EINFÜHRUNG
Bevor wir uns den Hintergründen und Zusammenhängen des neuronalen Sehtrainings widmen, möchte ich Ihnen einen Einblick in meine eigenen Erfahrungen auf diesem Gebiet geben.
Ich war schon immer auf der Suche nach Möglichkeiten, schnell gute Ergebnisse beim Sehtraining zu erzielen. Die Kinesiologie hatte mir dahin gehend bereits viele unterschiedliche Wege aufgezeigt. Doch dann entdeckte ich das neuronale Sehtraining, das seither meine Kurse bereichert. Mir war zuvor bereits klar gewesen, dass das Sehvermögen auch vom Gehirn abhängig ist. Doch dass man dieses Wissen nutzen kann, um das Sehtraining zu optimieren, indem man beispielsweise herausfindet, welche Übung die individuell richtige ist, und damit sofortige Ergebnisse erzielen und so Zweifler schnell überzeugen kann, war mir neu.
Während ich dieses Buch schreibe, reise ich durch Deutschland und gebe Kurse. Gestern landete ich auf einem Campingplatz am Ammersee. Dort wurde ich von dem Platzwart nach meiner Tätigkeit gefragt. Wie es oft der Fall ist, war das Sehtraining für ihn etwas völlig Neues, und er reagierte sehr skeptisch hinsichtlich der Wirkung. Während unseres Gesprächs erzählte er, dass er Verkehrsschilder nicht mehr gut erkennen könne, also kurzsichtig sei. Anstatt mich mit langen Erklärungen aufzuhalten, schlug ich ihm kurzerhand vor, einfach selbst eine neuronale Sehübung auszuprobieren, und er war einverstanden. In der Nähe hing ein Schild mit den Preisen für die Übernachtungen, das uns als Sehtafel gelegen kam. Ich bat den Mann, sich so hinzusetzen, dass er geradeaus auf das Schild blickte. Zwar konnte er die Schrift darauf lesen, er sah sie jedoch verschwommen.
Mit seinem Einverständnis legte ich meine Hand an seinen Hinterkopf und forderte ihn auf, so fest wie möglich aus dem Nacken heraus dagegenzudrücken. Nachdem wir diese Position für etwa 15 Sekunden gehalten hatten, fragte ich ihn, ob sich etwas verändert hatte. Und tatsächlich nahm er die Schrift als dunkler und klarer, also besser lesbar wahr. Der Mann war begeistert und wäre am liebsten gleich mit in meinen bevorstehenden Kurs gekommen. Früher hätte ich in einer solchen Situation viel argumentieren müssen und wahrscheinlich dennoch nur Ungläubigkeit geerntet. Seitdem ich um die neuronalen Zusammenhänge weiß, kann ich mit unmittelbaren Ergebnissen überzeugen.
Bevor Sie diese Übung selbst ausprobieren, sollten Sie wissen, dass sie nicht bei allen Menschen eine sofortige Verbesserung bewirkt. Wäre es so, bräuchte es dieses Buch nicht. Aufgrund meiner Berufserfahrung wusste ich aber, welche Technik am wahrscheinlichsten zum Erfolg führen würde.
Ich könnte noch von vielen weiteren Erlebnissen wie diesem berichten. Mittlerweile beginne ich meine Kurse damit, dass ich die Teilnehmer auffordere, mir keinen Glauben zu schenken, sondern lieber selbst zu testen und zu messen, ob die Übungen Wirkung zeigen. Das macht allen viel Spaß, und wenn sie erleben, dass es funktioniert, sind sie auch offen für die Theorie dahinter.
Vom Auge zum Gehirn – ein Überblick
Das Sehen ist ein komplexer Vorgang, der die Zusammenarbeit von Augen und Gehirn erfordert, um visuelle Informationen zu erfassen und zu verarbeiten. Für diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht zum ersten Mal mit dem Sehprozess bzw. Sehtraining beschäftigen, und für alle anderen als kleine Auffrischung möchte ich hier zunächst einen Überblick über die wichtigsten Schritte geben.
Lichtwahrnehmung: Licht wird von einer Lichtquelle ausgestrahlt oder von Objekten reflektiert. Es tritt durch die Hornhaut, die klare, kuppelförmige Vorderfläche des Auges. Sie hilft, das Licht zu fokussieren.
Lichtfokussierung: Nach der Hornhaut durchquert das Licht die vordere Augenkammer, die mit Kammerwasser gefüllt ist. Das Licht passiert die Pupille. Die Iris steuert deren Größe und somit die Lichtmenge, die ins Auge gelangt. Die Linse hinter der Pupille verändert ihre Form, um das Licht genau auf der Netzhaut zu bündeln. Sie ist für die Feinjustierung des Fokus verantwortlich. Das Licht durchquert den Glaskörper, eine gelartige Substanz, die den Augapfel ausfüllt und stützt.
Lichtaufnahme und Signalverarbeitung: Das Licht trifft auf die Netzhaut, eine lichtempfindliche Schicht im hinteren Teil des Auges, die verschiedene Sehzellen (Fotorezeptoren) enthält. Diese wandeln das Licht in elektrische Signale um und leiten diese weiter zum Sehnerv.
Weiterleitung zum Gehirn: Die elektrischen Signale werden über den Sehnerv zum Gehirn geleitet. Dabei gelangen die aus dem linken Gesichtsfeld in die rechte Gehirnhälfte, die aus dem rechten Gesichtsfeld in die linke Gehirnhälfte. Im Thalamus, der als Relaisstation dient, werden die Informationen zum visuellen Kortex geleitet.
Verarbeitung im Gehirn: Im visuellen Kortex erfolgt die primäre Verarbeitung der Bildinformationen. Hier werden grundlegende Merkmale wie Kanten, Kontraste und Bewegungen erkannt. Verschiedene Areale des Gehirns verarbeiten die Informationen weiter, um komplexere Merkmale wie Formen, Farben und Objekte zu erkennen und zu interpretieren.
Integration und Interpretation: Die visuellen Informationen werden mit dem Input aus anderen Sinnessystemen zusammengeführt. Das Gehirn interpretiert die Daten und erzeugt ein bewusstes visuelles Erlebnis, das es uns ermöglicht, auf das, was wir sehen, zu reagieren.
Dieser Prozess läuft kontinuierlich und extrem schnell ab, wodurch wir in der Lage sind, unsere Umwelt nahezu in Echtzeit wahrzunehmen und mit ihr zu interagieren.
Was ist neuronales Sehtraining?
Neuronen sind spezialisierte Nervenzellen, die für die Reizaufnahme sowie die Weitergabe und Verarbeitung von Nervenimpulsen zuständig sind. Der eigentliche Sehvorgang beginnt, wenn Lichtstrahlen im Auge auf die Netzhaut (Retina) treffen. Dabei handelt es sich um ein sehr dünnes Gewebe von nur 0,1 bis 0,5 mm, das aus zehn Schichten besteht.
Aus neuronaler Sicht lassen sich die Nervenzellen der Netzhaut in drei Gruppen einteilen:
• fotorezeptive Zellen: Sie wandeln das eintreffende Licht in Nervenimpulse um. Dabei sind die Zapfen für das Farb- und die Stäbchen für das Schwarz-weiß-Sehen zuständig.
• Interneuronen: Sie verschalten die fotorezeptiven Zellen untereinander und können so die Lichtreize modulieren. Dazu gehören die weiterleitenden Bipolarzellen, die querverbindenden Horizontalzellen sowie die Amakrinzellen.
• Ganglienzellen: Sie bilden den Ausgang der Netzhaut und leiten die visuellen Reize über den Sehnerv weiter.
Fixieren wir ein Objekt, so wird es im Zentrum der Netzhaut, der Fovea centralis, abgebildet. Hier ist die Sehschärfe am höchsten. Dafür sorgen etwa 50 000 Ganglienzellen/mm2, während es in der Peripherie nur 1000 Ganglienzellen/mm2 gibt. Zudem liegt hier eine Eins-zu-eins-Verschaltung der Zapfen mit den Ganglienzellen vor, was eine hohe Detailgenauigkeit bei der visuellen Verarbeitung ermöglicht. Am Rand der Netzhaut ist diese Verschaltung weniger direkt, was zu einer geringeren Sehschärfe führt. Obwohl die Fovea centralis nur 0,01 % der Netzhaut ausmacht, verarbeitet etwa die Hälfte der Neuronen in den visuellen Zentren die Informationen, die von ihr und ihrer direkten Umgebung stammen.
Am Sehprozess sind noch viele weitere Neuronen beteiligt. Jedes Auge hat über eine Million Nervenfasern, die den jeweiligen Sehnerv bilden. Die beiden Sehnerven kreuzen sich im Chiasma opticum und verlaufen durch die optischen Trakten zu den seitlichen Kniehöckern. Von dort gehen die Signale durch die gratioletsche Sehstrahlung zur primären Sehrinde im hinteren Teil des Gehirns (Großhirnrinde). Auch andere Teile des Gehirns wie das Zwischenhirn, das Mittelhirn, die Brücke (Pons), das verlängerte Mark (Medulla oblongata), das Kleinhirn sowie verschiedene Gehirnlappen beeinflussen das Sehen durch neuronale Prozesse.
Die äußeren und inneren Augenmuskeln werden ebenfalls durch Nerven innerviert, bekommen also Impulse, woraufhin sie sich an- oder entspannen. Der Pupillenreflex wird neuronal gesteuert, und die Form der Pupille kann sich unter Stress verformen und entrunden. Das Feld des neuronalen Sehtrainings ist folglich sehr weit.
In meinen vorherigen Büchern bin ich auf diese Bereiche nicht näher eingegangen, weil ich darin den Fokus auf die emotionalen Themen bzw. Hintergründe von Augenveränderungen gelegt habe. Der Grund, weshalb ich das in diesem Werk nun nachholen möchte, ist ganz einfach: Jede emotionale Blockade wird vom Gehirn an den Körper weitergegeben. Wenn es uns gelingt, die Blockade aufzuspüren, die zu einer organischen Veränderung geführt hat, wir sie dann mit der passenden Übung lösen, kann sich das Auge wieder harmonisieren.
Unser Sehvermögen ist abhängig von der Augengesundheit, der Abbildungsqualität der Augen sowie der Verarbeitung der Sehinformationen im Gehirn. Aber haben Sie vielleicht schon von »Sehen ohne Augen« gehört? Es gibt die Theorie, dass das Gehirn so trainiert werden kann, dass die Außenwelt auch mit geschlossenen Augen fast eins zu eins wie mit geöffneten wahrgenommen wird. Ob man dem Glauben schenken will oder nicht, Fakt ist, dass das Gehirn einen großen Anteil am Sehprozess hat – Wissenschaftler gehen von 80 bis 90 % aus. Deshalb ist es mir so wichtig, das Training der Augen um die neuronalen Aspekte zu erweitern.
Augentraining ist ein Teilbereich des Sehtrainings. Er begrenzt sich auf die Augen bzw. die Augenmuskulatur. Wer meine bisherigen Bücher gelesen hat, der weiß, dass man durch das Training der Augenmuskulatur Fehlsichtigkeiten wie Kurzsichtigkeit, (Alters-)Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung korrigieren kann.
Für alle anderen ganz knapp: Um unsere Augen herum befinden sich sechs Augenmuskeln, die den Augapfel durch Anspannung/Verspannung aus seiner ursprünglichen Form bringen können. Eine Längenänderung von nur 1 mm bewirkt bereits eine Fehlsichtigkeit von 3 dpt (Dioptrien). Bei Kurzsichtigkeit wird der Augapfel in die Länge gezogen, bei Weitsichtigkeit wird er gestaucht. Ziehen die Augenmuskeln unregelmäßig am Auge, entsteht eine Hornhautverkrümmung. Auch Verspannungen der inneren Augenmuskeln, z. B. des Ziliarmuskels, können Fehlsichtigkeiten verursachen. Das Training dieser Muskeln bewirkt, dass sich die Blockaden lösen und somit die Augen wieder in einen entspannten Zustand übergehen können.
Während sich das Augentraining primär auf die äußeren und inneren Augenmuskeln konzentriert, um Verspannungen zu lösen und so Fehlsichtigkeiten zu korrigieren, geht das neuronale Sehtraining darüber hinaus, indem es das gesamte visuelle System einbezieht. Der Ansatz basiert auf der Erkenntnis, dass die Augen eng mit dem Gehirn und dem Nervensystem verbunden sind. Das Training beinhaltet somit Übungen, die nicht nur die Augenmuskulatur, sondern vor allem auch die neuronalen Verbindungen, die an der Verarbeitung des Gesehenen beteiligt sind, stimulieren. Dabei wird die Plastizität des Gehirns genutzt, also dessen Fähigkeit, sich durch die Bildung und Veränderung neuronaler Verbindungen an neue Informationen und Erfahrungen anzupassen. Das wirkt sich auch wieder entspannend auf die Augenmuskeln aus, weil besonders emotionale Reaktionen auf das Gesehene, die vom Gehirn an jene zurückgegeben werden und für ein Verkrampfen sorgen, gewandelt werden.
Neben Menschen mit klassischen Sehproblemen richtet neuronales Sehtraining sich ebenso an Personen, die ihre kognitiven Fähigkeiten, Reaktionszeiten und die Integration von visuellen Informationen verbessern wollen. Dazu gehören beispielsweise auch Sportler wie Tennisspieler, deren Erfolg u. a. davon abhängt, dem Ball auf dem Court präzise folgen und entsprechend schnell darauf reagieren zu können.
ENTSPANNUNG FÜR DIE AUGEN
Das Auge und die Augenmuskeln werden sowohl sympathisch als auch parasympathisch gesteuert. Das sympathische Nervensystem reguliert die Körperfunktionen bei Aktion und in Stresssituationen, während das parasympathische Nervensystem in Ruhephasen für Regeneration sorgt. Da beide Systeme antagonistisch, also entgegengesetzt wirken, sollten sie immer wieder in Balance gebracht werden.
Die Pupille sollte eigentlich rund sein, doch das ist nicht immer der Fall. Abweichungen können psychische oder physische Blockaden im Körper anzeigen. Wo genau diese Verformung auftritt, lässt darauf schließen, welche Körperbereiche betroffen sind. Diese Zusammenhänge sind aus der Irisanalyse bekannt.
Die Größe der Pupille verändert sich je nach Lichteinfall. Sie verkleinert sich bei Helligkeit und weitet sich bei Dunkelheit, damit genug Licht ins Augeninnere kommen kann. Weil die Steuerung durch das sympathische und das parasympathische Nervensystem erfolgt, kann es vorkommen, dass Ihre Pupillen auch bei guten Lichtverhältnissen vergrößert sind, wenn Sie unter Druck stehen, starke Schmerzen oder Angst haben.