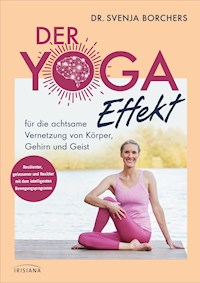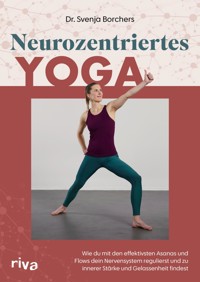
20,99 €
Mehr erfahren.
Alte Praxis auf neuen Wegen Zwischen der Hektik und den To-dos des Alltags geht oft das Gespür für die eigenen mentalen und körperlichen Bedürfnisse verloren. Indem es das Nervensystem reguliert, kann neurozentriertes Yoga dir zu mehr Selbstsicherheit und Entspannung verhelfen und deine Gesundheit auf allen Ebenen stärken. Tradition trifft Innovation Die Neurowissenschaftlerin, Yogalehrerin und Neuroathletik-Coachin Svenja Borchers zeigt dir, wie du neurozentriertes Yoga optimal einsetzt, um den größtmöglichen Effekt für dein Wohlbefinden zu erzielen. Durch die Kombination von klassischen Asanas mit Atem-, Augen- und Gleichgewichtsübungen aus der Neuroathletik förderst du deine innere Selbstsicherheit, deine körperliche Regeneration, deine Beweglichkeit und insbesondere deine Körperverbindung. Bebilderte Step-by-Step-Anleitungen für - 80 Übungen und Haltungen sowie - 8 Sequenzen mit einem ganz gezielten Effekt helfen dir dabei, die Signale deines Körpers wieder richtig wahrzunehmen. Denn nur so kannst du ihm geben, was er wirklich braucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buchvorderseite
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und [email protected]
Wichtige HinweiseDieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und die Autorin haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Originalausgabe 1. Auflage 2025 © 2025 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH Türkenstraße 89 80799 München Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ulrike Reinen Umschlaggestaltung: Sonja Stiefel Umschlagabbildung: Nils Schwarz; shutterstock/watchara Abbildungen im Innenteil: alle Bilder im Innenteil von Nils Schwarz, www.nilsschwarz.com, außer: S. 8, 12, 220: Adobe Stock/Oleksandr Pokusai; S. 9, 10: Adobe Stock/Dee-sign; S. 14, 18 (Eigenwahrnehmung, Körperfunktionssteuerung): Adobe Stock/pikovit; S.18 (Außenwahrnehmung): Adobe Stock/Tysam; S. 18 (Innenwahrnehmung): Adobe Stock/Choor Vector; S. 18 (Gehirn): Adobe Stock/Crazy nook; S. 18 (Sicherheit bewahren): Shutterstock/artskill2k17; S. 18 (Leistungsfähigkeit): Adobe Stock/NeuroArtStream; S. 18 (Bewegungssteuerung): Shutterstock/QuirkCraft Studio; S. 18 (Kommunikation): Adobe Stock/SMUX; S. 21: Adobe Stock/vasilisatsoy; S. 28, 69, 71: Adobe Stock/Sebastian Kaulitzki; S. 34: Adobe Stock/vishalgokulwale; S. 39: Shutterstock/Iryna Opryshko S. 43: Adobe Stock/sakurra; S. 46: Adobe Stock/ ilusmedical; S. 52: Adobe Stock/ellepigrafica; S. 56: Adobe Stock/magicmine; S. 62: Shutterstock/Vectoressa; S. 143: Shutterstock/shurkin_son; S. 153: Adobe Stock/VecorMine; S. 163: Adobe Stock/Niza; S. 192: Adobe Stock/Akarat Phasura; S. 195: Shutterstock/Yevgenij_D; S. 209: Shutterstock/DesignPrax; S. 210: Adobe Stock/Oksana; S. 224: Adobe Stock/zombiu26 Layout und Satz: Bernadett Limmer (schere.style.papier), MüncheneBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2829-8 ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2624-6
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Titelseite
Dr. Svenja Borchers
Neurozentriertes
YOGA
Wie du mit den effektivsten Asanas und Flows dein Nervensystem regulierst und zu innerer Stärke und Gelassenheit findest
INHALT
KAPITEL 1
Wie uns das Nervensystem beschützt
Aufbau und Funktion des Nervensystems
So arbeitet das Nervensystem
KAPITEL 2
Das ist neurozentriertes Yoga
Neurozentriertes Training
So wirkt neurozentriertes Yoga auf das Nervensystem
Die Prinzipien des neurozentrierten Yoga
Kapitel 3
SAFE in der Praxis
Stärken
Atmen
Fühlen
Erkunden
Kapitel 4
Yogasequenzen für deine Bedürfnisse
Übungsflows erstellen
ANHANG
Quellen
Übungsverzeichnis
Übersicht der Übungssequenzen
Dank
Über die Autorin
KAPITEL 1
Wie uns das Nervensystembeschützt
Unser Nervensystem bestimmt alles in unserem Leben. Es ist – so wie unser gesamter Körper – ein reines Wunderwerk. Wir können nicht sagen, dass wir es in seiner Komplexität bereits vollends verstanden haben, aber wir wissen dennoch eine ganze Menge darüber. In diesem Kapitel erfährst du alle Grundlagen über das Nervensystem, die du brauchst, um die neurozentrierte Yogapraxis zu verstehen und für dich nutzen zu können.
Aufbau und Funktion des Nervensystems
Kommunikation ist alles – nicht nur zwischen Menschen, sondern auch zwischen unseren Zellen im Körper. Ganz besonders gilt dies für unsere Nervenzellen, denn diese erlangen ihre Wirkung dadurch, dass sie Signale schnell und effektiv weitergeben. Aber lass uns von vorn beginnen: Warum ist das für die Yogapraxis relevant? Unser Nervensystem reguliert und koordiniert alle unsere Körperfunktionen. Alles, was wir denken, was wir tun, wie wir uns bewegen, was wir sagen, was wir wahrnehmen und was wir lernen, ist von unseren Nervenzellen abhängig. Sie machen uns als Mensch zu dem, was wir sind. Unser Nervensystem ist unsere Schaltzentrale und bestimmt, wie es uns geht, was wir spüren und wie wirksam wir in unserem Leben sein können. Bevor wir also darauf kommen, wie wir unsere Yogapraxis gestalten können, um Nervensystem-freundlich und -wirksam zu praktizieren, brauchen wir ein gemeinsames Verständnis darüber, wie unser Nervensystem überhaupt funktioniert – lass uns also einen Blick darauf werfen, wie es aufgebaut ist.
Die Nervenzelle leitet Signale über das Axon weiter zum Zielort und überträgt dort das Signal über die Synapse an eine andere Nervenzelle.
Die kleinste Funktionseinheit ist die Nervenzelle (auch Neuron genannt). Nervenzellen sind insofern besondere Zellen in unserem Körper, weil sie für die schnelle Kommunikation gemacht sind: Sie sind wie winzige Boten, die Nachrichten in deinem Körper weiterleiten. Jede Nervenzelle hat einen Zellkörper, in dem alle wichtigen Entscheidungen getroffen werden, und einen langen Fortsatz, das Axon, über das elektrische Signale – quasi wie Nachrichten – an andere Zellen geschickt werden. Wenn diese Signale das Ende des Axons erreichen, treffen sie auf einen kleinen Spalt, die Synapse. Hier werden die elektrischen Signale in chemische Botenstoffe umgewandelt, die dann die nächste Nervenzelle erreichen und aktivieren können. So können die Nachrichten innerhalb eines Netzwerks weitergegeben werden.
Im Gehirn und Rückenmark gibt es zwei Bereiche, die wir voneinander unterscheiden können: Die graue Substanz enthält vor allem die Zellkörper von Nervenzellen und anderer unterstützender Zellen (Gliazellen). Dies ist der Ort, an dem viele Verarbeitungsprozesse stattfinden, während die weiße Substanz vor allem aus den Axonen besteht, die oft von einer fetthaltigen Schicht (Myelin) umgeben sind. Diese Schicht isoliert die Axone, verleiht der Substanz ihre weiße Farbe und sorgt dafür, dass die Signale schnell übertragen werden.
Im Gehirn kommunizieren Nervenzellen hauptsächlich miteinander, stehen aber auch in enger Wechselwirkung mit Gliazellen, die ihre Funktion unterstützen und beeinflussen. Im restlichen Körper steuert das Nervensystem zudem die Muskelaktivität und beeinflusst auch direkt die Funktion der Organe, des Hormonsystems sowie des Herz-Kreislauf-Systems. Du kannst dir vorstellen, dass dein Nervensystem wie ein gigantisches Netzwerk von Autobahnen ist, die deinen ganzen Körper durchziehen. Es verbindet das Gehirn mit allen Organen, Muskeln und Zellen, sodass Informationen ständig hin- und hergeschickt werden und dein Körper schnell auf sich ändernde Bedingungen reagieren kann.
Die Hirnrinde besteht aus grauer Substanz; die Axonen im Inneren des Gehirns bilden die weiße Substanz. Aber auch dort gibt es Zellansammlungen, also graue Substanz.
Das zentrale und das periphere Nervensystem
Das Nervensystem unterteilt sich konzeptuell in zwei Hauptbereiche: das zentrale Nervensystem (ZNS) und das periphere Nervensystem (PNS).
Stelle dir das zentrale Nervensystem als das Hauptkontrollzentrum deines Körpers vor – es besteht aus dem Gehirn und dem Rückenmark, während das periphere Nervensystem die Befehle ausführt und den jeweils aktuellen Zustand zurückmeldet, denn es setzt sich aus allen Nerven zusammen, die durch den gesamten Körper ziehen.
Das zentrale Nervensystem besteht aus Gehirn und Rückenmark, das periphere Nervensystem aus allen Nerven, die durch den gesamten Körper ziehen.
Die zwei Hälften des Gehirns (die sogenannten Hemisphären) kommunizieren über Verbindungen miteinander. Wir können das Gehirn zum besseren Verständnis grob in vier Bereiche aufgliedern:
●Das Großhirn ist in vier Lappen unterteilt, die jeweils spezielle Aufgaben erfüllen – der Frontallappen ist zuständig für Planung, Bewegung und Entscheidungsfindung, der Parietallappen verarbeitet sensorische Informationen und hilft uns, unseren Körper und die Umgebung wahrzunehmen, der Temporallappen steuert das Hören, die Sprachverarbeitung und das Gedächtnis, und der Okzipitallappen ist für das Sehen verantwortlich. In der Tiefe des Großhirns befinden sich weitere wichtige Strukturen wie die Inselrinde, die unsere Innenwahrnehmung verarbeitet, das limbische System, das für die Verarbeitung von Emotionen wichtig ist, und einige andere Bereiche.
●Das Kleinhirn sorgt für Koordination, Gleichgewicht und Feinabstimmung von Bewegungen, spielt aber auch eine große Rolle beim Lernen und anderen Funktionen. Auch wenn die Größe des Kleinhirns entsprechend seines Namens nur 10 Prozent der Gesamtgröße ausmacht, befinden sich hier etwa 50 bis 80 Prozent aller Nervenzellen des Gehirns. Das verdeutlicht, dass das Kleinhirn viele Informationen verarbeitet und eine Art Integrationszentrale ist.
●Der Hirnstamm ist ein anderer, sehr wesentlicher Teil des Gehirns, denn er reguliert lebenswichtige Funktionen wie Atmung, Herzschlag und Blutdruck. Aus dem Hirnstamm entspringen auch die Hirnnerven, die spezielle Aufgaben übernehmen – etwa die Steuerung der Augenbewegungen, Gesichtssensibilität oder des Gleichgewichts. Zusammen mit wenigen anderen Bereichen des Gehirns steuert er das autonome Nervensystem und hat Einfluss auf zahlreiche Organe.
●Das Rückenmark verläuft vom Hirnstamm entlang der Wirbelsäule und leitet alle Informationen zwischen Gehirn und restlichem Körper weiter. Es enthält ebenso wie das Gehirn weiße und graue Substanz, also sowohl Nervenfasern als auch Zellkerne, in denen Verschaltungen stattfinden, wie beispielsweise Muskelreflexe.
Das periphere Nervensystem (PNS) besteht aus allen Nerven, die durch den gesamten Körper ziehen. Es ermöglicht, dass Befehle vom Gehirn an Muskeln und Organe gesendet werden, während gleichzeitig sensorische Informationen – wie Berührung, Gefahrensignale oder Temperatur – zurück an das Gehirn gelangen. Das PNS unterteilt sich in das somatische Nervensystem, das für bewusst gesteuerte Bewegungen zuständig ist, und das autonome Nervensystem, das unbewusst lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Verdauung reguliert. So sorgt das Zusammenspiel von ZNS und PNS dafür, dass du dich bewegen, deine Umwelt wahrnehmen und auf sie reagieren kannst.
Das Großhirn mit seinen vier Lappen, das Kleinhirn, der Hirnstamm und das Rückenmark bilden zusammen das zentrale Nervensystem.
Das autonome Nervensystem
Das autonome Nervensystem (ANS) steuert viele unbewusste lebenswichtige Funktionen wie den Herzschlag, die Atmung und die Verdauung und hat damit auch einen großen Einfluss auf unser Stressempfinden und Wohlbefinden. Es besteht aus zwei Hauptzweigen: dem Sympathikus (»Kampf-oder-Flucht-Modus«) und dem Parasympathikus (»Ruhe- und Regenerations-Modus«). Stehen wir stark unter Stress oder ahnen wir eine Gefahr auf uns zukommen, so bereitet unser Sympathikus alle Körperfunktionen auf Aktivität vor: Der Herzschlag wird beschleunigt, der Blutdruck steigt, die Verdauung wird heruntergefahren, der Muskeltonus wird verstärkt und die Pupillen geweitet, um mehr Licht an die Netzhaut zu lassen und damit auch bei schwachem Licht mehr Informationen in schnellerer Zeit aufnehmen zu können. Dies ist sehr hilfreich, wenn Gefahr lauert und wir schnell handlungsfähig sein müssen. Ist die potenzielle oder tatsächliche Gefahr gebannt, so stellt unser Nervensystem im Idealfall auf Ruhe und Regeneration um. Hierfür ist unser Parasympathikus zuständig: Der Herzschlag wird verlangsamt, der Blutdruck fällt, die Muskeln dürfen entspannen, die Verdauung wird aktiviert und die Pupillen verengt, was dafür mehr Fokus und Tiefenschärfe erlaubt.
Sympathikus und Parasympathikus arbeiten in einer komplexen Art und Weise miteinander und haben weitreichende Auswirkungen auf unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Das autonome Nervensystem wirkt an allen Strukturen im peripheren Nervensystem, abgesehen von der Skelettmuskulatur. Es stellt also die Kommunikation mit den Organen sicher, aber auch mit Drüsen, glatter Muskulatur, wie sie in fast allen Organsystemen zu finden ist, und Strukturen wie dem Knochenmark, dem Lymphsystem, Fett- und Bindegewebe. Im Gegensatz zum zentralen Nervensystem befinden sich die wichtigen Steuerzentren des autonomen Nervensystems (ANS) in sogenannten Ganglien – Nervengeflechten, in denen Signale neu verschaltet werden. Diese Ganglien liegen außerhalb des Rückenmarks, teils sogar direkt in den Organen. So kann der Darm beispielsweise Kontraktionswellen ausführen, selbst wenn seine Verbindung zum ZNS unterbrochen ist. Ursprünglich erhielt das ANS den Namen »autonom«, weil es eine gewisse Eigenständigkeit besitzt und unbewusst arbeitet – wir können nicht willentlich eingreifen. Allerdings sind die Funktionen des ANS dennoch eng mit dem ZNS verknüpft.
Die Fasern des Sympathikus treten auf Ebene der Brustwirbelsäule und der oberen Lendenwirbelsäule aus dem Rückenmark hervor. Sie sind in einer beidseits der Wirbelsäule liegenden Ganglienkette verschaltet. Von hier werden die Signale weiter zu den Zielstellen geschickt. Die Fasern des Parasympathikus hingegen verlassen das Gehirn mit dem 3., 7., 9. und 10. Hirnnerv sowie auf Höhe der unteren Rückenmarksegmente. Anders als die Signale des Sympathikus werden die Fasern des parasympathischen Zweigs oft erst näher am Zielorgan verschaltet. Besonders viel Aufmerksamkeit hat in den letzten Jahren der Vagusnerv, der 10. Hirnnerv, genossen. Sein Name kommt von dem lateinischen Wort vagari und bedeutet so viel wie »umherschweifen«, da seine vielen kleinen Ausläufer den Körper großflächig durchziehen, und zwar vom Hirnstamm bis hinunter auf Höhe des mittleren Dickdarms. In diesem Bereich versorgt er fast alle Organe und hat neben den parasympathischen Anteilen sowohl sensorische Fasern, die dem Gehirn Informationen von den inneren Organen schicken, als auch motorische Fasern, welche die Aktivität von Muskeln im Kehlkopf- und Rachenbereich steuern.
So wirken Sympathikus und Parasympathikus auf die meisten Organe und Zielstrukturen in zweizügeliger Steuerung. Die einzigen Ausnahmen sind Niere und Nebenniere, die nur vom Sympathikus reguliert werden. Es ist normal, dass immer mal wieder eines der Systeme je nach Anforderungen während des Tagesverlaufs mehr wirkt als das andere. Oftmals wirken aber auch beide Systeme eng aufeinander abgestimmt. Wenn wir einatmen, regt das unseren Sympathikus an, wenn wir ausatmen, unseren Parasympathikus. Ein andauernd überaktivierter Sympathikus, oft ausgelöst durch chronischen Stress und das Gefühl, dass immer schnell auf mögliche Gefahren oder Anfragen reagiert werden muss, kann hingegen zu einem Zustand ständiger Alarmbereitschaft führen, der das Gleichgewicht des ANS auf Dauer stört. Zudem kann eine erhöhte Aktivität des Sympathikus durch die Ausschüttung von Stresshormonen entzündungsfördernde Prozesse im Körper begünstigen und sich negativ auf die Gesundheit auswirken.
Sympathikus und Parasympathikus wirken auf die meisten Organe und Zielstrukturen in zweizügeliger Steuerung.
Die Polyvagaltheorie
Der Vagusnerv ist in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus gerückt. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Wir wollen verstehen, was uns aus der Überaktivität heraushilft und in die heilsame Entspannung führt. Dabei wird zunehmend Bezug zur Polyvagaltheorie genommen. Sie wurde von Dr. Stephen Porges entwickelt und beschreibt die Auffassung, dass die beiden Hauptäste des Vagusnervs – der ventrale und dorsale Zweig – eigentlich voneinander getrennte Kreisläufe mit unterschiedlicher Wirkung bilden. Statt eines binären Systems (bestehend aus Sympathikus und Parasympathikus) spricht Porges also von drei Systemen, die allerdings auch nicht scharf voneinander getrennt wirken, sondern eng ineinandergreifen. Neben dem aktivierenden Sympathikus gibt es zwei Hauptkomponenten des parasympathischen Systems1:
Der vordere, ventrale Vagusnerv: Dieser Teil wird vom Nucleus ambiguus im Hirnstamm gesteuert und steht für einen wachen Entspannungszustand. Er unterstützt soziale Bindung und interaktive Funktionen. Die Aktivierung des ventralen Vagus fördert das Gefühl von Sicherheit und die Regulation des Herzschlags.Der hintere, dorsale Vagusnerv: Dieser Teil wird vom dorsalen motorischen Vagusnervkern im Hirnstamm gesteuert und ist mit Rückzug und Passivität und im Extremfall mit der »Freeze«-Reaktion (freeze für »einfrieren«), dem Überlebensmodus, verbunden. Seine Aktivierung führt häufig zu einem Zustand der Unterdrückung von Aktivität und kann in bedrohlichen Extremsituationen ein völliges Abschalten, also eine dissoziative Reaktion, bewirken.Die Theorie von Porges betont, dass insbesondere das vagale System eine Schlüsselrolle in der Regulation der körperlichen und emotionalen Reaktionen spielt. Die Regulation der Gesichtsmuskeln, die Stimmproduktion und die Akustik von Sprache werden durch diesen Teil des Vagusnervs beeinflusst, was darauf hindeutet, dass er eine Rolle im sozialen Verhalten spielt.2
Die Polyvagaltheorie hat großen Einfluss auf die Traumaforschung: Bei traumatisierten Personen kann die vagale Aktivität vermindert sein, was zu einer übermäßigen Sympathikus-Aktivierung oder einer Erstarrungsreaktion (Freeze) führt. Diese Veränderung in der Regulation könnte erklären, warum Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung Schwierigkeiten haben, sich sicher zu fühlen oder soziale Bindungen aufrechtzuerhalten.
Einige Kritiker argumentieren, dass die Polyvagaltheorie in ihrer ursprünglichen Form zu vereinfachend und die neuroanatomische und physiologische Evidenz nicht hinreichend ist.3 Dennoch spielt die Polyvagaltheorie eine bedeutende Rolle in der Verständnisentwicklung des Zusammenhangs zwischen autonomem Nervensystem und emotionaler Regulierung, insbesondere im Hinblick auf Stressbewältigung und soziale Interaktion. Auch wenn die Theorie bisher umstritten und die Forschung zur genauen Funktionsweise des Vagusnervs noch im Gange ist, kann sie in einigen Bereichen hilfreich angewendet werden.
Neuroplastizität – das Gehirn hört nicht auf zu lernen
Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, sich permanent neu zu organisieren und an Veränderungen anzupassen – so wie ein flexibles Netzwerk, das ständig Verbindungen zwischen Nervenzellen aufbaut, verändert oder abbaut. Wenn wir etwas Neues lernen, entstehen neue Verbindungen, und je öfter wir etwas praktizieren, desto stärker werden diese Verbindungen. Gleichzeitig kann das Gehirn auch »verlernen«, was bedeutet, dass nicht mehr benötigte oder selten genutzte Verbindungen abgebaut werden, um Energie zu sparen. Ähnlich wie bei der Muskulatur können sich Nervenstrukturen oder Verbindungen durch fehlende Nutzung und Aktivierung zurückbilden. Diese Fähigkeit, Verbindungen flexibel auf- und wieder abzubauen, hilft dem Gehirn, effizient zu arbeiten und seinen Energiehaushalt zu optimieren. Obwohl jüngere Gehirne in der Regel flexibler sind und schneller auf neue Herausforderungen reagieren, bleibt die Fähigkeit zu lernen auch im höheren Alter erhalten.
Unser Gehirn arbeitet in Netzwerken. So werden vorherige Erfahrungen in bestimmten Mustern abgebildet, die uns in kritischen Situationen helfen, schnell zu handeln. Diese Netzwerke prägen unser Verhalten und machen es uns auf der anderen Seite schwerer, unsere einmal gelernten Verhaltensweisen wieder zu verändern. Um dies zu tun, müssen wir unser Nervensystem gezielt stimulieren und herausfordern. Neue oder schwierige Aufgaben helfen uns zu lernen, indem sie die Bildung neuronaler Verbindungen fördern und unsere Aufmerksamkeit auf die richtigen Punkte lenken. Denn wenn wir eigene Fehler bewusst wahrnehmen, erhalten wir wertvolles Feedback zur Optimierung unserer Strategien. Dabei sollte eine Aufgabe, die uns zum Lernen animieren soll, weder zu leicht noch zu schwer sein: Ist sie zu einfach, langweilt sie uns, ist sie zu anspruchsvoll, sinkt die Motivation. Der beste Lernprozess entsteht, wenn wir uns stufenweise herausfordern, an bereits bekannte Muster anknüpfen und diese anpassen, anstatt völlig neue Strukturen zu schaffen. Unser Gehirn sucht stets Ankerpunkte, um neue Informationen in einen vertrauten Kontext einzuordnen.
Zudem ist eine stressarme Umgebung entscheidend für die Anpassungsfähigkeit des Gehirns, da sie die Bildung und Stärkung neuronaler Verbindungen erleichtert. Durch die Reduktion von Stresshormonen wie Cortisol verbessert sich die Lernfähigkeit, emotionale Balance und Neuroplastizität. Deshalb ist es wichtig, achtsam mit den Reizen und Informationen umzugehen, die wir unserem Gehirn geben, uns bewusst an Herausforderungen heranzutasten und individuelles Lernen – auch in der Yogapraxis – gezielt zu fördern. Denn all das beeinflusst nicht nur unser unmittelbares Erleben, sondern kann unser Gehirn nachhaltig verändern.
Indem wir uns in der Yogapraxis herausfordern, neue Bewegungen und Yogahaltungen ausprobieren, werden wir zur lernenden Person. Wir akzeptieren, dass wir nicht alles bereits beherrschen. Vielmehr noch lernen wir durch kleine Erfolge die Freude am Prozess des Lernens. Wir gewöhnen uns daran, Dinge mit Offenheit und Neugier anzugehen, und verstehen, wie wichtig die eigene Einstellung dabei ist. Denn je offener und positiver unsere Einstellung beim Lernen, desto leichter fällt uns der Prozess. Wir begreifen, dass wir durch unsere innere Einstellung Einfluss auf die Sicht haben, wie wir auf die Welt schauen und diese erleben. Diese Erkenntnisse geben uns das Gefühl, dass wir selbst etwas für uns tun können. Gleichzeitig schenken sie uns mehr Gelassenheit, wenn wir Dinge noch nicht beherrschen.
So arbeitet das Nervensystem
Wollen wir das Nervensystem in unserer Yogapraxis berücksichtigen, brauchen wir ein grobes Grundverständnis, wie es funktioniert. Nun ist unser Nervensystem eines der komplexesten Systeme des Körpers. Allein unser Gehirn enthält schätzungsweise 86 Milliarden Nervenzellen und fast noch mal so viele andere Zellen, die all unsere Denkprozesse unterstützen.4 Dabei ist die Hauptaufgabe des Nervensystems, unser Überleben zu sichern, und all die verschiedenen Netzwerke sind dafür optimal ausgerichtet. Für ein allgemeines Verständnis können wir ein vereinfachtes Modell nutzen, das uns hilft, die Funktionsweise unseres Gehirns zu verstehen.
Stelle dir das Gehirn wie einen hoch entwickelten Computer vor: Es empfängt ständig Informationen aus unserer Umwelt (den Input), verarbeitet diese in spezialisierten Bereichen und trifft Entscheidungen, um dann unser Verhalten über passende Reaktionen (den Output) zu steuern. Jeder dieser Schritte ist entscheidend für das Endergebnis. Wir können davon ausgehen, dass bei unpräzisen oder uneindeutigen Informationen die Entscheidungsfähigkeit erschwert ist und der Output möglicherweise darunter leidet. Mit anderen Worten: Wollen wir unsere Ziele erreichen (Output), sollten wir nicht nur auf das resultierende Verhalten (wie zum Beispiel die Bewegungsausführung) schauen, sondern bereits die Eingangssignale betrachten und ihre Qualität überprüfen. Wie das genau aussehen kann und welche Informationen dabei eine Rolle spielen, sieh dir im Folgenden an.
Das Gehirn integriert alle eingehenden Informationen, interpretiert und bewertet sie unter Berücksichtigung von Erfahrungen und entscheidet dann über die darauffolgende Aktion.
Input: Informationen, die das Gehirn verarbeitet
Unser Gehirn erhält eine Menge von Signalen (Input) über die äußere Umwelt und über uns selbst, um in jedem Moment zu überprüfen, ob wir sicher sind. Informationen über die Außenwelt bekommen wir über unsere Sinnesorgane: Dazu gehören die Augen (Sehen), die Ohren (Hören), die Nase (Riechen), die Zunge (Schmecken) und die Haut (Tasten). In diesen Sinnesorganen haben wir Rezeptoren, die uns Informationen über Nervenbahnen direkt in das Gehirn leiten. Aber wir bekommen nicht nur Informationen von der Außenwelt (Exterozeption), sondern auch über unseren eigenen Zustand. Das sind Informationen von unserem Gleichgewichtsorgan im Innenohr (Vestibularsystem), das uns sagt, wie unser Körper zur Schwerkraft ausgerichtet ist und ob wir uns im Raum bewegen. Unsere Propriozeption, also die Eigenwahrnehmung, lässt uns über Sensoren in den Muskeln und Gelenken feststellen, in welcher Haltung unser Körper gerade ist und wo sich unsere Gliedmaßen befinden. Das ist essenziell wichtig, denn wenn wir unsere Körperausrichtung nicht spüren würden, könnten wir weder stehen, gehen noch aufrecht sitzen. Weitere Informationen bekommen wir vom Inneren des Körpers (daher auch Innenwahrnehmung oder Interozeption genannt) über die Körpertemperatur, den Zustand unserer Organe oder unseren Herzschlag. Dazu gehört auch die Nozizeption, also die Wahrnehmung von Gefahren innerhalb des Körpers. Nozizeptoren sind Rezeptoren, die bei Verletzungen oder Reizungen jeglicher Art Signale an das Gehirn schicken und es frühzeitig warnen – auch wenn das bewusste Erleben von Schmerz dabei nicht zwingend eintritt (dazu später mehr).
Besonders das Zusammenspiel dreier Informationsarten steht für unsere Sicherheit und unsere Orientierung und Bewegung in der Welt im Vordergrund: Wenn wir beurteilen wollen, ob eine Gefahr in Sicht ist, müssen wir zunächst den Zustand unseres Körpers einschätzen können (Propriozeption). Wir müssen außerdem wissen, wo und wie wir im Verhältnis zu unserer Umgebung stehen (Gleichgewichtsinformationen). Wenn wir zusätzlich unsere Umgebung visuell wahrnehmen können, bekommen wir ein umfangreiches Bild über uns selbst in der jeweiligen Situation und können daraus Entscheidungen für unsere Sicherheit ableiten. Wir können uns vorstellen, dass diese drei Informationsquellen – unser Körper, das visuelle System und das Gleichgewichtssystem – uns durchgehend mit Informationen versorgen, mit denen wir uns in der Welt verorten können. Sie bilden also eine Art inneres Satellitensystem, anhand dessen wir uns orientieren. Fällt ein System aus oder liefert ungenaue Daten, so kann das unsere Orientierung – und damit auch unser Sicherheitsempfinden – stark beeinträchtigen. In der neurozentrierten Yogapraxis trainieren wir diese drei Sinnesbereiche gezielt, denn sie sind für unser Wohlbefinden von zentraler Bedeutung.
Ist die Informationsqualität aus den verschiedenen Sinnesorganen vermindert, zum Beispiel aufgrund von zurückliegenden Verletzungen, geringer Nutzung oder Degeneration, so kann das Gehirn keine optimalen Entscheidungen treffen.
Verarbeitung der Informationen, Bewertung und Entscheidung
Alle eingehenden Signale werden an unsere innere Schaltzentrale – unser Gehirn – weitergeleitet. Dort werden sie mit anderen Informationen zu einem Gesamterlebnis integriert, mit unseren bisherigen Erfahrungen abgeglichen und bewertet, um stets die beste Entscheidung für unser Wohlbefinden zu treffen. Unser Gehirn arbeitet wie ein hoch entwickelter Computer, der unzählige Informationen gleichzeitig verarbeitet und immer wieder hinterfragt, ob eine Gefahr lauert. Bei der Bewertung der aktuellen Situation geht es nicht nur darum, reale Gefahren zu erkennen, sondern auch die Vorhersagbarkeit von Situationen zu beurteilen. Denn je besser wir eine Situation einschätzen und bereits aus Erfahrung vorhersagen können, desto kontrollierbarer und sicherer fühlt sie sich für uns an. Dabei spielt nicht nur der Bekanntheitsgrad der Situationen oder beteiligten Personen eine Rolle, sondern auch die Qualität der eingehenden Signale und wie sie jeweils zu einem Gesamteindruck integriert werden. Voneinander abweichende oder gar unzureichende Informationen, beispielsweise aus dem Körperinneren, können uns verunsichern, denn dies birgt möglicherweise unvorhersehbare Risiken.
Übrigens haben wir Menschen in unserer Wahrnehmung eine angeborene sogenannte Negativitätsverzerrung, die ebenso dazu dient, uns vor Gefahren zu schützen. Schon im ersten Lebensjahr in der Entwicklung des Kinds prägt sich diese Verzerrung aus: Negative Erlebnisse, Informationen oder Emotionen gewichten wir stärker als neutrale oder positive Informationen – und damit erinnern wir uns auch besser daran. Dies hilft uns, Gefahren schneller zu erkennen und ähnliche Fehler nicht mehrmals zu machen.
Was besonders faszinierend ist: Dieser komplexe Prozess, bei dem wir blitzschnell Muster erkennen und Konsequenzen berechnen, geschieht meist völlig unbewusst – sodass wir oft intuitiv und ohne langes Nachdenken handeln. Diese schnelle Handlungsfähigkeit aufgrund unbewusster, kontinuierlicher Prüfungen verdanken wir hauptsächlich dem evolutionsgeschichtlich älteren Teil unseres Gehirns: Unser Hirnstamm ist dabei in direktem Austausch mit Teilen der Inselrinde und auch mit dem limbischen System, dem Bereich, der für die Emotionsverarbeitung und die Verbindung zu Gedächtnisinhalten verantwortlich ist.
Die Inselrinde spielt bei der Bewertung des Wahrgenommenen eine große Rolle, denn sie integriert viele Informationen aus dem Inneren und aus der Außenwelt zusammen mit unseren Emotionen, um die Relevanz der Informationen für unser Wohlbefinden zu bewerten. Eingehende Informationen können zudem je nach Situation und erster Einschätzung der Wichtigkeit entweder verstärkt oder erst einmal unterdrückt werden. Manche von uns kennen das, wenn eine Verletzung aus einer hochstressigen Situation beispielsweise erst viel später auffällt und wir in diesem Moment gar keinen Schmerz empfunden haben. Denn unser Gehirn hat eigenständig eingeschätzt, dass unsere Aufmerksamkeit an einer anderen Stelle in diesem Moment viel wichtiger für unser Überleben war. Die kleine Verletzung hingegen war relativ gesehen nicht wichtig, wohingegen wir in einer anderen Situation möglicherweise durchaus Schmerzen gespürt hätten.
Diese Art der Gefahrenanalyse geschieht im Bruchteil einer Sekunde, sodass sich der Körper der Situation immer wieder neu anpassen kann. Dass diese Bewertung in der Regel unbewusst verläuft, kommt uns zugute, denn bei der Vielzahl der Informationen, die gleichzeitig verarbeitet werden müssen, hätten wir keine Ressourcen für andere Aufgaben mehr übrig. Die bewusste Verarbeitung hingegen findet im Großhirn in einer etwas langsameren Geschwindigkeit statt. Im vorderen Teil der Inselrinde verschmelzen die unbewusst verarbeiteten Informationen durch direkte Kommunikationsverbindungen mit dem Frontallappen: Hier finden bewusste kognitive und emotionale Bewertungen statt.
Die Inselrinde liegt im Inneren des Gehirns, eingebettet in die Lateralfissur zwischen Frontal- und Temporallappen.
Wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen – und das kann auch einfach bedeuten, dass wir eine Bewegung initiieren –, dann ist unser Gehirn in einem entspannteren und damit leistungsfähigeren Zustand, wenn es die Situation als verlässlich einschätzen kann. Nur wenn die erste Aufgabe, das Überleben zu sichern, gewährleistet ist, können wir unsere Energie für andere Aufgaben verwerten. Andersherum wäre es auch nicht sinnvoll: Wenn unser Gehirn unsere Leistungsfähigkeit wichtiger nähme, dann wären unsere Überlebenschancen womöglich nicht so groß.
Wenn unser Gehirn die Kontrolle übernimmt
Wie ernst unser Gehirn die Aufgabe nimmt, unsere Sicherheit zu gewährleisten, können wir daran sehen, dass die erste Verarbeitung von Informationen blitzschnell geschieht und auch, wenn nötig, direkte Gegenmaßnahmen vorgenommen werden, ohne dass uns dies zunächst bewusst ist. Denn im Zweifel muss alles sehr schnell gehen. Dieser Mechanismus ist für uns lebenswichtig. Unser Gehirn kann bei eingeschätzter Gefahr motorische Reaktionen wie Reflexe und Augenbewegungen oder natürlich auch autonome Reaktionen wie die Aktivierung des Sympathikus einleiten. Bei uns Menschen entwickelt sich tatsächlich bereits in einem Alter von nur vier Monaten der sogenannte Schreckreflex. Bei einer plötzlich eintretenden eingeschätzten Gefahr wird folgendes Bewegungsmuster über den Hirnstamm initiiert: Wir beobachten ein Einrollen vom Kopf über den Rumpf bis zu den Beinen. Die Gliedmaßen werden an den Körper herangezogen, die Schultern hochgezogen und nach vorn gerundet, um den Hals und Brustbereich zu schützen. Je nach Art des Schrecks werden die Augen weit aufgerissen, um viele Informationen schnell aufnehmen zu können, oder auch zum Schutz der Augen geschlossen. Besonders beeindruckend ist, dass diese Reaktion innerhalb von 50 bis 100 Millisekunden erfolgt. Dieses vollständige Reaktionsmuster sehen wir im Alltag zum Glück nicht so häufig, aber wir kennen es in abgeschwächter Form der hochgezogenen Schultern oder auch der Beugung des Oberkörpers, wenn wir uns in einer Situation unwohl fühlen. Es lohnt sich, im Alltag bewusst auf solche Muster zu achten.
Output: Aktionen, die das Gehirn vornimmt
Nachdem das Gehirn eine Entscheidung getroffen hat, initiiert es eine entsprechende Reaktion – den sogenannten Output. Nehmen wir als Beispiel die Entscheidung, beim Autofahren auszuweichen: Das Gehirn sendet motorische Signale an das Rückenmark, die über periphere Nerven die Muskeln in Schulter, Armen und Händen erreichen und so die gewünschte Aktion auslösen – in unserem Beispiel ein Ausweichmanöver. Ebenso können andere Output-Signale wie Augenbewegungen – etwa um das Bild im Seitenspiegel zu prüfen – oder Sprache oder Mimik aktiviert werden. Erkennt die Schaltzentrale zudem eine potenzielle Gefahr, löst sie die Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol aus, was den gesamten Körper in Alarmbereitschaft versetzt und den sympathischen Zweig des autonomen Nervensystems aktiviert.
Dies sind nur einige Beispiele von möglichen Reaktionen. Das Gehirn bestimmt aber noch mehr: Je nach Zustand des Nervensystems beeinflusst unser Gehirn, wie viel Kraft wir ausüben können, wie beweglich oder schnell wir sind, wie reibungslos und grazil wir eine Bewegung ausführen können. Ist unser Gehirn gestresst, kann es unseren Bewegungsradius einschränken, den Spannungszustand erhöhen oder dafür sorgen, dass wir Schmerzen spüren. Schmerz ist tatsächlich ein Output-Signal, das uns warnen soll oder dafür sorgt, dass sich unser Verhalten ändert.
Die Bewegungssteuerung unseres Körpers und unserer Augen beansprucht einen Großteil unseres Gehirns. Durch Bewegung können wir uns überhaupt erst anderen mitteilen (Sprache) und soziale Bindungen aufbauen (Mimik, Gestik), aber natürlich ermöglicht sie uns vor allem, uns zu orientieren (Augenbewegung) und uns selbst in Sicherheit zu bringen (Fortbewegung). Daraus wird offensichtlich, warum die Bewegung eine so große Rolle in unserem Leben spielt: Sie macht uns überhaupt erst zu dem, was wir sind. Und daher können wir auch über Bewegungstraining einen Großteil unseres Gehirns aktivieren, es stimulieren und wiederum Energie daraus gewinnen.
Alles, was unser Gehirn an Output erzeugt, führt wieder zu verändertem Input. So wird uns eine Augenbewegung neue visuelle Informationen liefern oder eine Armbewegung geänderte propriozeptive Informationen über unsere Armposition. Insofern können wir sagen, dass die Informationen in diesem Modell in einer permanenten Schleife miteinander verbunden sind.
KAPITEL 2
Das istneurozentriertesYoga
Neurozentriertes Yoga soll Bewusstsein darüber schaffen, was wir mit bestimmten Übungen in unserem Nervensystem bewirken. Darüber hinaus kreieren wir ein verstärktes inneres Vertrauen und setzen damit Potenzial für die eigene Entfaltung frei. In diesem Kapitel wirst du verstehen, wie du gezielt unterschiedliche Hirnareale adressieren kannst, um bestimmte Effekte zu erreichen und Körperfunktionen zu beeinflussen.
Neurozentriertes Training
Neurozentriertes Training ist eine moderne, wissenschaftlich fundierte Herangehensweise an Bewegungstraining, Leistungsoptimierung und Sporttherapie, die den Einfluss des Nervensystems auf unsere Bewegungen, unsere Wahrnehmung und unser Wohlbefinden betont. Es basiert auf den Erkenntnissen der Neurowissenschaften und der funktionellen Neurologie. Anders als traditionelle Trainingsansätze, die primär auf Muskeln, Gelenke oder das Herz-Kreislauf-System abzielen, wird das Nervensystem im neurozentrierten Training als zentrale Steuerinstanz des Körpers in den Fokus gerückt. So geht es im neurozentrierten Training darum, die Funktionalität und Effizienz der neuronalen Prozesse zu verbessern und die sensorischen und motorischen Systeme des Körpers zu trainieren. Als Schaltzentrale erhält unser Gehirn ständig Informationen über den eigenen Körper und über die Umgebung und verarbeitet diese, um Bewegungen zu planen und zu steuern. Wenn solche Informationen ungenau oder fehlerhaft sind oder deren Verarbeitung nicht effizient erfolgt, kann dies zu kompensatorischen Bewegungsmustern, Schmerzen oder Leistungseinbußen führen. Der Gedanke des neurozentrierten Trainings ist, dass wir das Zusammenspiel zwischen unseren Sinnen, dem Gehirn, den Nerven und Muskeln optimieren und damit unsere Leistung steigern oder auch Schmerzen minimieren. Klassischerweise wird im neurozentrierten Training insbesondere das visuelle System, das Gleichgewichtssystem und die Propriozeption (Körperwahrnehmung) trainiert, da diese Systeme uns wesentliche Informationen über die Umgebung und unseren Körper liefern und damit positiv auf unser Gefühl der Sicherheit einwirken. Wie du im weiteren Verlauf sehen wirst, ist das eigene Sicherheitsgefühl nicht nur essenziell für unser Überleben, sondern auch für das Wohlbefinden. Mit diesem Ansatz stellt das neurozentrierte Training im sportlichen und therapeutischen Bereich einen Paradigmenwechsel dar, denn es wird direkt dort angesetzt, wo Bewegung, Bewusstsein und Schmerz entstehen, nämlich im Gehirn.
Ein Paradigmenwechsel durch neurozentriertes Yoga