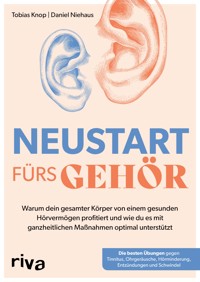
13,99 €
Mehr erfahren.
Ohren spitzen lohnt sich! Piepst, rauscht oder klingelt es in deinen Ohren? Hast du das Gefühl, manchmal nicht alles mitzubekommen, was um dich herum geschieht oder gesprochen wird? Plagen dich immer wieder Stress, Kopfschmerzen oder Schwindel? Dann solltest du dich dringend um deine Ohren kümmern! Denn sie sind essenziell für dein Wohlbefinden: Mit einem gesunden Gehör - bist du leistungsfähiger, - kannst du dich besser konzentrieren, - schläfst du erholsamer und - hast du ein stabileres, sichereres Körpergefühl. Die Heilpraktiker Daniel Niehaus und Tobias Knop zeigen dir, wie eng das Gehör mit dem gesamten Organismus verknüpft ist und wie sich eine Beeinträchtigung auf die mentale und körperliche Gesundheit auswirken kann. Um dem ganz einfach entgegenzuwirken, liefert das Autorenduo Tipps zu Ernährung, Lifestyle und Hygiene und stellt dir mithilfe moderner Illustrationen effektive Mobilisations-, Lockerungs- und Stimulationsübungen vor. Die daraus konzipierten Programme helfen ganz gezielt gegen unterschiedliche Beschwerdebilder wie Ohrgeräusche, Tinnitus, Hörminderung oder auch Entzündungen. So kannst du selbstständig und unkompliziert deine Hörfähigkeit verbessern und damit auch deine Lebensqualität steigern. Denn wer gut hört, ist länger gesund!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Tobias Knop | Daniel Niehaus
Neustartfürs gehör
Tobias Knop | Daniel Niehaus
Neustartfürs gehör
Warum dein gesamter Körper von einem gesunden Hörvermögen profitiert und wie du es mit ganzheitlichen Maßnahmen optimal unterstützt
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtige Hinweise
Dieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und die Autoren haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2024
© 2024 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Redaktion: Ulrike Reinen
Umschlaggestaltung: Sonja Stiefel
Umschlagabbildung: AdobeStock/channarongsds
Abbildungen im Innenteil: Illustrationen der Übungen von Katharina Borgs; alle anderen Abbildungen: AdobeStock/channarongsds: 8, 46, 74, 130; vladico: 10; deagreez: 11 o.; JrCasas: 11 u.; Axel Kock: 12, 15, 21, 30, 40, 81; Ольга Шефер: 14; yumiimage: 19; rob3000: 23; agnes: 27; Sebastian Kaulitzki: 32, 36, 38, 39, 158, 163; koti: 33, 35, 171; kyungmin: 34; digitale-fotografien: 37; okrasiuk: 41; magicmine: 45; New Africa: 49; Jonathan: 53; Krakenimages.com: 54; Alila Medical Media: 56; alexanderuhrin: 59; lom123: 60; Aleksej: 62; Krakenimages.com: 71; Antonioguillem: 103; WI: 119; 165, 167; jitendra jadhav: 169, Suman: 173
Satz: Bernadett Linseisen (schere.style.papier), München
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-2703-1
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-2463-1
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-2462-4
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Jetzt gibt's was auf die Ohren
Kapitel 1 Von der Ohrmuschel bis zum kleinsten Knochen im Körper
Das dreiteilige Ohr und die Beziehung zum Gehirn
Die Verbindungen zu anderen Körperstrukturen und -systemen
Kapitel 2 Die Ohren als Brücke zur Außenwelt
Hören ist Physik
Wie funktioniert das Hören?
An welchen weiteren Prozessen ist das Gehör beteiligt?
Wenn sich schlechtes Hören auf Körper und Geist auswirkt
Kapitel 3 Was greift die Ohren an und was sind die Folgen?
Einflüsse, die auf das Ohr einwirken
Die häufigsten Probleme, Erkrankungen und Beschwerden
Häufige Fehler und Mythen
Kapitel 4 Die besten Maßnahmen für gesunde Ohren
Kein isoliertes System
Prävention und Gesundung durch die richtige Ernährung
Die Tinnitus-Therapie
Top-Übungen für den Neustart deines Gehörs
Übungen für das Kiefergelenk und die Kaumuskulatur
Übungen für Halswirbelsäule, Schultern und Nacken
Übungen für die Kopfregion
Spezielle Übungen zur Verbesserung der Atmung
Die Programme im Überblick
Schlusswort
Übungsübersicht
Dank
Über die Autoren
Jetzt gibt's was auf die Ohren
»Hallo!? Haaaalloooo!« Plötzlich wird dir von hinten auf die Schulter gefasst und du erschreckst dich tierisch. Panisch nimmst du deine Noise-Cancelling-Kopfhörer ab und schaust die Person, die dich aus deiner Welt gerissen hat, wütend an. »Wieso erschreckst du mich so?!« Diese oder ähnliche Situationen hast du bestimmt selbst auch schon einige Male erlebt. Was ist daran jetzt so besonders? Das Beispiel aus dem täglichen Leben zeigt deutlich, wie es ist, wenn wir unsere Umwelt nicht mehr hören und vor allem auch, welchen Sinn unser Gehör eigentlich erfüllt. Dazu aber gleich mehr. Natürlich können wir mit unseren Ohren wunderschönen Symphonien, Tanzmusik, Naturgeräuschen und tiefgründigen Gesprächen lauschen, jedoch wird uns nur allzu selten bewusst, wie bedeutsam unsere Ohren und das Hören für unser Leben tatsächlich sind.
Die Bedeutung unseres Hörsinns wird uns nämlich im Grunde erst wirklich bewusst, wenn dieser nicht richtig funktioniert. Das kann heißen, dass wir nicht mehr alles hören oder aber auch, dass wir »zu gut« hören oder etwas hören, das wir eigentlich gar nicht hören sollten oder wollen. Hier sprechen wir zum einen von einer Überempfindlichkeit des Hörens, welche die Betroffenen wahrhaftig quälen kann, und von einer in der Gesellschaft sehr bekannten Diagnose: dem Tinnitus. Aber damit hört das Thema Ohr noch lange nicht auf. Neben der Schwerhörigkeit, dem Tinnitus und der oben angesprochenen sogenannten Überempfindlichkeit des Hörens gibt es unzählige andere Einflüsse, Situationen und Krankheiten, die eine gesunde Funktion dieses wichtigen Sinns beeinträchtigen.
Diese Leiden begegnen uns beiden (Daniel Niehaus und Tobias Knop) in unserer Praxistätigkeit als Heilpraktiker und Osteopathen täglich und stellen in der Therapie immer eine besondere Herausforderung dar, da unser Hörsinn von allen Sinnen wahrhaftig der komplexeste ist. Denn schon lange bevor wir auf die Welt kommen, hören wir im Bauch unserer Mutter ihren Herzschlag und ihre Stimme. Zu dieser Zeit sind die anderen Sinne, sprich das Sehen, Riechen oder Tasten, noch nicht wirklich ausgebildet.
Und wenn du dir einmal vor Augen führst, ob es dir gelingen kann, bewusst wegzuhören, fällt dir bestimmt auf, dass du eigentlich gar nicht nicht hören kannst. Es klappt einfach nicht, denn du kannst deine Ohren, anders als zum Beispiel deine Augen, nicht spontan verschließen. Um störende Geräusche nicht mehr zu hören, musst du schon absichtlich deine Ohren mit den Händen zuhalten, sie mit etwas verstopfen oder Fenster und Türen schließen. Dein Hörsinn ist der einzige deiner ganzen Sinne, der wirklich pausenlos im Einsatz ist und das auch nachts, obwohl du schläfst.
Aus Sicht der Evolution ist es ist wichtig, dass dein Hörsinn seine Aufgabe so ernst nimmt. Denn so wirst du frühzeitig vor Gefahren gewarnt und sicherst damit dein Überleben. Natürlich bist du kein Steinzeitmensch mehr, aber deine Biologie und Physiologie haben sich seit Tausenden von Jahren nicht ausschlaggebend verändert und reagieren immer noch genauso, als wenn du vor Säbelzahntigern weglaufen müsstest.
Dein Hörsinn ist jedoch nicht nur eine Eins-a-Alarmanlage, sondern hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der moderne Mensch überhaupt aufstreben und sich entwickeln konnte. Denn hätte der Mensch in der Urzeit nicht hören können, dann gäbe es für uns heute unter anderem keine Sprache und keine Musik. Unsere Welt hätte sich komplett anders entwickelt. Möglicherweise hätte sich die Menschheit auch gar nicht erst in der Evolution durchgesetzt.
Mit diesem Wunderwerk der Körpersinne möchten wir uns in diesem Buch mit dir zusammen beschäftigen. Wir nehmen dich mit auf eine Reise, beginnend mit schwingender Luft bis in die Tiefen deines Gehirns. Dabei ist im Kopf aber nicht Schluss: Auch das Zusammenspiel mit dem restlichen Körper und die Auswirkungen auf die Psyche möchten wir beleuchten. Denn klar ist, dass Körper, Geist und Seele unzertrennlich sind, und mit diesem Ratgeber ist es unser Ziel, dir einen ganzheitlichen Blick auf die Themen Ohren und Gehör zu geben und vor allem, wie du das Wissen aus unseren Erfahrungen in der Praxis für gesunde Ohren, aber auch für deine gesamte Gesundheit, nutzen kannst. Dieses Thema ist nämlich äußerst facettenreich, unglaublich interessant und sehr, sehr spannend.
Auf geht’s! Lass uns den Hörsinn einmal ganzheitlich unter die Lupe nehmen.
Kapitel 1
Von der Ohrmuschel bis zum kleinsten Knochen im Körper
Um die Bedeutung des Hörsinns mit all seinen Facetten zu verstehen, ist es essenziell, sich anzuschauen, wie das Sinnesorgan Ohr aufgebaut ist, wie es funktioniert und der Körper diese Aufgabe löst. In dir trägst du nämlich eine Art Empfänger und Reizverarbeitungssystem. Aber welche Reize denn überhaupt? Im Grunde handelt es sich hierbei lediglich um schwingende Luft. Um die Reise dieses Schalls kümmern wir uns als Erstes. Dazu schauen wir uns zunächst den Aufbau deiner Ohren an.
Das dreiteilige Ohr und die Beziehung zum Gehirn
Dein Ohr setzt sich insgesamt aus drei gut unterscheidbaren Anteilen zusammen: dem äußeren Ohr samt Ohrmuschel und Gehörgang, dem Mittelohr mit dem Trommelfell und den winzigen Gehörknöchelchen und dem Innenohr, welches mit Flüssigkeit gefüllt ist und die eigentlichen Sinneszellen enthält. Jeder dieser Anteile hat eine besondere Funktion, die dazu beiträgt, Schallwellen aufzufangen, zu verstärken und sie in elektrische Signale umzuwandeln, die dann von deinem Gehirn als Geräusche oder Töne interpretiert werden können. Im Grunde arbeiten alle deine Sinnesorgane wie Übersetzer. Es werden physikalische oder chemische Reize in für das Gehirn verständliche elektrische Botschaften umgewandelt. Aber eins nach dem anderen. Schauen wir uns erst einmal die verschiedenen Abschnitte des Ohrs genauer an, bevor du etwas über Durchblutung, die Nervenversorgung und die Verbindung zum Gehirn erfährst.
Der Aufbau des Ohrs
Die Reise des Schalls führt uns als erste Station zum äußeren Anteil des Ohrs. Dieser ist bei jedem Menschen gut sichtbar und wird im Volksmund als das eigentliche Ohr verstanden, obwohl es außen gerade erst anfängt.
Das äußere Ohr ist der sichtbare Anteil, charakterisiert durch die Ohrmuschel sowie den Einlass zum äußeren Gehörgang.
Das Außenohr – Ohrmuscheln und Gehörgang
Sobald der Schall auf deine Ohren trifft, begegnet dieser als Erstes den Ohrmuscheln und dem äußeren Gehörgang. Diese Einheit wird auch Außenohr genannt. Seine Hauptfunktion besteht darin, Schallwellen wie in einem Trichter einzufangen und weiter in Richtung des Trommelfells zu leiten. Die Ohrmuscheln sind, wie bereits erwähnt, der Teil des Ohrs, der von außen sichtbar und charakteristisch für dieses Sinnesorgan ist. Sie bestehen aus Knorpel und Haut. Die einzigartige, fast schon geniale Form ist dafür geschaffen, die Schallwellen bestmöglich einzufangen und zum Gehörgang zu leiten. Es ist auch die besondere Form und Ausrichtung der Ohrmuscheln, die es dir ermöglicht, Geräusche, die von vorn kommen, besser wahrzunehmen als Geräusche, die dich von hinten erreichen. Dieses Einsammeln und Fokussieren von Schall nennen wir Schallwahrnehmung, welche die Voraussetzung für dein selektives Hören und Zuhören ist. Das ist besonders in Gesprächen ein immenser Vorteil.
Um die Funktion der Ohrmuscheln zu verstärken, können wir mit unserer Hand hinter dem Ohr eine Art Trichter bilden.
Die Funktion der Ohrmuscheln wird vor allem bei Schwerhörigen sehr deutlich. Jeder von uns kennt das Bild eines Menschen, der seine Hand wie einen Trichter hinter sein Ohr legt und in Richtung des Sprechers ausrichtet, um besser hören zu können. Hiermit vergrößert er im Grunde seine Ohrmuscheln. Mit dieser künstlichen Hilfe werden Schallwellen nämlich noch besser eingefangen und störende Schallquellen, die von der Seite oder von hinten kommen, abgeschirmt. In den letzten Jahrhunderten wurde dieses Phänomen noch eindrucksvoller ausgenutzt, indem sogenannte Hörrohre entwickelt wurden.
Die Ohrmuscheln können also in Ergänzung zum vorherigen Beispiel auch dazu beitragen, laute Geräusche abzuschirmen und zu reduzieren, indem sie Schallwellen teilweise blockieren oder abschwächen, bevor sie das Trommelfell erreichen. So erzielen sie einen gewissen Schallschutz, um Gehörschädigungen durch übermäßige Lärmbelastung zu verringern.
Ein Hörrohr wurde im vergangenen Jahrhundert von schwerhörigen Menschen durch Erweiterung der Ohrmuschel als Hörhilfe benutzt.
Neben dieser wichtigen Funktion bieten die Ohrmuscheln auch einen Schutz für den Gehörgang und das Trommelfell vor verschiedenen potenziellen Gefahren und Schäden. Du kannst die Ohrmuschel als natürliche Barriere ansehen, da sie Fremdkörper wie Staub, Schmutz oder Insekten davon abhält, direkt in deinen Gehörgang einzudringen. Genauso hilft sie bei der Abwehr von Krankheitserregern, wie zum Beispiel Bakterien oder Viren, die somit nicht ohne Hürde in dein Ohr eindringen können. Wieder einmal durch ihre besondere Form schirmt sie Fremdkörper und Infektionen ab und hilft außerdem noch dabei, Schläge, Stöße oder Druck von außen abzupolstern, um dein Trommelfell und andere empfindliche Strukturen im Inneren deines Ohrs vor physischen Verletzungen zu bewahren.
Insgesamt spielt die Ohrmuschel also, wie du siehst, eine wichtige Rolle bei der Schallwahrnehmung und -ortung sowie beim Schutz der inneren, tieferliegenden Anteile deines Ohrs – vor potenziell schädlichen Geräuschen, Fremdkörpern sowie mechanischen Verletzungen und Infektionen.
Der äußere Gehörgang führt von der Ohrmuschel zum Trommelfell und ist mit sensibler Haut ausgekleidet.
An das äußere Ohr grenzt dann der Gehörgang. Dieser ist ein etwa zwei bis drei Zentimeter langer, gekrümmter Kanal, der mit Haut ausgekleidet ist und in der Tiefe zu deinem Trommelfell führt. Diese Haut im Gehörgang ist vergleichsweise dünner als die sonstige Haut und zudem sehr stark mit sensiblen Nerven versorgt. Diese Sensibilität sorgt dafür, dass Entzündungen oder Verletzungen im Gehörgang besonders schmerzhaft sind. Allein schon, wenn du dort einen Pickel hast, weißt du sicherlich, wie unangenehm schmerzhaft dieser sein kann.
Die Hauptfunktion deines Gehörganges besteht darin, den Schall zu leiten. Hörst du also im Frühling das erste wunderbare Gezwitscher der Vögel, treffen diese Geräusche von außen auf die Ohrmuschel und werden als Schallwellen durch den Gehörgang zum Trommelfell geleitet, wo sie dessen Schwingungen auslösen. Der Gehörgang spielt ebenfalls noch eine Rolle bei der Resonanz der Schallwellen. Durch die spezielle Form dieses Tunnels werden insbesondere diejenigen Frequenzen verstärkt, die für das Verstehen von Sprache wichtig sind.
Identisch zu der Schutzfunktion der Ohrmuscheln erfüllt auch der Gehörgang mitunter diese Aufgabe. Denn die Form und der Verlauf des Gehörgangs helfen dabei, Fremdkörper und Mikroorganismen davon abzuhalten, weiter in das Innere des Ohrs zu gelangen und dort Entzündungen und Infektionen hervorzurufen.
Über die besondere Form hinaus produziert der Gehörgang noch eine kleine Menge an Ohrenschmalz, auch Cerumen genannt. Dies ist eine wachsartige Substanz, die von besonderen Drüsen am inneren Ende des Gehörgangs gebildet wird. Das Ohrenschmalz wird wie über ein Fließband von der Haut nach außen abtransportiert.
Das meist gelblich-braun-orange Schmalz kann fester oder flüssiger sein und dient dazu, den Gehörgang zu schmieren und zu reinigen. Das hat den Effekt, dass kleinere Fremdkörper aus dem Ohr heraustransportiert werden. Außerdem hat das Ohrenschmalz noch eine desinfizierende Wirkung und tötet somit Bakterien oder andere Mikroorganismen im Gehörgang ab. Es hilft auch dabei, die Feuchtigkeit dort zu regulieren und das äußere Ohr vor Austrocknung zu schützen.
Das Ohrenschmalz betreffend können hier bereits erste gesundheitliche Störfaktoren auftreten. Zum Beispiel kann ein zu enger Gehörgang den Prozess der Selbstreinigung behindern. Auch trockene Haut, verursacht zum Beispiel durch Allergien oder Ekzeme, kann den Abtransport des Ohrenschmalzes aus dem Gehörgang heraus stören. Teilweise bildet sich sogar ein richtiger Pfropf, welcher den Gehörgang verlegt und somit das Hören beeinträchtigt, weil der Schall nicht mehr so gut zum Trommelfell vordringen kann.
Schon mal gehört?
Besser ohne Wattestäbchen
Eine der häufigsten Ursachen für Entzündungen des Gehörgangs und vor allem auch Verstopfungen durch Ohrenschmalz ist die Anwendung von Wattestäbchen, mit denen das Ohrenschmalz in der Regel sogar eher in den Gehörgang hineingeschoben als nach außen befördert wird. Außerdem wird dieser häufig noch platt gedrückt, was ebenfalls den Abtransport schwieriger gestaltet. Für einen gesunden Gehörgang und saubere Ohren ist die Nutzung von Wattestäbchen tatsächlich gar nicht notwendig, da es ein sich selbst reinigendes System ist, welches sich Mutter Natur ausgedacht hat.
Die Reinigung des äußeren Gehörgangs mit Wattestäbchen ist eine der häufigsten Ursachen für eine lokale Entzündung.
Durch den Gehörgang können zu guter Letzt auch Temperaturschwankungen ausgeglichen werden. Die Haut im Gehörgang enthält nämlich viele kleine Blutgefäße, welche die Temperatur regulieren und dazu beitragen, dass das Ohr warm bleibt oder überschüssige Wärme abgegeben wird, um zum Beispiel eine Überhitzung zu verhindern. Wir kennen alle das Phänomen von eiskalten oder glühenden Ohren.
Am inneren Ende des Gehörgangs stoßen wir dann an eine natürliche Grenze und den Übergang zwischen Außen- und Mittelohr. Das Tor zum Mittelohr stellt das Trommelfell dar – und dieses hat eine ganz besonders wichtige Funktion für deinen Hörsinn.
Das Mittelohr – Trommelfell, Gehörknöchelchen und Co
Der Schall ist nun von außen über die Ohrmuscheln und den Gehörgang zum Trommelfell gelangt. Dein Trommelfell sieht aus wie eine straff gespannte Haut. Es ist eine hauchdünne, leicht gewölbte Membran und ähnelt einer flachen, runden Scheibe oder einem kleinen Trampolin. Die Besonderheit: Es kann auch schwingen wie ein Trampolin. Von der Größe her kannst du es dir in etwa so groß wie den Nagel deines kleinen Fingers vorstellen.
Das Trommelfell schließt den äußeren Gehörgang ab und trennt somit das äußere Ohr vom Mittelohr. Diese Barriere schützt auch wieder das Mittelohr vor unangenehmen Eindringlingen wie Fremdkörpern, Bakterien oder anderen potenziellen Gefahren.
Beim Tauchen oder Fliegen ist das Trommelfell am Druckausgleich beteiligt, denn wenn sich der Druck außerhalb des Ohrs verändert, reagiert dein Körper adäquat über das Trommelfell und gleicht damit den Druckunterschied in Nuancen aus, um Schäden zu verhindern.
Hinter dem Trommelfell folgt das Mittelohr mit den drei Gehörknöchelchen und der Ohrtrompete.
Die entscheidendste Rolle spielt das Trommelfell aber für dein Gehör, da es die Schallwellen aufnimmt und sie in mechanische Vibrationen umwandelt, die dann von den nachfolgenden Gehörknöchelchen im Mittelohr verstärkt werden. Dein Trommelfell gerät also in ordentliche Schwingungen. Dieser Prozess ist der erste Schritt von vielen in der Umwandlung von physikalischen Schallwellen der Außenwelt in elektrische Signale, die von deinem Gehirn letztendlich interpretiert werden können.
Was ist aber jetzt genau das Mittelohr? Das Mittelohr ist eine luftgefüllte, von Schleimhaut ausgekleidete Höhle hinter deinem Trommelfell, welche die drei kleinsten Knochen des menschlichen Körpers beinhaltet, nämlich die Gehörknöchelchen. Diese spielen eine entscheidende Rolle bei der Weiterleitung der Schallwellen vom äußeren Ohr zum Innenohr. Insgesamt besitzt du auf jeder Seite drei solcher Gehörknöchelchen, die aufgrund ihres Aussehens ganz besondere Namen tragen: Hammer, Amboss und Steigbügel. Neben den Gehörknöchelchen gibt es im Mittelohr noch eine wichtige Struktur: die Eustachische Röhre, die für den Druckausgleich im Ohr zuständig ist. Allgemein ist der Raum des Mittelohrs in zwei Bereiche unterteilt. Im oberen Anteil befinden sich die Gehörknöchelchen, während im unteren Bereich die Eustachische Röhre zu Hause ist. Das Mittelohr wird in der Medizin auch als Paukenhöhle bezeichnet.
Nun aber der Reihe nach: Denn die allerkleinsten Knochen deines Körpers sind nicht unwesentlich daran beteiligt, dass du morgens deinen Wecker hören kannst und pünktlich zur Arbeit kommst. Wie ist das möglich? Das schauen wir uns jetzt einmal genauer an.
Stell dir vor, du liegst morgens nichts ahnend eingekuschelt in deinem Bett und träumst den schönsten Traum, bis plötzlich dein Wecker anfängt zu klingeln und du erschreckst. Nur selten wirst du positive Gedanken dabei empfinden, doch ohne die spezielle Funktionsweise deines Mittelohrs würdest du ziemlich sicher den Bus zur Arbeit oder den Start des Meetings verpassen.
Dieser Umstand liegt an der Fähigkeit des Mittelohrs, die Schallwellen, wenn diese auf das Trommelfell treffen, in eine Bewegung der Gehörknöchelchen umzusetzen. Diese sind nämlich gelenkig miteinander verbunden und der Hammer ist direkt an das Trommelfell angeschlossen. Der Hammer überträgt die Schwingungen des Schalls und die Vibrationen deines Trommelfells direkt auf den Amboss, der sie wiederum dann an den Steigbügel weiterleitet. Die Bewegungen dieser kleinen Knöchelchen sorgen für eine Verstärkung der Schallwellen, in diesem Fall das Klingeln deines Weckers, und leiten dieses allzu bekannte Geräusch an dein Innenohr weiter. Leider musst du nun aufstehen.
Hinzu kommt die Fähigkeit der Gehörknöchelchen, auf verschiedenste Frequenzen reagieren zu können. Dies bedeutet für dich, dass Hammer, Amboss und Steigbügel es dir ermöglichen, durch ihre Funktionsweise verschiedenste Tonhöhen wie hohe oder tiefe Töne zu erfassen und anschließend weiterzuverarbeiten. Deshalb ist auch ein hoher Klingelton deines Weckers kein Problem für deine Ohren.
Möglicherweise fragst du dich jetzt aber, warum der Schall nicht einfach ohne den Umweg über das Mittelohr an das Innenohr weitergegeben werden kann. Warum muss der Schall im Mittelohr überhaupt verstärkt werden? Die Natur hat sich selbstverständlich hierbei etwas gedacht. Entscheidend ist, dass sich der Schall im Außen- und Mittelohr in Luft bewegt und im Innenohr plötzlich auf eine Flüssigkeit trifft. Dies bewirkt, dass ohne die Verstärkung des Schalls durch die Gehörknöchelchen nur ein Bruchteil des Schalls im Innenohr ankommen würde. Dieses Phänomen nennt man Impedanzunterschied, den du sicherlich vom Untertauchen im Schwimmbad kennst, bei dem du die Geräusche von außerhalb des Wassers gedämpft wahrnimmst.
Um also diesen Verlust möglichst klein zu halten, verstärkt das Mittelohr den ankommenden Schall. Essenziell für die optimale Funktionsweise dieses Mechanismus ist der Größenunterschied zwischen dem Trommelfell und der winzigen Fußplatte des sowieso schon miniaturartigen Steigbügels. Als Folge dieses Größenunterschieds wird der durch den Schall ankommende Druck auf eine kleinere Fläche konzentriert und somit um ein Vielfaches erhöht und verstärkt.
Eine weitere sehr wichtige Besonderheit in der Paukenhöhle ist, dass sich dort zwei äußerst kleine Muskeln befinden, die mit den Gehörknöchelchen verbunden sind. Obwohl sie durch zwei unterschiedliche Nerven angesteuert werden, arbeiten sie in der Regel als Einheit zusammen. Denn sobald sie mit lauten Umgebungsgeräuschen konfrontiert werden, ziehen sie sich reflexartig zusammen.
Der eine der beiden Muskeln bewirkt eine Vorspannung des Trommelfells, weil er an dem mit dem Trommelfell festgewachsenen Hammer ansetzt und daran zieht. Dies hat zur Folge, dass das Trommelfell nicht mehr so gut schwingen kann. Der winzige Muskel wird über den sogenannten Trigeminusnerv versorgt, der uns im weiteren Verlauf dieses Ratgebers noch einige Male begegnen wird, weil er unter anderem für die Versorgung der Kaumuskulatur verantwortlich ist.
Der zweite Muskel im Mittelohr verdient sogar eine besondere Auszeichnung. Er ist nämlich der kleinste Muskel in deinem gesamten Körper und hat einen wichtigen Einfluss auf den Steigbügel, welcher ja die Verbindung zum Innenohr herstellt. Wenn sich dieser Minimuskel anspannt, zieht er den Steigbügel ein wenig vom Übertragungspunkt am Innenohr weg. Dieser Übergang zum Innenohr nennt sich das ovale Fenster. Der zuständige Nerv ist bei diesem Muskel der Fazialisnerv, welcher unter anderem auch deine Gesichtsmuskeln versorgt und es dir somit ermöglicht, lustige Grimassen zu ziehen.
Beide Muskeln bewirken auch, dass deine Gehörknöchelchen ein wenig ineinandergepresst werden und somit an Beweglichkeit einbüßen. Aber welchen Effekt hat dieser ganze Spaß in Miniatur jetzt? Laute Umgebungsgeräusche werden abgedämpft und schützen somit dein Gehör vor Schäden. Diese Funktion kannst du allerdings nicht bewusst steuern – das ist wichtig zu wissen. Leider sind es auch keine Muskeln, die du durch Training verbessern könntest, denn es handelt sich um automatische und unbewusste Vorgänge.
Entscheidend dafür, dass das Trommelfell aber überhaupt fernab der kleinen Muskeln richtig schwingt und somit den Schall verstärken kann, ist der gleiche Luftdruck im äußeren Gehörgang und im Mittelohr. Bei einer Abweichung entsteht ein Über- oder Unterdruck und das Trommelfell wird entweder nach innen oder nach außen gewölbt, was folglich die Schwingungsfähigkeit dieses Trampolins beeinträchtigt.
Für diesen Druckausgleich hat die Natur im Mittelohr eine weitere Struktur erfunden: die Eustachische Röhre. Diese Röhre wird auch Ohrtrompete genannt und stellt eine Verbindung zwischen dem Mittelohr und dem Nasen-Rachen-Raum dar. Sie ist dir bestimmt nur allzu gut aus dem Flugzeug bekannt, wenn dein Ohr scheinbar dicht macht und du es durch einen inneren Druckaufbau »ploppen« lassen kannst. Alles klingt gedämpft und der Druck auf den Ohren kann auch ein wenig schmerzhaft sein. Beim Tauchen tritt dieses Phänomen regelmäßig auf. Das hat damit zu tun, dass die Ohrtrompete nicht mit den schnellen Druckschwankungen hinterherkommt.
Beim normalen Sprechen öffnet sich die Ohrtrompete regelmäßig für einen kurzen Moment und bewirkt einen Druckausgleich. Aber auch zum Beispiel durch Schlucken oder Gähnen wird Luft durch die Eustachische Röhre in das Mittelohr geleitet, um den Druck auf beiden Seiten des Trommelfells auszugleichen. Außerdem können Kaugummikauen oder abschwellendes Nasenspray Abhilfe schaffen.
Eine weitere wichtige Funktion der Eustachischen Röhre mit ihrer Verbindung zum Nasen-Rachen-Raum ist es, das Mittelohr vor Infektionen zu schützen. Diese Verbindung ermöglicht nämlich den Abfluss von Flüssigkeiten und Sekreten aus dem Mittelohr, was das Risiko von Mittelohrentzündungen reduziert. Diese Funktion ist bei Kleinkindern leider noch nicht so gut entwickelt und daher rührt auch die Anfälligkeit für Mittelohrentzündungen in dieser Altersgruppe.
Die Ohrtrompete ist die Verbindung zwischen dem Mittelohr und dem Nasen-Rachen-Raum – sie sorgt für Druckausgleich.
Wie du gesehen hast, erfüllt das Mittelohr insgesamt mehrere sehr entscheidende Funktionen. Nicht nur die Weiterleitung von Schall und die Anpassung an verschiedenste Frequenzen spielen eine Rolle, sondern auch der mechanische Schutz des Innenohrs samt Schutzschild vor Infektionen sowie der Druckausgleich fallen in den Aufgabenbereich des Mittelohrs. All diese Funktionen sind entscheidend für die Aufrechterhaltung eines gesunden Hörvermögens.
Wie genau die Strukturen des Mittelohrs das empfindliche Innenohr vor mechanischen Schäden schützen, schauen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt genauer an, wenn es um das Thema Hörvorgang und den schädlichen Einfluss von Lärm geht. Vorerst gelangen wir zur nächsten Station, denn jetzt überträgt sich der eingehende Schall vom luftgefüllten Mittelohr auf das mit Flüssigkeit gefüllte Innenohr, welches mit seiner Form an ein besonderes Lebewesen erinnert.
Das Innenohr – eine Schnecke, ein Labyrinth und Haare im Ohr?
Dein Innenohr ist das Zuhause deines Hörorgans und auch deines Gleichgewichtsorgans. Diese beiden Organe liegen in einer Ansammlung knöcherner Höhlen, die miteinander im Austausch stehen; ihrer Gesamtoptik wegen werden sie auch als Labyrinth bezeichnet.
Uns interessieren vor allem aber zwei Teile dieses Labyrinths: die sogenannte Cochlea und die Bogengänge. Zu den Bogengängen kommen wir im weiteren Verlauf etwas detaillierter.
Bei der Cochlea, auch Hörschnecke genannt, handelt es sich um einen wenige Zentimeter langen Schlauch, der optisch stark an ein Schneckenhaus erinnert, weil er auf die gleiche Art aufgewickelt ist. Aber anstelle einer lebendigen Schnecke enthält dieser Schlauch Flüssigkeit, auch Endolymphe genannt.
Die Cochlea enthält die eigentlichen Sinneszellen deines Gehörs, die Haarzellen, die auf allerfeinste Schwingungen reagieren. Diese Haarzellen werden in zwei Gruppen unterschieden: fünf Reihen äußere Haarzellen und eine Reihe innere Haarzellen. Das ist wichtig, da beide Anordnungen spezifische Aufgaben erfüllen, zu denen wir dir später mehr erzählen werden. Die Haarzellen haben fingerartige, steife Membranausläufer, die als Stereozilien bezeichnet werden und somit kurzen Härchen ähneln. Daher die Namensgebung.
Jeder Mensch besitzt Tausende Haarzellen, was im Vergleich zu der Anzahl anderer Sinneszellen verschwindend gering ist. Im Auge hast du nämlich mehrere Millionen Sinneszellen. Hier wird dir im Vergleich betrachtet die Bedeutung jeder einzelnen Haarzelle bewusst: Werden diese äußerst raren Zellen geschädigt, haben wir nicht mehr so viele weitere, die den Job fortführen können.
Im Innenohr befinden sich die Cochlea und die Bogengänge, die mit Haarzellen ausgestattet sind, mit denen sie die mechanischen Reize des Schalls aufnehmen.
Ein weiterer wichtiger Aspekt für den Hörvorgang ist die Lage der Sinneszellen in der Schnecke. Hohe Frequenzen erregen zum Beispiel bereits die Haarzellen am Anfang der Schneckenwindung, während tiefere Frequenzen erst in der Nähe der Schneckenspitze für eine Stimulation der dort ansässigen Zellen sorgen. Wie das Hören genau funktioniert, erklären wir dir aber genauer im nächsten Kapitel. Was erst einmal für dich wichtig ist: Die Haarzellen wandeln die mechanische Energie der Schallwellen in elektrische Signale um, die dann über den Hörnerv zum Gehirn geleitet werden.
Das Innenohr beherbergt allerdings auch noch ein weiteres sehr wichtiges System deines Körpers: das Gleichgewichtsorgan. Dieses auch als vestibuläres System bezeichnete Organ besteht aus drei Bogengängen, einem Sacculus und einem Utriculus. Komische Namen, nicht wahr? Im Grunde handelt es sich hierbei lediglich um sackartige Aufweitungen. Dieses System liefert deinem Gehirn Informationen über die Position, die Bewegung und Lageveränderungen deines Kopfes. Es hilft dir dabei, Bewegungen koordiniert ablaufen zu lassen und natürlich dein Gleichgewicht zu halten. Schließlich möchtest du nur ungern dauernd den Bordstein küssen.
Das Gleichgewichtsorgan spielt außerdem eine wichtige Rolle bei der räumlichen Orientierung, sodass du immer weißt, wo oben und unten ist, ob etwas vor, hinter oder seitlich von dir steht. Bei deinem penetranten Wecker zum Beispiel ist das Innenohr maßgeblich daran beteiligt, dass du ihn nach dem ersten Klingeln zielgerichtet wieder in den Schlummermodus versetzen kannst, bis das Ganze lästigerweise wieder von vorn beginnt.
Durchblutung der Ohren
Egal welcher Teil des Körpers, jeder benötigt eine Versorgung mit Sauerstoff und weiteren Nährstoffen, um seiner Funktion nachgehen zu können. Diese Versorgung wird über dein Blut gewährleistet, das in einem immerwährenden Kreislauf durch deinen gesamten Körper gepumpt wird, also auch durch deinen Kopf und das Gehirn. Dabei werden die Weichteile und knöchernen Strukturen des Schädels aus einer Arterie – der äußeren Halsschlagader (A. carotis externa) – versorgt, während die Hirnanteile aus anderen Arterien ihr Blut bekommen, nämlich aus der inneren Halsschlagader (Arteria carotis interna) und aus der Wirbelarterie (Arteria vertebralis).
Die Durchblutung des Ohrs erfolgt über Blutgefäße aus dem Bereich der Halswirbelsäule, die in den Schädel aufsteigen.
Für dich ist erst einmal die Vertebralarterie von Bedeutung, denn sie verläuft entlang deiner Halswirbelsäule und steigt nach oben in deinen Schädel auf. Vertebra bedeutet nämlich Wirbel. Diese Blutversorgung stellt einen bedeutenden Zusammenhang zwischen deinem Nacken und einer gesunden Ohrfunktion dar und erklärt teilweise, warum Blockaden in der Halswirbelsäule auch Schwindel oder Ohrgeräusche auslösen können. Spannend, oder? Darüber wirst du später noch mehr erfahren.
Allgemein können wir hier festhalten, dass auch im Innenohr im Grunde eine Zweiteilung der Blutversorgung stattfindet. Das knöcherne Labyrinth wird von Folgegefäßen der A. carotis externa versorgt, während die weiter innen liegenden Anteile, mitunter auch die Hirnnerven, aus Ästen der A. vertebralis mit Blut durchströmt werden. Die Namen brauchst du dir natürlich nicht zu merken, es sei denn, du möchtest bei der nächsten Geburtstagsfeier mit Fachwissen prahlen. Allerdings ist es für das Verständnis schon von Bedeutung, woher das Blut in den Systemen des Ohrs eigentlich kommt.
Dort, wo Blut hinfließt, muss auch Blut wieder wegfließen. Dieser Rücktransport findet über die sogenannten Venen statt. Herrscht auf diesen Gefäßstraßen Stau, weil Abflüsse durch Blockaden oder Muskelverspannungen behindert werden, kann es auch zu Einschränkungen der Hör- oder Gleichgewichtsfunktion kommen. Welche Körperstrukturen hier möglicherweise Stress verursachen, schauen wir uns schon sehr bald einmal genauer an.





























