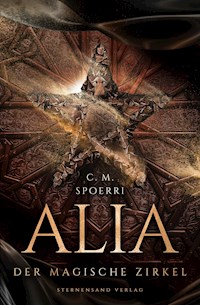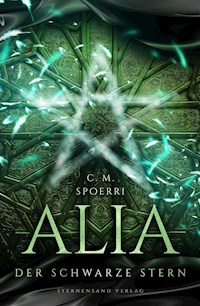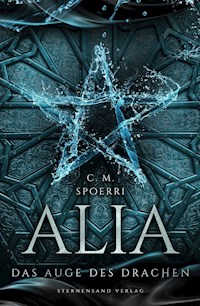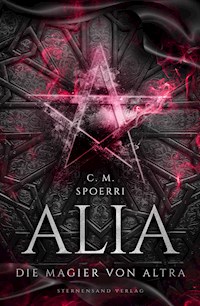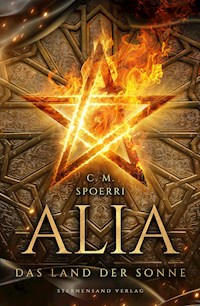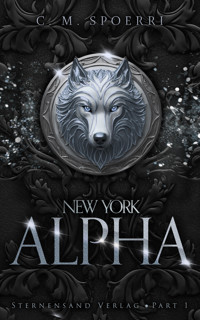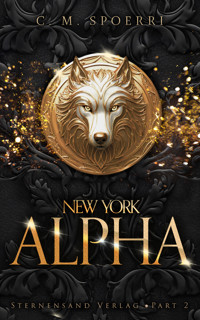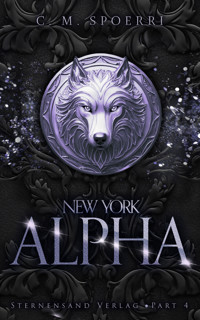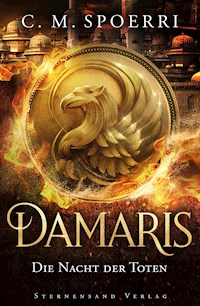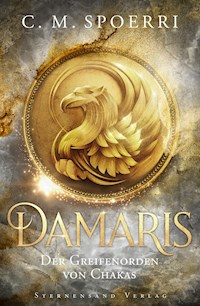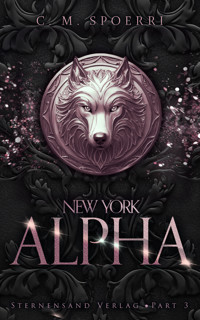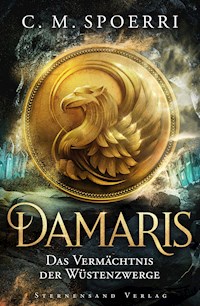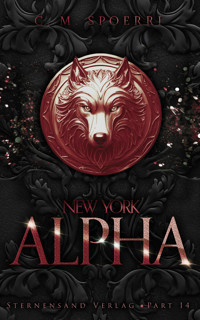
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sternensand Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ich weiß, wer ich bin. Was ich bin. Und … es zerfetzt mein Innerstes. Denn um wirklich Klarheit zu erhalten, muss ich etwas tun, das jedes Rudel der Welt auseinanderreißen würde. Kann ich das? Meine Bedürfnisse über diejenige stellen, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe? Denen ich vertraue und die meine Familie geworden sind? Ich muss. Denn nur dann bekomme ich endlich Wahrheiten. Nicht nur über mich, sondern auch über das Rudel. Selbst wenn das bedeutet, dass nie mehr wieder etwas so sein wird wie zuvor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Titel
Informationen zum Buch
Impressum
Kapitel 1 - Lena … Luna
Kapitel 2 - Lass mich dich tragen
Kapitel 3 - Seine Loyalität
Kapitel 4 - Seine Liebe
Kapitel 5 - Seine Dunkelheit
Kapitel 6 - Seine Freundschaft
Kapitel 7 - Ihre Verbundenheit
Kapitel 8 - Freitag
Kapitel 9 - Bist du bereit?
Kapitel 10 - Großer Gott …
Kapitel 11 - Das könnte funktionieren
Kapitel 12 - So gehorsam
Kapitel 13 - So geil
Kapitel 14 - Fick dich!
Kapitel 15 - Fick mich!
Kapitel 16 - Ich … bin bereit, Alpha
Kapitel 17 - Mein Rhythmus
Kapitel 18 - Zwei Alphas
Kapitel 19 - Nur ich selbst
Kapitel 20 - Wein, Baguette und Männergespräche
Kapitel 21 - Diese Nacht gehört mir
Kapitel 22 - Die Doppelpenetrationsbrücke von New York Alpha!
Kapitel 23 - Zurück in den Alltag
Kapitel 24 - Kampfbereit
Kapitel 25 - Wahrheit
Kapitel 26 -Eine Botschaft
Nachwort der Autorin
Nachwort von Adrian
Bonus: Giovannis Gegenstück
C. M. Spoerri
New York Alpha
Part 14
Urban Fantasy / Omegaverse / Reverse Harem
New York Alpha (Part 14)
Ich weiß, wer ich bin. Was ich bin. Und … es zerfetzt mein Innerstes. Denn um wirklich Klarheit zu erhalten, muss ich etwas tun, das jedes Rudel der Welt auseinanderreißen würde. Kann ich das? Meine Bedürfnisse über diejenige stellen, mit denen ich so viel Zeit verbracht habe? Denen ich vertraue und die meine Familie geworden sind? Ich muss. Denn nur dann bekomme ich endlich Wahrheiten. Nicht nur über mich, sondern auch über das Rudel. Selbst wenn das bedeutet, dass nie mehr wieder etwas so sein wird wie zuvor.
Die Autorin
C. M. Spoerri wurde 1983 geboren und lebt in der Schweiz. Sie studierte Psychologie und promovierte im Frühling 2013 in Klinischer Psychologie und Psychotherapie. Seit Ende 2014 hat sie sich jedoch voll und ganz dem Schreiben gewidmet. Ihre Fantasy-Jugendromane (›Alia-Saga‹, ›Greifen-Saga‹) wurden bereits tausendfach verkauft, zudem schreibt sie erfolgreich Liebesromane. Im Herbst 2015 gründete sie mit ihrem Mann den Sternensand Verlag.
www.sternensand-verlag.ch
1. Auflage, September 2025
© Sternensand Verlag GmbH, Zürich 2025
Umschlaggestaltung: Jasmin Romana Welsch
Lektorat / Korrektorat: Sternensand Verlag GmbH
Satz: Sternensand Verlag GmbH
ISBN (epub): 978-3-03896-364-6
Alle Rechte, einschließlich dem des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten.
Dies ist eine fiktive Geschichte. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Kapitel 1 - Lena … Luna
Helena
Ich bin umgeben von fünf Männern. Meinem Rudel. Vier Betas und meinem Alpha – und trotzdem habe ich das Gefühl, allein zu sein.
Ich sitze auf einem der weißen Sofas im Wohnzimmer des Penthauses, die Beine untergeschlagen, die Arme um mich geschlungen, während Dylans Stimme den Raum erfüllt.
Er berichtet, was in der alten Oper geschah. Was Raven Stone uns erzählte – mit ruhiger Stimme, sachlich. Ein Beta wie ein Fels in der Brandung, der gerade gegen die Wellen besteht, die um ihn toben.
Aber ich höre nur Fetzen. Satzteile. Seine Worte gehen unter in dem Blizzard, der in meinem Inneren wütet.
Luna.
Das Wort hallt durch meinen Schädel wie ein Echo, das nicht abebben will.
Ich bin eine Luna.
Nicht einfach eine Omega. Nicht einfach eine von vielen.
Ich bin … anders.
Etwas, das nicht existieren sollte, etwas, das sogar Alphas herausfordern kann. Einschüchtern. Bedrohen. Und vernichten.
Maria hat ihr Rudel getötet, weil ihr Wolf nach ihrer Hitze zu stark wurde. Raven hat es mir erzählt. Hat mich gewarnt. Hat mir ins Gesicht gesagt, was in mir lauert. Etwas, das ich nicht kontrollieren kann. Noch nicht. Etwas, das Adrian zerstören wird, wenn ich nicht lerne, es zu bändigen.
Mein Blick schweift durch den Raum, als suchte ich nach einem Fluchtweg. Aber ich kann nicht vor mir selbst fliehen – wie auch … ich bin ich.
Eine Luna.
Cameron sitzt auf der Sofalehne neben mir, sein Blick klebt an meinem Gesicht, als könnte er dort lesen, wie er mir helfen kann. Sonst ist er ein Scherz auf zwei Beinen, aber jetzt? Jetzt ist da nur blankes Entsetzen in seinen goldbraunen Augen. Nein … schlimmer: Angst.
Sebastian steht an der Fensterfront, die Arme verschränkt, die Schultern verkrampft. Ich kenne ihn als den Pausenclown, der mit seinem Charme um sich schmeißt wie andere mit Konfetti. Der in jeder Situation einen Spruch auf den attraktiven Lippen hat, ein spitzbübisches Leuchten in seinen azurblauen Iriden. Aber er schweigt. Starrt den Alpha an. Mich. Den Alpha. Dylan. Mich.
Elyas hat sich in einen der Sessel fallen lassen. Der Künstler-Beta mit dem schelmischen Lucifer-Lächeln hat seine Gentleman-Contenance komplett verloren, als hätte jemand ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Als könnte er kaum glauben, was Dylan gerade berichtet.
Und Adrian? Er steht. Mitten im Raum. Regungslos wie eine Statue, nur seine Augen glühen wie pures Gold. Hell. Lodernd. Er könnte das ganze Gebäude in Brand setzen, wenn er wollte.
Er sieht mich nicht an, sein Blick haftet auf Dylan, der ruhig zu Ende spricht.
Doch ich spüre Adrians Präsenz auf meiner Haut wie ein Gewicht, das mich niederdrückt. Ich spüre, wie sein Wolf mich prüft. Ob ich noch die bin, die er liebt. Oder etwas anderes. Etwas … Gefährliches.
Ich senke den Kopf, meine Finger krallen sich in meine Haut. So fest, dass es wehtut, aber ich registriere den Schmerz kaum.
Lena.
Luna.
So nah beieinander, dass es fast lächerlich ist. Wie ein Vorzeichen. Ein unausgesprochener Hinweis, den niemand von uns verstanden hat.
Bis jetzt.
Ich war immer Helena Adams. Omega. Assistentin. Adrian Rinaldis Spielzeug. Seine Partnerin. Seine Liebe. Seine.
Aber was bin ich jetzt?
Ein Risiko. Eine tickende Zeitbombe. Die Frau, die ihren Alpha verlieren wird, egal welchen Weg sie geht.
Wenn ich mit Fynn Hansen schlafe … verliere ich Adrians Vertrauen.
Wenn ich es nicht tue … verliere ich die einzige Chance, meinen Wolf kontrollieren zu lernen. Mein Rudel vor ihm zu schützen.
Maria hat ihre Familie zerstört, weil sie zu lange gewartet hat.
Und ich? Ich weiß nicht einmal, wie lange ich noch habe. Wann meine nächste Hitze genau starten wird. Wann Chi zum Jungwolf wird, der seinen Alpha herausfordern – und töten will.
Nein … nein, das darf nicht geschehen.
Ich spüre, wie Tränen sich in meinen Augen sammeln, und blinzle sie unwirsch fort.
Ich bin kein Risiko, ich liebe die fünf Männer um mich herum – und auch den, der nicht hier sein darf, weil Adrian ihn auf Zeit aus dem Penthaus verbannt hat. Dennoch ist er bei mir. In meinem Herzen, so wie sie alle. Wie mein ganzes Rudel, das ich beschützen muss. Auch vor mir und meinem Wolf.
Ich bin immer noch ich. Helena. Doch … ich habe keine Ahnung, wie ich überleben soll.
Dylan beendet seinen Bericht. Es folgt eine Stille, so laut, dass mein Herz dagegen anschreit. Es ist keine nervöse, gespannte oder schweigende Stille. Sondern diese Art von Stille, in der man hören kann, wie Gedanken explodieren. Wie Gewissheiten bröckeln. Wie jedes einzelne Rudelmitglied in Echtzeit versucht, das zu begreifen, was da gerade in ihrem Wohnzimmer, auf ihrem Sofa sitzt.
Eine Luna.
Ich.
Alle Augen sind auf mich gerichtet. Ein Alpha, vier Betas. Und ich … zersplittere unter ihrer Musterung wie Glas, auf das Steine treffen.
Ich schlucke schwer, winde die Finger umeinander, während ich stur aufs Parkett starre. Heller Ahorn, makellos. Im Gegensatz zu mir. Ich bin alles andere als makellos, wenngleich das Fell meines Wolfes schneeweiß ist.
»Was … was zum Teufel ist eine Luna?«, durchbricht Sebastian als Erster die Stille. Seine Stimme klingt brüchig und rau. »Ich meine … haben wir je davon gehört? Gibt’s das überhaupt?«
»Noch nie gehört«, sagt Elyas sofort. »Nie.«
»Weil sie sich im Verborgenen halten«, erwidert Dylan sachlich. »Weil sie zu gefährlich wären. Raven hat es angedeutet: Eine Luna kann Alphas dominieren. Kontrollieren. Die natürliche Hierarchie … umkehren.«
Ein Schaudern geht durch die Runde, ich spüre es förmlich an meinem Körper. Ihre Schwingungen sind unruhig, aufgewühlt, entsetzt. Sie erdrücken mich damit.
Ich registriere Camerons Blick auf mir. Er ist stumm, obwohl er nie schweigt. Er flirtet, lacht, provoziert. Aber jetzt? Da ist nichts. Nur sein Blick. Diese Mischung aus … Mitleid und etwas anderem. Misstrauen?
Mir wird schlecht.
»Du …«, beginnt Sebastian und ich spüre seine Augen, die sich auf mich fokussieren, wenngleich ich ihn nicht ansehe. »Du würdest uns doch niemals was antun, oder?«
Ich zucke zusammen, seine Worte treffen mich wie Granatsplitter.
Langsam hebe ich den Kopf, schaue in sein attraktives Gesicht. »Nein«, flüstere ich. Schwach. Hilflos. »Niemals.«
»Aber … du könntest es«, murmelt Elyas. Es ist nicht böse gemeint, auch nicht anklagend. Sondern eine Tatsache.
»Ich … ich habe keine Ahnung, was ich könnte oder nicht«, sage ich mit zittriger Stimme. »Ich weiß nur, dass ich mich nicht verändert habe. Ich bin immer noch Lena. Eure Lena.«
»Nur eben mit einem potenziell mörderischen Superwolf in der Brust«, kommentiert Cameron trocken.
Dylan schnaubt leise. »Cam …«
»Nein.« Der jüngste Beta schüttelt den Kopf. »Ich will nicht sagen, dass sie schuld ist. Aber … ich habe jahrzehntelang unter einem Alpha gelitten, der dachte, er sei Gott. Und jetzt? Jetzt sagt mir jemand, meine Omega sei vielleicht mächtiger, als er es je war?«
Tränen steigen mir erneut in die Augen. Ich will sie nicht zeigen. Nicht hier. Nicht jetzt. Nicht vor ihnen.
Ich will nicht ihre Angst sein, will nicht … ein Fehler sein. Das Zahnrad, das nicht in die Uhr passt, das alles lahmlegt und deshalb zerstört werden muss.
Ich versuche, etwas zu sagen, zu erklären, dass ich es selbst nicht verstehe, dass ich doch genauso überfordert bin wie sie.
Aber bevor ich den Mund öffnen kann, bewegt sich Adrian. Sein Schatten fällt über mich. Groß und dunkel. Mächtig.
Langsam geht er um das Sofa herum, stellt sich vor mich und sein Blick verankert sich in mir. Als ich ihn anschaue, sehe ich keinen Zorn in seinen goldenen Augen. Nur … eine Tiefe, die mich erschreckt.
»Was auch immer du bist«, sagt er ruhig. »Du bist meine Omega. Und niemand – ich wiederhole: niemand! – wird dir etwas antun, ohne dass ich ihm die Kehle aufreiße.«
Ich zittere ob seiner Eindringlichkeit und der Loyalität, die er ausstrahlt. Meine Tränen rinnen jetzt ungehindert über meine Wangen.
»Sag es«, befiehlt er leise.
Ich starre ihn an. »Was?«
»Sag es mir, Lena. Sag, dass du mein Rudel nicht zerstören wirst.«
»Ich liebe dich, Adrian«, flüstere ich. »Ich bin keine Gefahr. Nicht für dich. Nicht für unser Rudel. Ich bin nur … ich bin nur … ich.«
Er sieht mich lange an, dann geht er in die Hocke und legt beide Hände auf meine Knie. »Wir werden lernen, damit umzugehen, was du bist«, sagt er rau. »Gemeinsam. Als Rudel.«
Ich presse die Lippen zusammen, die Tränen verschleiern meine Sicht.
»Du bist mein Herz, Lena«, murmelt er und hebt eine Hand, streicht mir über die tränennasse Wange. »Ob Omega. Ob Lena. Ob Luna. Ob Chaos auf zwei Beinen. Ich liebe dich.«
»Ich … bin alles davon«, hauche ich erstickt.
Ein Lächeln zuckt an seinen Mundwinkeln. »Dann scheiß auf den Rest der Welt.«
Damit beugt er sich vor und presst seine Lippen auf meine, küsst mich mit so viel Zuneigung, dass ich vergesse zu atmen.
Mein Herz zerreißt. Vor Erleichterung. Vor Angst. Vor Liebe. Vor Ungewissheit.
Aber ich weiß in diesem Moment: Ich bin vielleicht ein Risiko, doch ich bin nicht allein. Nicht, solange er mich so küsst.
Kapitel 2 - Lass mich dich tragen
Adrian
»Du willst also wissen, ob es eine andere Lösung gibt und ich sie finde.« Dylans Stimme ist ruhig und tief wie immer, aber seine Augen sprechen Bände. Die Nachricht über Helenas Wesen hat ihn ebenso erschüttert wie jeden von uns.
Ich stehe vor ihm im Arbeitszimmer meines Penthauses. Wie ich es so oft tue, wenn ich mit Dylan alleine reden muss. Wenn ich seinen Rat brauche. Seinen Halt.
»Ja«, bestätige ich langsam. »Sag mir, dass es einen Weg gibt, ohne dass …« Ich beende den Satz nicht, denn Dylan weiß, was ich andeuten will.
Er sieht mich an. Wie ein Bruder. Mit denselben Augen, die damals im Zweiten Weltkrieg auf mich blickten, als Granaten über unsere Köpfe pfiffen und das Brüllen von Verwundeten in unseren Knochen nachbebte.
Auch jetzt herrscht Krieg. Zumindest fühlt es sich so an.
»Ich habe alles versucht«, antwortet er. »Wirklich alles, Boss. Ich habe Kontakte angezapft, Datenbanken durchkämpft, private Netzwerke, alte Rudel-Register, selbst die verschlüsselten Jägerarchive – Maria existiert nicht.«
Ich sinke auf einen der Sessel, das Leder knarrt unter meinem Gewicht.
»Fuck«, knurre ich und lasse die Verzweiflung zu. Ich kann sie zulassen, weil Dylan mich sehen darf – in all meiner Unsicherheit. »Sie will, dass Lena mit Fynn schläft …« Ich spucke die Worte aus wie Gift. »Nur dann bekommen wir Antworten. Nur dann erfahren wir, wie sie Chi kontrollieren kann, bevor …«
Ich breche ab.
Bevor sie uns auseinanderreißt. Bevor ich gezwungen bin, gegen sie zu kämpfen. Bevor mein Herz aufhört, sie zu erkennen, weil ihr Wolf mich tötet. Oder ich sie.
Dylan lehnt sich vor, die Hände aneinandergelegt, wie immer, wenn er nachdenkt. »Du kannst es nicht verhindern, Adrian«, sagt er leise. »Du kannst sie nicht davor beschützen. Nicht dieses Mal.«
Ich spüre, wie meine Fingernägel sich in die Armlehnen graben. »Sie gehört mir, Dylan. Ich habe sie in mein Rudel aufgenommen. Habe für sie gekämpft. Für sie geblutet. Ich habe sie erobert. Ich gebe sie nicht her!«
»Ich weiß«, sagt er leise. »Ich … weiß.«
Ich fahre mir mit der Hand übers Gesicht. »Ich kann das nicht, Dylan … Ich kann sie nicht einem anderen geben. Dabei zusehen, wie er sie nimmt. Wie er sie anfasst. Vielleicht sogar markiert … das geht nicht … mein Wolf …« Meine Stimme bricht.
»Er wird sie nicht an sich binden«, erwidert Dylan eindringlich. »Weil er es nicht kann. Sie ist eine Luna, Adrian. Wenn Raven recht hat – und wir beide wissen, dass dem so ist –, dann wird sie niemandem gehören. Nicht dir. Nicht Fynn. Nur sich selbst.«
Ich schließe die Augen, denn seine Worte tun mir mehr weh als jede Wunde, die ich jemals ertragen musste. Lieber würde ich hundert Peitschenhiebe über mich ergehen lassen, als diese Wahrheit in mir zu dulden: Helena gehörte mir nie. Nie wirklich. Zu keinem Zeitpunkt – mochte er sich noch so gut angefühlt haben, noch so richtig.
Fuck, verdammte Scheiße!
Mein Wolf tobt in mir, will das nicht hören. Will das nicht zulassen, geschweige denn akzeptieren. Und dennoch weiß ich, dass es so ist.
Helena gehört mir nicht.
Egal, wie oft ich sie ficke, egal, wie sehr ich sie dominiere, wie viele meiner Markierungen sie auf ihrem Nacken trägt.
Sie wird mir niemals gehören … weil sie eine Luna ist. Eine verdammte Luna, die sich keinem Alpha beugt. Selbst wenn Helena mich liebt und sich bemüht, sich mir zu unterwerfen – ihr Wolf tut es nicht. Tat es nicht. Wird es niemals tun.
Verfickt noch mal!
»Und wenn …«, beginne ich heiser. »Wenn ich es ihr verbiete? Wenn ich sie … wegsperre. Beschütze. Von der Welt abschirme. Sie … verstecke?«
»Dann stirbt sie. Oder du. Oder wir alle.«
Ich reiße die Augen auf. Dylan sieht mich an. Klar. Fest. Ohne Urteil.
»Adrian«, fährt er fort. »Wenn du ihren Wolf verleugnest oder schwächen willst durch Kontrolle oder Angst … dann verlierst du sie. Entweder an die Dunkelheit in ihr oder an sich selbst.«
Ich kann nicht länger sitzen – ich stehe auf und gehe zur Fensterfront. Blicke hinaus auf das Lichtermeer, das Manhattan heißt. Auf die Stadt, in der ich ein verdammter König bin. Und meine Königin, die ich an meiner Seite wähnte, ist gerade dabei, ihren eigenen Weg zu gehen. Ohne dass ich sie aufhalten kann. Ohne dass ich sie beschützen kann.
»Ich soll also zulassen, dass sie mit einem anderen Alpha schläft.« Ich beiße die Zähne zusammen. Jeder Muskel in mir schreit, mein Wolf brüllt vor Schmerz.
Ich atme einmal tief ein. Dann aus.
»Ich … weiß nicht, ob ich es kann«, gestehe ich, ohne mich zu Dylan umzudrehen. »Wenn Fynn sie verletzt …«
»Wir müssen das nicht heute besprechen«, unterbricht mich Dylan und ich spüre seine Hand auf meiner Schulter. Er ist zu mir getreten, steht dicht hinter mir. »Du hast noch ein paar Tage Zeit, es dir zu überlegen und … zu akzeptieren.«
Ich nicke, ohne mich zu ihm umzudrehen.
Seine Lippen pressen sich auf meinen Nacken und ich lehne mich nach hinten gegen den Kuss, der mich erdet. Mir Halt gibt.
»Danke.« Das Wort ist kaum ein Hauch, aber Dylan versteht, was ich damit meine.
Seine Lippen verweilen auf meinem Nacken. Nicht verlangend, kein Angebot, eine Antwort. Auf alles, was ich nicht sagen kann oder nicht einmal denken will.
»Wenn du möchtest …«, sagt er, ohne den Satz zu beenden.
Ich schließe die Lider. »Ich will nichts spüren, was nicht nach ihr schmeckt«, raune ich.
»Dann tun wir es nicht wegen dir. Sondern für dich.«
Ich drehe mich um und schaue ihn an. Dylan, mein erster Beta, den ich in der Normandie fand. Mein Schild. Mein Spiegel. Der Mann, der meine Abgründe kennt und nie zurückgeschreckt ist. Weder vor mir noch vor meinem Wolf.
Seine grünbraunen Augen schauen ruhig in meine, sein Blick ist keine Forderung, er ist eine Brücke, wenn ich keinen Boden mehr habe.
»Ich …« Ich weiß nicht, was ich überhaupt sagen will, daher presse ich die Lippen zusammen.
Er hebt die Hand, legt sie an meinen Hinterkopf und zieht mich gegen seine Schulter. Ich lehne die Stirn an ihn, atme seinen vertrauten Geruch ein.
David Moreau.
Domenico Sorrentino.
Dylan Montgomery.
Mein Fels.
Mein Halt.
Mein verdammter Anker.
Ich kralle meine Hände in den Stoff seines schwarzen Shirts, als würde ich sonst alles verlieren. Ich spüre seine Wärme, seinen Herzschlag, das leise Schnurren seines Wolfes. Wie früher, als wir Seite an Seite im selben Schützengraben lagen. Als ich nicht wusste, ob der nächste Tag noch kommt. Und seine Nähe das Einzige war, was mich daran erinnerte, dass ich noch lebte.
»Ich liebe sie«, sage ich rau. »Ich liebe sie so sehr, dass es mich zerreißt.«
»Ich weiß«, murmelt er an meinem Ohr und küsst mich sanft auf den Hals. »Du musst das nicht alleine tragen, Adrian.«
Seine Hände gleiten über meinen Rücken, massieren langsam die Anspannung aus meinen Schultern. Nicht sexuell. Nicht lüstern. Sondern mit einer Intimität, die tiefer geht.
Er kennt meinen Körper besser als jeder andere. Kennt die Narben, die Punkte, an denen mein Wolf leise heult.
Er küsst meine Schläfe und ein heiserer Laut entweicht mir. Etwas zwischen Stöhnen und Seufzen.
»Sag, wenn ich aufhören soll«, raunt er.
»Nicht aufhören.«
Er streicht weiter über mich. Ich lege die Hand an seinen Nacken und ziehe ihn zu mir heran und küsse ihn. Langsam. Intensiv. Festhaltend.
Es ist nicht Helena, aber es ist … gut. Für den Moment.
Er küsst mich zurück mit einer Tiefe, die mich zerreißt und gleichzeitig zusammenfügt. Unsere Zungen streichen übereinander, es ist kein Feuerwerk, vielmehr ein unerschütterlicher Beweis unserer Zuneigung. Alpha und Beta. Eine Einheit, die gegen alles bestehen kann. Hoffentlich auch gegen eine Luna.
Seine Finger gleiten unter mein Hemd, berühren meine Haut, meinen Schmerz, meine Wut. Ich lasse mich zurücksinken und lehne mich ans Fenster, während er vor mir auf die Knie geht.
Er blickt zu mir auf. »Lass mich dich tragen, Boss.«
Ich senke den Blick und nicke. »Danke«, wiederhole ich, während er meine Hose öffnet.
Ich schließe die Augen und gebe mich ihm hin. Gebe ihm meinen Körper, meine Last.
Er berührt meine Erektion mit den Händen, den Lippen, der Zunge. Leckt langsam an mir, als wäre ich das Beste, das er je gekostet hat. Er verwöhnt meine Eichel, knabbert am Rand, saugt sanft daran.
Das Stöhnen kommt tief aus meiner Kehle, ich kralle die Finger in sein schwarz gefärbtes Haar, leite seine Bewegungen, bestimme die Tiefe, mit der er mich nimmt. Er küsst mich, leckt mich, lutscht an mir. Seine Zunge ist überall, seine Finger kneten meine Hoden, berühren die Stellen, die mir guttun.
Es ist ein Rausch, den er in mir entfacht, und der mich fortträgt von allem, was mich gerade beschäftigt.
Mein Becken bewegt sich ruckartig, ich halte seinen Kopf fest, stoße hart in seinen Mund. Schnell. Unnachgiebig, im Takt meiner Lust.
Er hält mich aus. Duldet mich. Trägt mich.
Dylans Lippen ruhen auf meinem Schwanz wie ein Versprechen, das mich nicht rettet, aber mir das Durchhalten erleichtert. Ich spüre jeden Atemzug von ihm, jeden Finger.
Und mein Kopf wird leer.
Ich bin Alpha. Rinaldi. Der Mann, der Manhattan lenkt, der ein Rudel mit einem Blick zur Raison bringt und anderen Alphas die Stirn bietet. Aber gerade jetzt … jetzt bin ich Adrian.
Adrian, der atmen kann. Dank Dylan, der mich erdet. Der mir hilft, mir ein Ventil liefert.
Ich kann nicht schreien, wenngleich ich möchte. Ich möchte die Nacht anbrüllen. Den Mond. Den Himmel. Das verdammte Schicksal. Möchte verlangen, dass sie mir gehört. Nur mir.
Doch ich weiß, dass ich das nicht darf. Ich muss sie teilen, um sie behalten zu dürfen.
Ein Paradox, das mich zerreißt.
Dylan saugt an mir, lutscht, nimmt meinen Samen. Schluckt und macht weiter. Immer weiter. Er massiert meinen Knoten, massiert alles weg, was ich habe. Was ich bin. Was ich denke.
Ich verliere mich.
Nicht in Lust.
In ihm.
In der Berührung, die nicht nach Besitz verlangt. In der Nähe, die kein Zeichen setzt, kein Echo braucht. In der Hingabe eines Mannes, der mich kennt, wenn ich mich selbst nicht mehr spüre.
Dylans Lippen, sein Atem, seine feuchte Wärme …
Ich stoße in ihn, mit einer Verzweiflung, die keine Erlösung sucht, sondern nur Stille. Ich will das Brennen. Will den Druck. Will, dass etwas mich wieder zusammenpresst, während alles in mir auseinanderfliegt.
Jeder Gedanke an sie – ihre Haut, ihre Tränen, ihr ›Ich bin nur ich‹. Jeder Schlag meines Herzens ist ein Beweis dafür, dass ich es nicht schaffe. Dass ich ihr Alpha bin – und sie doch nie die Meine war.
Mein Atem ist rau, meine Bewegungen fordernd. Hart.
Dylan nimmt es. Nimmt alles. Weil er weiß, dass ich sonst breche.
Jeder Stoß ist ein Fluch auf das Schicksal. Jede Zuckung meiner Hüfte ein Protest gegen das, was es mir gibt – nur, um es mir wieder zu nehmen.
Ich komme nicht, um zu genießen. Ich komme, um zu vergessen. Immer und immer wieder, bis ich schweißüberströmt bin. Mein Atem geht keuchend, mein Herz pocht wild in meiner Brust, aber ich spüre mich wieder. Spüre mich dank Dylan.
Meine Finger krallen sich fester in Dylans Haar, mein Kopf sinkt zurück gegen das Glas der Fensterfront, das eiskalt auf meine erhitzte Haut trifft.
Ich presse die Augen zusammen, halte mich fest an der Dunkelheit hinter meinen Lidern, während die Hitze in mir aufsteigt, mich überrollt, mich mit sich reißt wie eine Flut, die zu lange aufgestaut war.
Ich komme ein letztes Mal. Hart. Heiß. Tief. Wild.
Ein animalischer Laut dringt aus meiner Kehle. Kein Stöhnen. Kein Seufzen. Ein Brüllen.
Und dann … Stille.
Mein Herz hämmert, meine Muskeln zittern. Ich spüre seine Hände, wie sie meine Wut von der Haut streicheln. Ruhig und stetig.
Langsam sinke ich in die Knie, bis meine Stirn seine Schulter berührt. Ich kann kaum atmen. Kaum denken.
Aber ich lebe.
Weil er mich gehalten hat. Weil er da war. Weil ich mich – für einen winzigen Moment – nicht selbst gehasst habe.
Kapitel 3 - Seine Loyalität
Helena
Ich liege im Bett. Nicht in dem von Adrian, sondern in meinem.
Obwohl mein Körper sich nach seiner Nähe sehnt, nach seiner Haut und seinem Duft. Nach seinem Atem im Dunkeln, seinen Händen und seinen Berührungen. Er beruhigt mich wie keiner auf der Welt, aber heute … heute habe ich das Gefühl, ich hätte kein Recht, bei ihm zu sein. Als wäre allein meine Existenz hier im Penthaus eine Bedrohung für ihn.
Ich liege im Pyjama auf der Seite, den Blick auf das Bild gerichtet, das Las Vegas zeigt. Den Ort, an den ich muss, um Maria zu finden. Irgendwo in Nevada. Es ist nur halbdunkel in meinem Zimmer, da ich die Vorhänge nicht zugezogen habe und die Lichter der Stadt hereinlasse. Die Lichter einer Stadt, die weiterpocht, obgleich mein Herz gerne stillstehen würde. Den Moment einfrieren, nur noch ich sein. Nie in die nächste Hitze kommen.
Meine Gedanken sind ein Labyrinth aus Schuld und Angst, und selbst Chi schweigt, ist still – irgendwo ganz hinten in meinem Inneren, eingerollt wie ein geschlagener Welpe.
Ein leises Klopfen ertönt an der Tür. Ich sage nichts, aber sie öffnet sich trotzdem. Und dann steht er da.
Cameron.
Barfuß, etwas zerzaust, mit einem schiefen Lächeln, das heute allerdings kein bisschen schelmisch ist. Nur leise. Vorsichtig. Er trägt eine graue Jogginghose, dazu ein schwarzes Shirt.
»Hey«, sagt er.
Ich antworte nicht.
Er zögert, scheint sich an Adrians Regel zu erinnern, mir nicht zu nahe kommen und mein Zimmer nicht betreten zu dürfen. Dann murmelt er ein »Scheiß drauf« und tritt ein, schließt die Tür hinter sich.
Er kommt näher, langsam. Lässt mir die Wahl.
Ich rühre mich nicht, atme flach und regelmäßig.
Als er vor dem Bett steht und mich ansieht – mit diesen goldbraunen Augen, in denen sonst immer Licht glitzert –, beginne ich zu zittern.
Ich schlage die Decke zurück. Nur ein wenig. Ein kleines Zeichen oder vielmehr ein großer Wunsch. Eine Bitte, Hoffnung … irgendwie alles zusammen.
Er zieht seine Jogginghose etwas höher, grinst schief, dann kommt er zu mir, legt sich hinter mich und schlingt seine Arme um meine Mitte.
Und ich … zerbreche.
Ich drehe mich zu ihm, vergrabe mein Gesicht an seiner Brust, klammere mich an ihn wie an einen letzten Rest meiner Realität. Seine Haut ist warm, sein Herzschlag gleichmäßig. Ich rieche ihn. Die Verführung an ihm, das Verruchte, das mich von Anfang an faszinierte – die Kombination von Engel und Teufel. Cameron Black.
»Ich habe Angst, Cam«, flüstere ich gegen sein Shirt.
»Ich weiß.« Seine Stimme ist leise und samtweich. »Ich auch.«
Er streicht mir über den Rücken, wieder und wieder. Sanft, nur da. Nur … liebevoll.
»Ich bin kein Monster.« Die Tränen brennen erneut in meinen Augen und ich spüre den Kloß, der seit Ravens Offenbarung nicht mehr aus meinem Hals gewichen ist.
Er legt seine Wange an meine Schläfe, sein Atem streift beruhigend über mein Ohr. »Ich weiß«, wiederholt er. »Und selbst wenn du’s wärst … du wärst mein Monster. Mein süßes, kleines Monsterchen, das ich mehr liebe als mich selbst.«
Ich lache unter Tränen, es ist jedoch eher ein Schluchzen.
Er küsst meine Stirn, dann meine Nase, als ich den Kopf etwas hebe. Verteilt weitere Küsse auf meinem Gesicht – Stirn, Wangen, Schläfe, Kinn –, als wollte er alles wegküssen, was mich traurig macht.
»Ich … fühle mich wie Gift«, hauche ich.
Er schüttelt den Kopf, seine Lippen streifen über meine. »Du bist ein verdammtes Wunder, Lena. Kein Gift. Nicht für mich.« Dann küsst er mich voller Zärtlichkeit auf den Mund und ich schließe die Augen.
Seine Finger gleiten zu meiner Taille, berühren die Haut unter meinem Shirt. Nur Streicheln, kein Drängen. Nur … Wärme.
Ich lege meine Hand auf seine und verflechte unsere Finger ineinander.
»Atme«, flüstert er.
Ich tue es, während er mich weiter küsst. Überall, auf meinem Gesicht, meinem Hals, meiner Schulter.
»Du bist wunderschön«, flüstert er. »Nicht trotz allem. Sondern deswegen.«
Seine Lippen streifen mein Schlüsselbein, seine Zunge gleitet meine Kehle hinauf, als würde er an einem Eis lecken. Seine Zähne knabbern an meinem Kiefer.
Er küsst mich, hält mich, liebt mich.
Bis ich nicht mehr weine, sondern nur noch genieße.
Cameron liebt mich. So wie ich bin. Das zeigt er mir gerade in all seiner Zärtlichkeit. Sein Wolf schnurrt beruhigend, hüllt mich mit seiner Wärme ein.
Und ich … ich lasse mich fallen. In seine Berührung, seine Innigkeit.
Er fängt mich auf, bevor ich den Boden unter mir verliere. Sein Körper schmiegt sich nahe an mich, ich kann jeden Muskel von ihm spüren, die Hitze, die aus ihm strömt, wie ein unsichtbares Netz, das für mich da ist.
Die Welt draußen, all die Angst, der Druck, die Ungewissheit … sie verblassen, während seine Finger über meine Haut streichen. Ohne Hast, nur mit dem Ziel, mich zu halten. Mir gutzutun.
Seine Lippen tasten sich weiter, federleicht und so vorsichtig, dass meine Kehle brennt, als wollte sie den Kloß darin zu Asche verwandeln.
Er küsst meine Schulter, mein Gesicht, dann legen sich seine Lippen auf meine Schlagader, wo er innehält. Nur atmet.
»So wie du mich jetzt brauchst«, murmelt er gegen meine Haut, »so brauche ich dich jeden verdammten Tag, Lena.«
Ich presse mich noch enger an ihn, schiebe mein Bein über seins, spüre seine Erektion an meiner Mitte. Hart. Warm … da.
Er hält mich mit einem Arm um die Taille, während seine freie Hand meinen Rücken streichelt. Jede Bewegung lässt mich mehr atmen, mehr fühlen. Wieder … ich selbst sein.
»Ich liebe dich, seitdem ich dich zum ersten Mal gesehen habe«, flüstert er und reibt sich leicht an mir. »Als du an Adrians Seite ins Wohnzimmer kamst. Zerbrechlich. Unsicher. Verdammt hübsch.« Er sieht mir in die Augen und das Gold seines Wolfes leuchtet durch die Dunkelheit. »Ich wollte dich nie nur anfassen. Ich wollte dich. Beschützen. Zum Lachen bringen. Heilen.«
Ein Schluchzen entweicht mir. Leise, zärtlich, mehr Rührung als Schmerz.
Er küsst es fort. »Und wenn du jetzt denkst, dass du zu gefährlich bist für uns … für ihn … oder dich selbst … dann erinnere dich an das hier. An mich. An mein verdammtes Herz, das schlägt, weil du darin wohnst.«
Seine Augen betrachten mich voller Zuneigung, während er seine Jogginghose etwas nach unten zieht und seinen Ständer befreit. Dann schiebt er ihn unter den Stoff meines Hosenbeines, das so kurz ist, dass es kaum meinen Hintern bedeckt. Mehr Unterwäsche als Pyjamahose, daher trage ich auch keinen Slip dazu.
Ich stöhne leise auf, als ich seine Eichel an meinem Eingang spüre und er sanft hineinstößt. Behutsam, vorsichtig.
Ich schließe die Lider, genieße das Gefühl von ihm in mir, seine Küsse, die er wieder fortsetzt, seinen Atem, der heiß über meine Haut gleitet.
Er nimmt mich langsam, tief und zärtlich. Ohne Eile …
Er ist für mich da. Immer. Ist in mir, wie ich in ihm bin.
Mein Beta. Mein Herz.
Ich kralle mich an ihn, als unsere Bewegungen an Tempo gewinnen und er sich auf den Rücken dreht, mich auf sich zieht. Sein Atem wird schneller, meiner ebenfalls. Ich hebe das Becken, lasse ihn aus mir gleiten und ziehe meine Hose jetzt ganz aus, sodass ich unten herum nackt bin. Dann setze ich mich wieder auf ihn und wir stöhnen gleichzeitig, als sein Schwanz meine Hitze erneut für sich erobert.
Ich reite ihn. In einem Takt, der mir guttut. Und ihm auch.
Atme. Keuche. Stöhne.
Wir verlieren uns ineinander, rollen zusammen herum, sodass ich unter ihm begraben bin. Er stößt härter in mich, tiefer, wilder.
Und ich stöhne meine Lust heraus, meinen Schmerz … alles. Alles, was ich bin, alles, was ich erfahren habe.
Denn jetzt gerade bin ich nur ich. Lena. Keine Luna.
Ein Mädchen, das gefickt wird.
Von einem Mann, der mich mehr liebt als seinen Herzschlag.
Ich klammere meine Beine um Camerons Hüfte, um ihn noch intensiver zu spüren, und er versteht, beschleunigt seine Stöße, ein Schweißtropfen trifft von seiner Stirn auf meine Wange.
Ich atme. Keuche. Stöhne.
Aber ich lebe. Unter ihm. Um ihn herum.
Ich zucke, verkrampfe mich und klammere mich an ihn wie an einen Rettungsring. Mit meinen Fingern, meiner Muschi, meiner Seele.
Ich verliere mich in Cameron, seinen Stößen, die wie ein Anker anmuten, seinen Küssen, die jetzt wild und leidenschaftlich sind. Sein Gewicht auf mir ist keine Last, vielmehr ein Schwur.
Das Gold in seinen Augen sieht mich an. Er sieht mich. Hält mich.
Seine Bewegungen werden irgendwann langsamer, aber dafür tief, rhythmisch und genau so, wie ich es brauche. So lange ich es brauche. So fest ich es brauche.