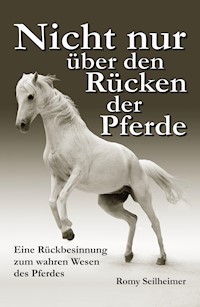
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Endlich ein Buch aus der Sicht der Pferde! Dieses Buch wurde nicht über, sondern mit den Pferden geschrieben. Auch Nicht-Pferdemenschen können aus einer ganz anderen Perspektive nachfühlen, welche Bedeutung das Pferd für uns und die gesamte Entwicklung der Menschheit schon immer hatte, und die Gefühle verstehen, die wir empfinden, wenn wir mit Pferden in Kontakt kommen. Noch immer wird das Pferd nicht als das gesehen, was es ist: ein Wesen mit ganz eigenen Bedürfnissen jenseits unserer Erwartungen. Die Autorin und ehemalige Berufsreiterin Romy Seilheimer sieht ungeschönt und genau hin. Es gelingt ihr, nicht nur auf Missstände im Zusammenhang mit der Kommerzialisierung der Pferde aufmerksam zu machen, sondern die spezielle Beziehung zwischen Mensch und Pferd auf eine neue Stufe zu stellen. Hier geht es jetzt um eine Begegnung zum Wesen des Pferdes und dadurch wird es berührend. Ein Pferd ist ein Pferd und sein anmutiger Körper wird für uns zu einem Bild, einem Gefühl, einer Empfindung von wahrer Liebe. Es geht um das Helle und das Dunkle, aber nicht um Schwarz-Weiß, ganz im Gegenteil. Das Buch ist bunt, so bunt wie unser Erleben, und erinnert uns daran, was wir im Jetzt tun können, denn unser Pferd ist das schönste Jetzt, das wir haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 300
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Romy Seilheimer
Nicht nur über den Rücken der Pferde
Eine Rückbesinnung zum wahren Wesen des Pferdes
Für alle und alles, was in uns ist
und was uns zutiefst mit den Pferden
und uns selbst verbindet
Romy Seilheimer
Nicht nur über denRücken der Pferde
Eine Rückbesinnung zumwahren Wesen des Pferdes
Copyright: © 2020 Romy Seilheimer
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
Korrektorat: Dr. Maria Zaffarana – www.korrektoratlektorat.de
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40–44
22359 Hamburg
978-3-347-03651-2 (Paperback)
978-3-347-03652-9 (Hardcover)
978-3-347-03653-6 (E-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
In diesem Buch wird zugunsten der Lesbarkeit weitestgehend auf das Gendern verzichtet.
Für Marlies
… und die Pferde
Die Autorin
Romy Seilheimer, Jahrgang 1967, ist ehemalige Berufsreiterin. Sie arbeitet jetzt als Kunsttherapeutin und ist freischaffende Künstlerin. Sie lebt mit ihren Pferden im Schwarzwald, wo sie sich ganz mit ihrem langjährigen Wissen aus diesen zwei Berufen Menschen und Pferden widmet.
Wahrheitsarroganz macht Dialog unmöglich.
Martin Buber
Es geht in diesem Buch daher um keine sogenannte Wahrheit, es geht um die Suche nach dem verlorenen Gefühl für ein Wahrheitsempfinden. Das Buch soll eine Art Einladung sein, über das ein oder andere nachzudenken und sich einzufühlen.
Ein Pferd ist ein Pferd. Ein Pferd ist für uns aber auch immer ein Archetypus Pferd, wie die gemeinsame Entwicklungsgeschichte von Mensch und Pferd gezeigt hat, deshalb wäre es zu einfach zu glauben, hier würden dem Pferd nur wieder neue Attribute verliehen. Das Pferd lebt in einer Realwelt mit uns und diese spiegelt den Entwicklungsstand der Gesellschaft und den jedes einzelnen Individuums wider.
Die Größe und den moralischen Fortschritt einer Nation kann man daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt.
Mahatma Gandhi
Inhalt
Das Dazwischen
Die Stille
Die Umkehr
Es ist nicht nur meine Geschichte
Das Zittern
Die kleine Welt
Pferd müsste man sein
Gefühle sind die Kinder der Bedürfnisse
Das uns alle Verbindende
Pferde belohnen sich beim Reiten selber … und wir machen uns selber etwas vor
Wer bewegt wen?
Regeln oder Erziehung?
Pferde beschützen und bewahren … im Gegensatz zu uns
Freiarbeit ist nicht zu verwechseln mit Freiwilligkeit
Unsere Probleme
Horsemanship-Kurs – Thema: Gelassenheitstraining
Vertrauen …?
Vertrauen erfolgt
Der Bestimmer in
Das Wichtigste in der Ausbildung eines Pferdes ist das, was der Mensch in sich ausbildet
Die Guten und die Bösen
Warum sollen sich Pferde vor uns ablegen?
Picknick auf der Rennbahn
Die Pferdeshow ist eine Show
Nur die Werbung vermag es, dem Papst ein Doppelbett zu verkaufen
Das taube Gewissen
Reitkunst oder Spieglein, Spieglein an der Wand
Das große Vergessen
All inclusive und Pferdeboxen mit Fenstern
Das letzte Mal aus der Box
Du sollst nicht merken, dass
Das Pferd in der Kunst versus Reitkunst
Gemeinsamkeiten
Wer sind die Bedürftigen?
Heunetze, Kummerfressen und Weiden
Frieden
Wettkämpfe und der Kampf der unbewussten Gefühle in uns
Was uns berührt
Der Hof der Gnade
Warum Pferde nicht weinen
Die unglamouröse Parallelwelt
Über das Aufgeben – eine Lektion für uns
Drei Arten der Liebe
Suchende
Pferde flüstern nicht
Trageerschöpfung außerhalb der Erscheinungsebene
Die Pferde wollen uns nicht mehr tragen
Der Kampf um den Rücken
Nachwort
Danksagung
Literaturhinweise
Wir haben im Leben die Wahl, wie wir die Dinge sehen. Darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, das, was sich hinter den Dingen verbirgt, zu erkennen. Danach haben wir dann wieder die Wahl – ob wir traurige oder schöne Geschichten erzählen. Nichts von beidem allein ist die Wahrheit.
Hier kommt eine wahre Geschichte …
Das Dazwischen
Vor drei Jahren kam Sahir, ein damals sechsjähriger dunkelbrauner Shagya-Araber-Wallach mit einer kleinen weißen Flocke auf der Stirn zu mir – oder besser gesagt zu meinem Mann, meiner jüngsten Tochter und mir. Mein Mann war damals von meinem Vorhaben, ein Pferd zu kaufen, nicht gerade begeistert, aber er hielt mich auch nicht davon ab. Er wusste wohl, dass es sinnlos gewesen wäre. Er hatte zwar keinen Bezug zu Pferden, aber mochte Sahir vom ersten Tag an.
Monate bevor ich überhaupt auf die Idee kam, ein Pferd zu kaufen, regte sich aus unerklärlichem Grund etwas in mir, das mich immer mehr dazu bewog, Ausschau nach einem geeigneten Pferd zu halten. Es waren zu dieser Zeit viele Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal mit Pferden zu tun gehabt hatte, und in den Jahren danach hatte ich aufgrund der schmerzlichen Erinnerungen den Kontakt zu allem, was mit Pferden zu tun hatte, vermieden. Ich suchte sie nicht mehr, sie suchten mich nicht und so sollte es eigentlich auch bleiben – bis diese schicksalhafte Stimme immer wieder flüsternd zu mir sprach.
Nach monatelangem Abwägen, bei dem das Gefühl nicht verebbte, sondern sich im Gegenteil zu einer Unausweichlichkeit entwickelte, fand ich unter den mehreren tausend Pferden, die täglich in diversen Internetportalen inseriert werden, Sahir. Es war das Foto, das mich ansprach. Er stand da, ganz andächtig, mit einem kleinen Kind von zwei bis drei Jahren auf seinem Rücken. Ich kaufte ihn, weil seine gutmütige Ausstrahlung im ersten Kontakt dem Foto entsprach. Ich kaufte ihn, weil ich wieder reiten wollte, ich wollte mit ihm durch die Wiesen und Wälder galoppieren – denn Galoppieren ist wie Fliegen ohne Flügel, wie schwerelos zu sein und allem entfliehen zu können, mit jemandem, der alles trägt. Ich wollte wieder Zeit mit einem Pferd verbringen.
Sahir wurde als Freizeitpferd verkauft, weil er für den Vielseitigkeitssport, für den er gezüchtet worden war, nicht genügte. Man sah es ihm sofort an: Sahir war kein Pferd für den Sport. Ich wollte ihm ein schönes Zuhause geben. Er sollte so frei wie möglich leben, also war ein Offenstall das Mindeste, und er sollte immer genügend Heu zur Verfügung haben. Die Bilder der Rennpferde in vergitterten Boxen mit spärlichen Heurationen hatte ich noch nicht vergessen. Wenn, dann sollte es diesmal ein eigenes Pferd sein, musste ich doch all die anderen Pferde, mit denen ich im Rennsport zu tun hatte, immer wieder gehen lassen. Ich hatte kaum Mitspracherecht, was diese Pferde betraf. Sie waren sozusagen Staatsbesitz im volkseigenen Betrieb. Der Trainer beziehungsweise die Rennbahnleitung entschied über die Pferde.
Da ich, aus dem Rennsport kommend, mehr über die Schubkraft als über die Tragkraft wusste, machte ich mich nach dem Kauf von Sahir auf den Weg, diese Lücke zu füllen. Ich las alles rund um die Biomechanik, die neuesten Ausgaben der Pferdemagazine und was ich sonst noch fand. Ich nahm klassischen Reitunterricht und fuhr auf Seminare. Es ging ja auch um den Sitz, der nie wirklich sitzen will, um den, für den man ein Leben lang Sitzschulungen braucht, denn es ist der Sitz auf dem lebendigen Thron und den kann man nicht einfach so sitzen. Reiter suchen das Gleichgewicht der Welt in ihrem Schwerpunkt zusammen mit dem Pferd und eigentlich ist es das Geheimnis schlechthin, das Gleichgewicht (der Welt) mit dem Pferd in dieser Welt – aber ob es sich im Sitzen verbirgt? Nelly Sachs, die Nobelpreisträgerin für Literatur (1966), vermochte es nicht lyrischer und dramatischer zu (ver-)dichten, als sie sagte: »Weine aus die entfesselte Schwere der Angst, zwei Schmetterlinge halten das Gewicht der Welten für dich und ich lege deine Träne in dieses Wort: Deine Angst ist ins Leuchten geraten.« So sind es die Pferdemenschen, die nicht ganz so poetisch, aber manchmal umso dramatischer um die Gleichgewichte ihrer Welt kämpfen und diese ewig suchen.
So suchte auch ich bei den unterschiedlichen Reitweisen, angefangen bei der akademischen, weiter über die klassische Reitlehre hin zu Linda Tellington-Jones, der Lehre von Sadko Solinski bis hin zu der Légèrete und natürlich Horsemanship-Kursen. Ich suchte in dicken Wälzern, dem Steinbrecht, dem Seunig, dem Bürger, dem Binding sowie in Fachliteratur neueren Datums. Aber meine Pferde, wir hatten mittlerweile drei, suchten etwas anderes, sprachen sich zuweilen dagegen aus. Sie wollten einfach etwas anderes und vor allem Sahir wollte noch nicht einmal das Training, in dem das Richtige leicht gemacht wird und das Falsche schwer. So fanden wir uns in keinem System und in keiner Methode. Es war so, alles wollte er mir sagen: Vergiss alles, was du bisher über den Umgang und das Verhalten von Pferden gelernt hast; der Boden unter meinen Füßen begann zu wanken, es war, als bekäme er Risse und aus diesen krochen anfangs auch Zweifel hervor.
Ich habe in meinem Leben schon des Öfteren nach Antworten gesucht und sie oft dann gefunden, wenn ich aufgehört hatte zu suchen. Die anfängliche Suche war dabei genauso wichtig wie das Beenden selbiger. Es häufte sich immer mehr Wissen an. Wissen allein hat aber noch nie gereicht. Wissen ist gut, solange man selbst nicht zum Feind seines Wissens wird. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass das Leben trägt, und zwar gerade dann, wenn es nicht mehr nach den eigenen Vorstellungen und Erwartungen abläuft, die man hat. Ich wollte nach all den Jahren meinen eigenen Horizont erweitern, spürte aber, genau wie in meiner Kindheit, dass sich vieles nicht stimmig anfühlte. Heute kann ich die Dinge reflektieren und muss nicht einfach Wissen unreflektiert übernehmen.
Vielleicht gab ich mich das ein oder andere Mal ahnungsloser, als ich war, das war mir aber zu der Zeit nicht bewusst. Ich wollte nun sehen, was sich und ob sich etwas geändert hatte in den Jahren, in denen ich nichts mit den Pferden zu tun hatte. Ich wollte unvoreingenommen sein und mir selber ein Bild machen. Ich wollte andere Pferde sehen; sie zeigten mehr als ihre angespannten Gesichter, mehr als das, was aus verhaltensbiologischer Forschung anhand von Stressindikatoren bis hin zum Grimace Scale (HGS) bereits zusammengefasst worden war. Sie zeigten es mir immer mehr, Puzzleteile, die zu einem Bild zusammengefügt werden konnten. Sie zeigten mir, wie sie sich fühlten.
Vielleicht war es die Zeit, die uns trennte, die dazu beigetragen hatte, dass ich mein Gefühl von ihnen erst lösen konnte, um dann wirklich mit ihnen fühlen zu können. Vielleicht war es das Studium der Kunsttherapie, das ich begann, um zu verstehen. Vielleicht hat alles miteinander zu tun.
Es gibt ein Sprichwort, das besagt, wenn eine Tür zugeht, geht woanders eine Tür auf. Vielleicht müssen wir uns von unseren inneren Bildern, den Vorstellungen und Erwartungen – wie das Pferd sein sollte, wie es sich verhalten sollte, wie es sich bewegen sollte, was es alles tun sollte – trennen, damit wir uns mit dem Bild, das ihrem Wesen, ihrem Sein entspricht, verbinden können. Das kann erst gelingen, wenn wir die eine Tür, unsere Tür der vielen Vorstellungen, schließen, wenn wir Platz machen, wenn wir dem Bild, das von den Pferden kommt, Raum geben. Vielleicht sehen wir sie erst, wenn wir nicht mehr sehen müssen, was wir zu sehen erwarten. Die meisten unserer Pferde sind bis oben hin voll mit unseren Erwartungen. Sie sind so voll, dass das Bild, das wir von ihnen haben, eigentlich nur noch überlaufen kann, damit wir endlich erkennen, was hinter dem Bild der Vorstellungen verborgen liegt. Vielleicht befindet sich dahinter ein Pferd – das Pferd, das immer noch ein Pferd ist.
Warum uns die Pferde nicht mehr tragen wollen, ist die letzte Frage, die nach drei Jahren übrig blieb.
Die Stille
Und so waren nicht die Fragen, die ich hatte, entscheidend, genauso wenig, wie es die Antworten waren. Die Antworten hätten nichts gewusst. Es war kein Dialog, bei dem es ums Fragen und Antworten ging, es war das, was dazwischen entstand, in einer ganz besonderen Stimmung, einer Mischung aus Demut, Absichtslosigkeit und Hoffnung; später wurde es ein Gefühl, für das es keinen Namen gibt. Es waren Fragen, von denen ich nicht wusste, ob ich überhaupt jemals eine Antwort finden würde, und es war die Stille, die Ruhe, die einkehrte. Trotzdem schien alles so weiterzulaufen wie vorher, nur mit dem einen Unterschied, dass ich auf einmal mit allem Ausgedachten und Gewollten aufhörte.
F. Perls bezeichnet das Dazwischen als Vorgang interpersoneller Begegnung: nur das Einlassen auf eine persönliche Beziehung bei gleichzeitigem Verzicht auf ein etwaiges Dirigieren der Geschehnisse von oben, das das Gegenüber zum Mitspieler im Dialog macht. Bezogen auf die Kommunikation mit den Pferden ist das dann überhaupt erst ein Dialog, nicht das, wovon im Kontext mit den Pferden oft gesprochen wird: Da wird so manches als Dialog bezeichnet, was dieser Grundlage entbehrt.
Als ich nichts mehr vorhatte mit den Pferden, gab es diesbezüglich auch nichts mehr zu planen. Ich musste mir nicht mehr überlegen, mit wem ich ausreiten sollte, welche Gymnastizierungen ich vorher und hinterher machen sollte; ich musste mir keine Reitwege überlegen und auch nicht, welche Gangart ich wo und wie lange reiten wollte und sollte und so weiter. Da ich mir aber nicht vorgenommen hatte, mit dem Training, mit dem Reiten, mit der Bodenarbeit, mit der Gymnastizierung ganz aufzuhören, bestand auch kein Druck oder Gefühl einer auferlegten Askese, es sollte vielmehr eine Pause sein, während der ich einfach mal herausfinden wollte, was passiert, wenn ich innehalte und einfach mal mit allem aufhöre und zuhöre. Ich wollte herausfinden, ob sich dadurch etwas verändert.
Ich war voller Gedanken und in mir war es laut, weil eine Stimme der anderen widersprach, was denn nun besser von der Zeit her wäre und was mehr Sinn machen würde etc. Irgendwie hatte ich meine eigene Konferenz im Kopf, bei der jeder noch so kleine Gedanke protestierte, wenn er nicht gehört wurde.
Ich fragte mich, wie laut es wohl sein musste, wenn man mit schweren Kandaren, klirrenden Gebissen und Kinnketten sowie klappernden Hufeisen unterwegs war. In den Reitställen ist es mitunter noch viel lauter, manchmal läuft sogar ein Radio. Es ist so laut und man ist so voll mit Überlegungen und Erwartungen, die alles noch voller und vor allem schwerer machen. Es ist zu laut und zu voll, als dass sich, selbst wenn man eine Frage hätte, jenes Gefühl einstellen könnte, das die Antwort selbst entscheiden lässt, wann sie sich einem offenbaren möchte. Es ist zu laut!
Die Umkehr
Mein Gefühl sagte mir schon seit Längerem, dass ich vieles von dem, was ich in den vergangenen drei Jahren zu sehen und zu hören bekommen hatte, genau das war, was ich nicht mehr wollte. So kam ich durch das letzte Seminar, das ich besuchte, zu der Erkenntnis, dass ich genau noch dieses eine brauchte, um endlich zu wissen, dass ich das nicht mehr brauchte.
Das Wichtigste, was ich von diesem Kurs mitnahm, waren zwei Aussagen beim Plaudern während des Mittagessens. Wir hatten Fragen zum Thema Freiarbeit und ob es so etwas wie eine Freiwilligkeit im Training mit den Pferden gibt. Wir wollten von der Trainerin wissen, ob sie wüsste, wie sie in Zukunft weiterarbeiten würde. Sie erzählte, dass ihr in all den Jahren nur ein einziges Mal ein Pferd freiwillig gefolgt sei: Es war an einem Abend in Spanien, da folgte ihr ein junger Hengst ganz freiwillig, ein einziges Mal. Alles andere sei Training und Konditionierung, mit Freiwilligkeit hätte das wenig zu tun. Auch die Freiheitsdressur hätte nichts, aber auch gar nichts mit Freiwilligkeit zu tun. Sie sprach darüber sehr offen und ehrlich. Sie erzählte weiter, dass sie sich vorstellen könnte, jederzeit als Trainerin aufzuhören und etwas ganz anderes zu tun, denn es würde ihr vollkommen genügen, nur noch mit den Pferden zusammen zu sein. Das erzählte sie so ganz nebenbei.
Ich verabschiedete mich nach vier Stunden, obwohl ich das ganze Wochenende gebucht hatte, aber diesmal nicht, ohne eine ehrliche Rückmeldung zu geben, was mir nicht gefiel, womit ich nicht einverstanden war und dass ich deshalb gehen würde. Wir bedankten uns gegenseitig für unsere ehrlichen Rückmeldungen.
Eine Vielzahl von Übungen hatte darin bestanden, den Pferden vom Boden aus das sogenannte Weichen beizubringen. Das ist eine Trainingsmethode, die auf dem Konzept des Pressure and Release(Druckaufbau und Druckminderung bis hin zum völligen Drucknachlass) arbeitet. Die Pferde haben dabei keine wirkliche Wahl. Bei dieser Methode besteht die Wahl lediglich zwischen einem gehorsamen Weichen/Beugen oder erneutem Druckaufbau. Wir würden so nicht wählen wollen. Wenn die Pferde mit der Vorhand nicht wichen, wurden sie mittels Körpersprache angerempelt, es wurde in sie hineingelaufen, getreu dem Motto: Das Pferd muss weichen, so ist die Rangordnung unter ihnen und die muss immer geklärt sein. Es war Druck- und Dominanztraining wie in all den anderen Seminaren meistens auch. Alles schien im Rahmen einer gemeinsamen Legitimierung, im Bann einer unsichtbaren Übereinstimmung zu verlaufen, bei der subtile Gewaltanwendung zur Normalität wird und dadurch aus der Sichtbarkeit, der Objektivität und Subjektivität aller Beteiligten entzogen wird, sodass keiner mehr sieht, was eigentlich geschieht. Aber nichts von dem spielt sich nur innerhalb dieser Grenzen ab, denn in diesen Grenzbereichen bewegt man sich dann allzu oft und unbemerkt in Richtung eigener Abgründe. Das Paradoxe dabei war, dass es niemandes Ziel war, vielmehr war der gut gemeinte Vorsatz, eine faire Kommunikation auf partnerschaftlicher Höhe mit dem Pferd zu führen. Die Anwesenden waren durchweg Frauen, alle sehr nett und mit einer unschuldigen Gläubigkeit im Herzen. Die Erfahrung sagt: Wir sehen nur, was wir wahrhaben wollen.
Aber da ist ja noch das Unbewusste, das immer mitredet, in jeder Haltung, körperlich wie psychisch. Es waren nicht die Pferde, die distanzlos waren: Sie sprachen und zeigten zwischendurch immer wieder mal Gesten des Ärgers; je nach Charakter schlugen sie unwillig mit den Köpfen, wenn am Strick gezogen wurde, sie stampften und scharrten zuweilen mit den Hufen, aus den angespannten Nüstern kam der ein oder andere Protestschnauber. Die Pferde waren sauer und wahrscheinlich hätte ein Blinder gehört, was die Sehenden nicht sehen konnten, obwohl es offensichtlich war.
Für mich fühlte es sich sinnentleert an und ich sah die Leere in den Augen der Pferde. Die Pferde wichen nicht wirklich, denn die meisten waren in einem tranceähnlichen Zustand. Es wurde nur gesendet, nicht empfangen. Nur bei einem Mädchen, das mit seinem Wallach arbeitete, war es anders, es schien eine wechselseitige Verständigung zu geben.
Es waren die Touchiergerten, die nur touchieren sollten, die dann aber immer häufiger gezielt meist auf die Hinterhand des Pferdes zischten, immer mit der Betonung: Ich touchiere nur solange, bis das Pferd weicht, dann höre ich auf. Nach ersten Erkenntnissen einer Studie der australischen Veterinärin Dr. Lydia Tong mit dem Titel Does whipping hurt horses? ist genau das Gegenteil der Fall. Der basale Teil der Pferdehaut ist zwar einen Millimeter dicker als die menschliche Haut, aber dafür sind die oberen Hautschichten, in der die Nervenenden sitzen, dünner als beim Menschen. Zudem zeigen die Ergebnisse einer Pilotstudie, dass Pferdehaut mehr Nervenendungen pro Quadratzentimeter aufweist als das menschliche Pendant. Nach dieser wissenschaftlichen Arbeit müssen wir also davon ausgehen, dass Pferde den Schlag mit der Gerte intensiver wahrnehmen als wir.1
Wahrnehmen bedeutet immer für wahr nehmen. Pferde sind sehr dünnhäutig, in jeder Beziehung. Der am Menschen ausprobierte Oberschenkeltest – vor dem Kauf oder vor der Benutzung einer Touchiergerte – ist damit hinfällig beziehungsweise müsste um ein Vielfaches verstärkt werden, was die eigene Schmerzempfindlichkeit und deren Einstufung betrifft. Sehr viel präziser können Gerten getestet werden, wenn man sie auf die eigenen Fingerkuppen schlägt. Hier wird man schnell merken, dass selbst ein Touchieren schon schmerzhaft ist. Die menschlichen Fingerkuppen entsprechen eher dem Schmerzempfinden des Pferdes auf der Hinterhand oder auf den noch viel empfindlicheren Flanken als ein menschlicher Oberschenkel, der in einer Hose steckt.
Mein vorzeitiges Verlassen des Kurses fühlte sich weder nach einem Triumph an, noch fühlte ich mich wirklich erleichtert, es war mehr ein inneres Durcheinander. Es war nichts, was ausschließlich mit den vier Stunden dort zu tun gehabt hätte. Es war vielmehr das, was ich insgesamt sah, als ich die Pferde beobachtete, und das hatte schon eine viel längere Geschichte. Ich wollte diesmal aber nicht einfach bleiben und weiter zusehen oder sogar mitmachen müssen. Ich wollte aber auch nicht nur einfach schnell weg, denn ich dachte, ich hatte keine Ahnung. Hätte ich Ahnung gehabt, hätte ich ja nicht zu einem Seminar gehen müssen, dachte ich.
Und ich hatte wirklich keine Ahnung von dem, was man noch so alles mit Pferden anstellen kann, ohne dass in gebührendem Maße auf sie und ihre Art sich mitzuteilen geachtet wird. Mir war zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar, dass bei den eben erlebten Übungen so wenig auf die Pferde geachtet wurde, dass sie genau jenen Sinn nicht erspüren konnten, der sie vielleicht dazu motiviert hätte, in die einzelnen Übungen hineinzuhorchen.
Jetzt könnte man meinen, ich wäre wohl im falschen, einem schlechten Seminar gewesen, aber ich hatte im Vorfeld bei der Kursauswahl immer darauf geachtet, wie der Ansatz der Trainingsmethode war. Ich wollte kein Dominanztraining, also schaute ich schon hin, wer sein Training unter dem Prädikat pferdegerecht anbot. Irgendwo versteckt sich dieses Wörtchen jedoch fast immer, denn das ist ja eigentlich das, was wir wollen.
Mein Nein war in all den Jahren schneller und größer geworden, mein Nein galt mir, mein Nein war meine Grenze zu dem, was ich nicht mehr mitverantworten wollte. Es richtete sich aber nicht in erster Linie gegen die Trainerin, mein Nein war vielmehr ein Ja für die Pferde. Wir sagen im alltäglichen Leben viel zu selten wirklich Ja. Wir haben unser Ja verloren, weil wir viel zu oft nicht Nein gesagt haben, obwohl das Gefühl ganz deutlich Nein meinte. Diese beiden kleinen Wörtchen sind sehr wichtig, denn sie sind der Wegweiser zu uns selbst.
Es gab viele Kurse mit mehr oder weniger ähnlichem Inhalt. Es gab auch Kurse, da liefen Pferde mit heraushängenden Zungen, schiefer Kopfhaltung und die Reiter saßen mit eingedrehten Händen wie ungelernte und ungelenke Kutscher auf dem Pferd. Die Pferde trotteten in diesen und anderen Haltungen geistesabwesend ihre Runden und die Trainer waren wohl des Blickes, aber ohnmächtig, dem noch Sprache zu geben. War es Diplomatie, die ihnen gebot zu schweigen? So versuchten sie oft sehr höflich, auf das ein oder andere aufmerksam zu machen, was mitunter auch auf Akzeptanz traf, aber leider nur für den Bruchteil einer Sekunde im Gedächtnis, vor allem im Körpergedächtnis, hängen blieb, bevor reflexartig in die alte, im Unterbewusstsein verankerte Haltung zurückgefallen wurde. Dort waren seit Jahren ganz andere Abläufe und Programme abgespeichert, die Festplatte längst voll und ein Löschen sowie ein Neustart an einem Wochenende unmöglich. Ich fragte mich, wie es sich wohl anfühlt zu sehen und nicht viel unternehmen zu können.
Nicht alle Trainer sind so zurückhaltend und so traf mich einer an meinem wundesten Punkt. Ich, die ich nach all den Jahren mit den Rennpferden endlich alles richtig machen wollte, musste mir eingestehen, dass es Sahir ab dem Tag seiner Ankunft bei mir nicht wirklich besser ging. Ehrlichkeit und Konfrontationen sind das eine, nach dieser Rückmeldung wurde mir aber auch schlagartig – außerhalb meines Berufes – bewusst, dass es schon immer eine Kunst war, Rückmeldungen zu geben, ohne zu verletzen. Dankbar bin ich dem Trainer trotzdem.
So verhalten und steif, wie Sahir damals aus dem Transporter stieg, als er bei mir ankam, schien er nicht in der Lage, sich aus dieser Haltung allein befreien zu können. Das war eindeutig. So kam drei Tage nach seiner Ankunft die erste Osteopathin, im Laufe der nächsten Monate noch drei bis vier andere, trotzdem vermochte es niemand, ihm zu helfen. Immer wieder schien mit seinem Kreuzbein-Darmgelenk und mit seinem Rücken etwas nicht in Ordnung, er lief steif und hatte sich in einer Schonhaltung installiert, die ihn immer mehr daran hinderte, jene Bewegungen auszuführen und Muskeln zu benutzen beziehungsweise erst einmal aufzubauen, die er brauchte, um einen Reiter tragen zu können. Er war in sich gekehrt und der Umwelt, besonders dem Menschen, abgewandt. Er war traurig, seine Augen glänzten nicht mehr und er suchte nicht mehr … er suchte nicht mich, sondern höchstens seine Kumpel. Ich war ihm ziemlich egal.
Wenn Pferde nicht mehr suchen, sind sie traurig, depressiv oder krank. Er hatte sich eine Schutzhaltung – man könnte fast meinen: einen Schutzpanzer – zugelegt, der seine Muskeln verhärten ließ.
Wovor Sahir sich zu schützen versuchte, blieb erst einmal unklar. Ob es der lange Transport war, ob er einen Weideunfall oder einfach keinen guten Start hatte, wie die Trainer und Osteopathen vermuteten? Er war in einem privaten Offenstall in einer kleinen Herde aufgewachsen und die Besitzerin ließ es ihren Pferden an nichts fehlen, wie ich weiß. Es war uns allen ein Rätsel, was mit ihm los war. Auf der rein funktionalen Ebene und mit dem herkömmlichen Aufbautraining wurden wir ihm nicht gerecht.
So machten wir uns weiter auf die Suche nach einer Erklärung beziehungsweise Lösung. Es folgten Tierarztkonsultationen, Röntgenbilder, Blutentnahmen mit diversen Titerbestimmungen, Tierheilpraktiker, die Erstellung von ausgeklügelten Trainingsplänen mittels Pulsmessung, es gab mehrere Sattelanpassungen, natürlich mehrere Sättel und aus lauter Verzweiflung auch eine Tierkommunikatorin, da ich ihn noch immer nicht verstand. Es gab nichts, was ich nicht unternahm, um ihm aus dieser Situation herauszuhelfen. Auch ein Beritt war für kurze Zeit angedacht, aber zum Glück ließ ich das bleiben, nachdem ich mir den Rehabilitationsstall angesehen hatte: Es war ein moderner Stall mit Boxenhaltung, einem Laufband und einer Reithalle. Da wurden Pferde wieder zum Laufen gebracht. Der Stall war voller trauriger Schlachtschiffe, so kamen mir die großen Warmblüter, mehrheitlich aus dem Sport kommend, in den vollvergitterten kleinen Boxen vor. Eine Stute koppte unentwegt, ein Zeichen ihrer großen Sensibilität. Aber darum ging es nicht; der Auftrag lautete, wieder laufen und tragen zu können. Ein großer brauner Wallach legte die Ohren ins Genick, sobald man nur an seiner Box vorbei lief. Der Trainer war natürlich wie immer sehr nett. Schnell war mir klar, dass das für Sahir nicht infrage kam. Sahir gehörte so nicht rehabilitiert. Dass das Ganze auch ohne den Beritt ein kleines Vermögen kostete, muss ich sicher nicht weiter erwähnen.
Ich sollte Sahir reiten, reiten und nochmals reiten, damit er gute Muskeln bekäme, so die einheitlichen Aussagen der Experten. Ich hatte damals nicht das Gefühl, dass er mich nicht tragen wollte, was auch von einer Trainerin bestätigt wurde, steif lief er trotzdem. Er war nicht sehr weit ausgebildet, war freizeitmäßig angeritten und wir wollten jetzt mehr draus machen, denn es ging ja darum, das Tragen zu lernen, es ging ums Tragen und ums Sitzen.
Das ganze Training dauerte über zwei Jahre, bis ich auf einen Trainer traf, der mir im Gegensatz zu allen anderen sehr unverblümt und entschieden davon abriet, Sahir weiter zu reiten, er und die letzte Sattlerin waren es, die sehr ehrlich waren. Zunächst brach meine Welt zusammen.
Eine junge und sehr einfühlsame Trainerin sollte uns dann erstmals wirklich helfen, in Kombination mit einem hervorragenden Osteopathen – eine Koryphäe auf seinem Gebiet und einer Tierkommunikatorin, die wirklich eine ist. So gelang es Sahir, sich aus den dysfunktionalen Bewegungsabläufen zu befreien und sich mehr und mehr zu entspannen. Ich hatte bis dahin noch nie mit einem Menschen zu tun gehabt, der mit Tieren beziehungsweise Pferden auf ganz andere Art kommunizieren konnte als alle anderen. Ich war demgegenüber zunächst skeptisch, habe es selbst noch nicht einmal bis in eine Yogaprobestunde geschafft, wollte es aber nicht gänzlich verneinen und selbst mein Zweifel stand dem Erfolg letztlich nicht im Weg.
Sahir entspannte immer mehr seinen Schutzpanzer und vor allem entspannte er von der Erfahrung, nicht genügt zu haben, und er entspannte auch von meinen Erwartungen, die ich an ihn hatte. So kamen immer lebendigere Gefühle zum Vorschein. Der letzte Osteopath kam noch ein zweites Mal und sagte, egal was wir gemacht hätten, es wäre nicht das Falsche gewesen. Dabei beließen wir es und bis heute bewegt sich Sahir wie ein Pferd, das Freude an der Bewegung hat. Er ist wieder ein Suchender, einer, der alles Mögliche sucht, nicht nur den Keks in der Tasche. Er wird keine Elfe und kein Athlet und das ist gut so, denn er ist ein Pferd.
Er tat gut daran, in seiner Haltung zu verharren, in der Haltung, an der die Profis scheiterten, in seiner Schonhaltung, die ihn schützte, in seiner Schutzhaltung, die ihn schonte, die ihn davor schützte, dass auch ich ihn nicht sah. Dabei hätte ich … nein, nicht nur ich: wir alle müssten es doch eigentlich wissen, wie es sich anfühlt, sich schützen zu müssen. Er wäre still gestorben, ganz leise – obwohl ich ihn jeden Tag versorgt hätte, obwohl ich weiter täglich unzählige seiner Bollen in unzähligen Schubkarren durch unzählige Matschwege geschoben hätte. Sahir hätte sich wie viele andere Pferde nicht widersetzt, er wäre gegangen, bevor er dagewesen war. Ich hätte ihn als lebendiges Exponat auf eine Ausstellung zeitgenössischer Kunst fahren können, er selbst wäre der Akt der Installation gewesen, eine atmende Skulptur und ästhetische Zugabe zugleich. Zwischen all den ehrlichen, ungeschönten Objekten zeitgenössischer Kunst, zwischen dem einen oder anderen Torso, der seine vier Hufe auf dem Weg zu uns verlor, hätte er sich prima eingefügt, hätte das alles mitgemacht und vielleicht hätte ich mir eingebildet, dass er das alles nur für mich macht. Und ja: Er hätte es für mich getan, bis ich gesehen hätte, was ich noch so alles aus ihm machen könnte. Denn das ist die Sprache der Pferde. Die Sprache ist ihr Bild, ihr Verhalten im Bild, das sie von sich geben. Pferde machen alles Mögliche mit und sie irren sich dabei nicht im Geringsten, wie Monty Roberts oft wiederholt. Wo Raubtiere Fehler machen können, beim Jagen, bedeutet es für sie nicht unweigerlich den Tod, sie haben weitere Versuche. Bei einem Pferd kann eine Fehleinschätzung jedoch das Todesurteil bedeuten, deshalb irren sie nicht. Wir sind es, die sich irren, ihre vermeintlichen Unzulänglichkeiten sind unsere eigenen.
Wie ehrlich sollten Trainer und auch Reiter sein, wenn es um das Wohl der Pferde geht? Wie ehrlich sind wir im Umgang mit uns selbst? Wie viel Ehrlichkeit ertragen die Besitzer? So oder so: Die Trainer sind nicht das Problem. Manche sind sehr ehrlich, andere arbeiten mit Tricks, aber zaubern können sie alle nicht. Was sollen sie tun, wenn wir Reiter oder Besitzer Ausbildungsanfragen stellen, wenn wir nach einer besseren Verbindung zu unserem Pferd fragen, wenn wir fragen, was wir tun müssen, damit uns das Pferd folgt, sich ablegt, dehnt, aufrichtet, sich versammelt … tausend Jahre später ist Dornröschen immer noch nicht aufgewacht.
Die Trainer bedienen einen Markt und sichern sich, wenn sie es hauptberuflich tun, damit ihre Existenz. Viele von ihnen haben Wunderbares mit ihren Pferden erlebt, es lässt zuweilen ihre Augen immer noch leuchten, meist in den Pausen oder beim gemeinsamen Mittag- oder Abendessen. Sie erzählen dann, was sie erlebt haben, wie alles angefangen hat, was sie entdeckt haben und wie sich dadurch alles verändert hat. Die meisten haben einen intensiven Selbsterfahrungsprozess durchlebt, sie haben etwas mit ihren Pferden zusammen erlebt, was sie zu dem hat werden lassen, was sie sind. Es entsteht schon beim bloßen Zuhören eine Berührtheit, die einen nacherleben lässt, dass es hier zu wahren Begegnungen von Pferd und Mensch gekommen ist. Diese Trainer sind erfolgreich geworden, weil es etwas gab, dem sie gefolgt sind. Die Wege dauerten manchmal mehrere Jahre – und dann kommen pferdenärrische Freizeitreiter, die vielleicht gerade ein Pferd gekauft haben und wollen, dass sie in zwei, drei Tagen den Umgang, die Psyche eines Pferdes und so weiter gelehrt bekommen. Wieder andere sind Umsteiger oder sogar (Turnier-)Aussteiger, die das Gewohnte verlassen wollen auf der Suche nach einem besseren, einem pferdegerechteren Umgang. Sie würden sogar noch länger kommen oder immer wieder. Aber warum vermag sich in den meisten Fällen doch nicht der gewünschte Erfolg einzustellen? Das alles unterliegt einem Prozess und jedem sollte klar sein, dass über Nacht keine Wunder geschehen. Sich mit Pferden zu verbinden, mit ihnen wirklich zu kommunizieren, ist eine andere Art Lebenseinstellung, der Weg dorthin ist eigentlich eine Veränderung des eigenen Ichs, des (Er-)Lebens.
Wenn der Mensch sich nicht in diesen Prozess mit hineinbegibt und sich immer wieder selbst reflektiert, wird der Prozess früher oder später stagnieren. Es kommt zwangsläufig zu einem Übertragungsgeschehen. Übertragen werden eigene persönliche unbewusste Anteile, die sich im Handlungsfeld mit dem Pferd zeigen. Dabei wird das Pferd als Gegenüber auch zum Objekt der eigenen negativen Bewertungen, was sich dann ganz platt gesagt in der inneren Haltung gegenüber dem Pferd zeigt, indem es heißt: Blödes Pferd! Denn ein jeder bleibt im Umgang mit dem Pferd dort stehen, wo er selbst innerlich stehen geblieben ist.
Die Methoden und Techniken, die die jeweiligen Trainer entwickeln, kommen den Pferden mitunter zugute, und wenn die Idee offensichtlich gut ist, erfolgversprechend, sollen sie auf Seminaren und auf Veranstaltungen multipliziert werden, damit viele Pferde davon profitieren können – beziehungsweise ihre Besitzer. Irgendwie scheint aber das eigentliche Geheimnis immer beim Meister zu bleiben. Es wird meist versucht, die Technik, die Methode zu vermitteln, aber das allein ist wie ein Topf ohne Deckel. Mit etwas Training kann der ein oder andere sicher eine gewisse Methodik erlernen und dann auch weiterverbreiten, aber irgendetwas fehlt, selbst wenn es während des Kurses noch gelingen mag. Bei der Verfolgung einer Methode oder auch einer Technik geht es immer um das Erlangen von bestimmten Zielen. Das Eigentliche geschieht aber, wenn niemand zusieht, wenn niemand da ist, der ein Foto oder ein Video machen könnte. Diese Momente gehen aber trotzdem nicht verloren, sie gehen ins gemeinsame Archiv unserer Herzen.
Es gibt sehr einfühlende Trainer, die nach meiner Beobachtung durch die Achtsamkeit den Pferden gegenüber Erfolg haben. Es sind die Achtsamkeit und die Klarheit, die unabgelenkt von zu viel und zu gut gemeintem Tätscheln oder auch dem Gegenteil davon, zu viel Dominanzgehabe, ausgeführt wird. Pferde mögen es nicht, andauernd betätschelt und ins Gesicht gefasst zu werden, genauso, wie sie es nicht mögen, abgeklatscht zu werden. Tendenziell gibt es Menschen, die Pferde eher wegschicken (Wegschicker), und es gibt die Einlader, sie suchen immer die Nähe der Pferde, oft auch in einem Ausmaß, bei dem das Nähe-Distanz-Verhältnis darunter leidet. Es ist interessant und sehr aufschlussreich, das für sich selbst herauszufinden. Es mag Zeiten geben, wo sie unsere Hände suchen, denn nur unsere Hände können so schön ihre Ohren kraulen und andere wunderbare Dinge, aber es gilt zu erspüren, wann sie dieses Bedürfnis danach haben, denn sonst bleibt es mehr unser unreflektiertes, alleiniges Bedürfnis, sie anzufassen, sie zu streicheln. Wie oft habe ich das gesehen, wie lange habe ich gebraucht, um es auch bei mir reflektieren zu können! Dieses Streicheln vermag uns manchmal mehr zu beruhigen als die Pferde, gerade in ungewohnter, fremder Umgebung. Das Anfassen, das Berühren gibt uns dann Halt, kann sich für das Pferd aber befremdlich anfühlen und ihm Raum nehmen.
Die Trainer scheitern bei der Weitervermittlung zuweilen wie die Prinzen vor der Turandot in Puccinis letzter Oper. Die Prinzen und Ritter werden allesamt bis auf einen enthauptet, weil sie die Rätsel nicht lösen können, weil das Mitgefühl nicht im Kopf sitzt, sie aber versuchen, die Rätsel intellektuell zu lösen. So ist es in dieser Oper: Erst kommt das Mitleid und später sind es die wieder zurückeroberten Gefühle, das Mitgefühl. Das Mitgefühl aus Liebe war des Rätsels Lösung, die den Fluch um die Turandot entkräften konnte, die sie erlöste. Das Rätsel, das Geheimnis, die Botschaft … was hat das jetzt alles mit uns zu tun?, mag sich der ein oder andere fragen. Auf alle Fälle erst einmal so viel, dass wir alle behaupten, dass wir die Pferde lieben. Aber haben wir das Rätsel um die Verbindung zum Pferd gelöst, haben wir etwas erlöst?
In Puccinis Oper war es die Liebe, entstanden aus einem tiefen Mitgefühl – die Liebe, die Rätsel zu lösen vermag. Es gibt aber drei Arten von Liebe, nicht nur eine, und doch gibt es nur die eine. Aber auch dazu später mehr.
Es gibt Menschen, denen es gelungen ist, eine wahre Verbindung zu den Pferden zu finden, und doch bleibt auch hier in der Weitervermittlung meist nicht viel mehr als eine Hülse übrig. Das Eigentliche, was die Verbindung erfüllt, verschwindet hinter einstudierten Techniken, hinter Konditionierungen und einem wüsten Knäuel von Emotionen und mangelnder Körperwahrnehmung. Oft ist es gar nicht so, dass wir nicht zuhören wollen, aber es gelingt uns nicht mal zu realisieren, dass sie uns die ganze Zeit etwas zeigen/sagen wollen.
An einem der heißesten Sommerabende des Jahres – und wir hatten viele davon in diesem Jahr – waren mein Mann und ich auf einem Horsemanshp-Kurs, wo ein echter





























