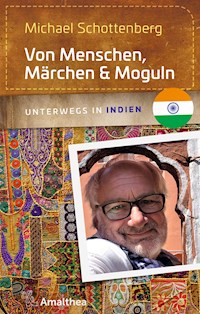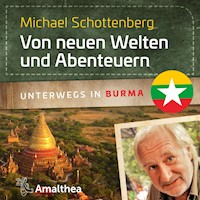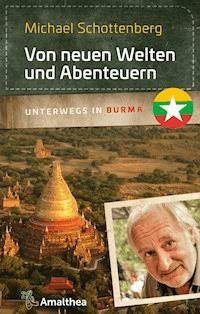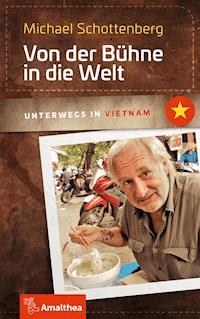Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schotti to go
- Sprache: Deutsch
Wo Kultur und Natur einander begegnen »Das Ferienhäusl, das mein Vater erwarb und in dem ich den Großteil meiner Kindheit verbrachte, ist längst verkauft. Nun, da ich erwachsen bin, zieht es mich wieder hinaus in den Wienerwald, nach Niederösterreich.« Mit diesen Worten beginnt die Liebeserklärung Michael Schottenbergs an seine neue Heimat. Der fantasievolle Reisephilosoph tut, was er am besten kann: Geschichten erzählen, die aus dem Herzen kommen und zu Herzen gehen. Seine Tour durch Grafenegg, Maria Gugging, Hardegg, Rossatz und viele andere Orte ist nicht nur ein literarisches Geburtstagsgeschenk an ein 100-jähriges Land, sondern auch ein einzigartiges Dankeschön an all jene Menschen, die ihm ihre Lebensentwürfe anvertrauten: Pecher und Waldrapper, Erdäpfelzüchter und Fischhäuter, Mohnwirte, Vertriebene, Sternengucker, Verpackungskünstler und Löffelmacher. Ein humorvolles Buch voller Abenteuer, Entdeckungen und Begegnungen, die lange im Gedächtnis bleiben. Mit zahlreichen Extra-Tipps und Reisefotos in Farbe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHOTTI TO GO
Michael Schottenberg
NiederösterreichfürEntdecker
Mit 61 Fotos
Bildnachweis
Alle Bilder stammen von Michael Schottenberg mit Ausnahme der folgenden:
Ulrik Hölzel (5, 9, 41, 71, 84, 98, 122, 144, 187, 235, 240), AKON/ÖsterreichischeNationalbibliothek (69), Wolfgang Göb (75), Mayer-Elsbeere (117, 120), Peter Hotz (149)
Der Verlag hat alle Rechte abgeklärt. Konnten in einzelnen Fällen die Rechteinhaber der reproduzierten Bilder nicht ausfindig gemacht werden, bitten wir, dem Verlag bestehende Ansprüche zu melden.
Gefördert durch das Land Niederösterreich
Besuchen Sie uns im Internet unter:
amalthea.at
© 2022 by Amalthea Signum Verlag GmbH, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und Satz: Johanna Uhrmann
nach einem Design von Valence/www.valencestudio.com
Umschlagfoto: © Ulrik Hölzel
Lektorat: Madeleine Pichler
Herstellung: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der Collier und der Ramona
Designed in Austria, printed in the EU
ISBN 978-3-99050-233-4
eISBN 978-3-903441-01-9
Für Claire
Inhalt
Wo Kultur und Natur einander begegnen
Niederösterreich ist hundert. Gratulation!
1 Gscheitblöd
Museum Nonseum, Poysbrunner Straße 9, 2171 Herrnbaumgarten
2 Veronika, der Lenz ist da
Biogemüse Gut Markhof, Familie Brandenstein, Gut Markhof 1, 2293 Schönfeld im Marchfeld
3 Der Schwur von Hainburg
Gasthaus Auhirsch, Försterstraße 7, 2292 Stopfenreuth
4 Kochen ist Verstehen
Genusswirtshaus und Grillschule Adi Bittermann, Abt-Bruno-Heinrich-Platz 1, 2464 Göttlesbrunn
5 Im Haus der Künstler
Museum Gugging, Am Campus 2, 3400 Maria Gugging
6 Der nach den Sternen greift
Stilklassen der Volksschule Berndorf, Margaretenplatz 5, 2560 Berndorf
7 Im Eisstanitzl
Andrea und Georg Blochbergers Eis-Greissler Manufaktur, Königsegg 25, 2851 Krumbach
8 In aller Liebe
Semmering – Kurort, Höhenluft- und Fremdenverkehrsort, 2680 Semmering
9 Kunst und Leben
Aussichtsterrasse Skywalk auf der Hohen Wand, Postlstraße 77, 2724 Maiersdorf
10 Pech aber auch!
Pecherei Robert Rendl, Hauptstraße 34, 2761 Waidmannsfeld
11 Über das Vertrauen
Sanatorium Wienerwald, 2761 Feichtenbach
12 Der Alpenkönig
Bergfriedhof Gutenstein, Längapiesting 37, 2770 Längapiesting
13 Der Andere
Egon Schiele Museum, Donaulände 28, 3430 Tulln an der Donau
14 Die schlafende Schönheit
Unterwegs in der Hauptstadt, 3100 St. Pölten
15 Odlatzbia oröwen
Haus der Elsbeere, Bio-Hof „Auf der Prinz“, Mayerhöfen 1, 3074 Michelbach
16 Der Strom des Lebens
Die Donau zwischen Nibelungengau und Carnuntum
17 Der Wald
Wildnisgebiet Dürrenstein, Haus der Wildnis, Kirchenplatz 5, 3293 Lunz am See
18 Der Erdapfel-Abt
Die Kartoffel im Stift Seitenstetten, Am Klosterberg 1, 3353 Seitenstetten
19 Huchen-Pepi
Weingut Josef Fischer, Rossatz 58, 3602 Rossatz
20 Mohn Amour
Mohndorf Armschlag, 3525 Sallingberg
21 Dem Vergessen entgegen
Gedenkstätte Döllersheim, Truppenübungsplatz, 3804 Allentsteig
22 Stadt der Vögel
Verein Waldrapp, Hauptplatz 6, 3830 Waidhofen an der Thaya
23 Das Erwachen der Bienen
Jaus’nwrap – DI Benedikt Wurth KG, Schwarzenberg 3, 3834 Pfaffenschlag
24 Des Karpfen Haut
Yupitaze Fischleder, Reitzenschlag 24, 3874 Litschau
25 Der Knopfkönig
Perlmutt Manufaktur, Felling 37, 2092 Felling
26 Momente der Maßlosigkeit
Grafenegg Festival, Grafenegg 10, 3485 Grafenegg
27 Jägerlatein
Der Jäger und Naturphilosoph Norbert Kraus und die ARGE Niederwild, 3462 Bierbaum am Kleebühel
28 Der Welteneroberer
IPG – Internationale Ignaz Joseph Pleyel Gesellschaft, Baumgartnerstraße 14, 3701 Ruppersthal
29 Das Goldtöpfchen
Sternenweg Großmugl, Hauptstraße 46, 2002 Großmugl
30 Von Kellern und Gassen
Labyrinthkeller Umschaid, Hauptstraße 49, 2171 Herrnbaumgarten
Der Autor
Wo Kultur und Natur einander begegnen
Niederösterreich ist hundert. Gratulation!
1920. Ein Land erfand sich selbst. Jahrhunderte währte die Ehe mit der Bundeshauptstadt, so lange – bis sie zu Ende war. Am 1. Jänner war es so weit, die Trennung wurde amtlich. Zwei Jahre sollte es dauern, bis auch die letzten Vertragspunkte ausverhandelt waren und die Geschiedenen eigene Wege gingen. Aus dem riesigen Gebiet nördlich und südlich der Donau wurde ein eigenständiges Bundesland, und der Bürgermeister von Wien war mit einem Schlag nur mehr Landeshauptmann seiner selbst. Nach dem verheerenden Krieg schrumpfte der größte Kopffüßler Europas, die Wienerstadt, zu einer Ansammlung dunkler, ausgebrannter Häuser. Der Krake, dessen Tentakeln einst den halben Kontinent umfingen, gab nicht auf, trotzdem er sich neu erfinden musste. Auch das große Agrarland, das einst wie eine Stola um die kaiserlichen Schultern lag, wusste vorerst nicht, wie es mit den neuen Herausforderungen umgehen sollte. Verwaltungseinheiten waren zu schaffen, abgesehen vom alltäglichen Überlebenskampf gegen Hunger, Armut und Not – das aber betraf beide ehemaligen Eheleute. Die Scheidungsurkunde der Neo-Bundesländer zog sich hin bis zum Jahr …
1986. So lange blieb die Tintenburg Wien die Hauptstadt Niederösterreichs. Ein neuer Regierungssitz musste her und aus der verschlafenen Provinzschönheit St. Pölten wurde eine schmucke Landeshauptstadt.
Das Entlein ward wachgeküsst, und der Aufstieg zum kulturell, gesellschaftlich und politisch prächtigen Geflügel gelang. Eine Handvoll weitsichtiger Politiker vollbrachte das Kunststück, allen voran der apostolische Landesvater a. D., das Radlbrunner Christkind Erwin Pröll. Er riss das Ruder herum und formte aus der Stadt ein Schmuckstück, aus dem Land pures Gold. Chapeau! Heute präsentiert sich St. Pölten als eine lebenswerte, bestens organisierte Kleinmetropole mit beeindruckender Handschrift: Das Regierungsviertel kann sich sehen lassen, der Stadtkern ist herausgeputzt und die Ökonomie boomt. Während die einstigen Partner Wien und Niederösterreich zu alter Liebe zurückgefunden haben, sorgten die beiden Langzeitverliebten Häupl und Pröll längst für Nachwuchs. Alte Liebe rostet nicht. In St. Pölten wurde klug geklotzt und nicht, wie sonst wo, kleinmütig gekleckert. Davon kann sich Wien ruhig eine Scheibe abschneiden. In der niederösterreichischen Landeshauptstadt sieht man innovatives Theater, in Krems studiert man, nach Mistelbach fährt man, um Schüttkunst zu erleben, nach Baden bei Wien, um Operettenlieder zu hören. Das Land ist längst von der verschreckten Provinzpflanze zur stolzen Mittelpunktsranke mutiert. Dass das so bleiben möge, ist dem jubilierenden Land zu gönnen.
1958. Ein Mann mit Hut lehnt lässig am gelben Opel Rekord, der unmittelbar vor dem grauen Zinshaus parkt, dessen Fassade mit Einschusslöchern aus dem letzten Krieg gezeichnet ist.
„Schnell, der Vater wartet!“
Hastig tun die Frauen letzte Handgriffe, die Omama packt doppelt belegte „Brode“ (ihre ungarische Herkunft kann sie nicht verleugnen) ein, nebst dem unvermeidlichen Apfel für das Kind. Aber das Kind will keinen Apfel. Es hasst Äpfel. Der Vater schnippt den Nil-Kaiser in den Gulli, dann zwängt er sich hinters Volant. Vielleicht sollte er doch einmal dem ewigen Penzen seines Pupperls folgen und mit einer kleinen Zwischendurch-Diät beginnen. Er hupt. Hastig stürmen die beiden Frauen, bepackt mit Binkel und Packl, aus dem Haustor, gefolgt vom Kind, dessen dünne Haare mit einem Spangerl zur Seite gezurrt sind. Der Kleine hasst nicht nur Äpfel, er hasst auch Spangerln – und Strumpfhosen obendrein, aber da hat er keine Chance, weil auf die besteht die Mutter, zumindest in der Übergangszeit, und damit sind jene Monate gemeint, die zwischen Winter und Frühjahr, Sommer und Herbst und Herbst und Winter liegen.
Auch im Auto behält der Vater den Hut auf. Damit nicht genug, jetzt zieht er auch noch die Wildlederhandschuhe an, um nicht vom Lenkrad abzurutschen, man weiß ja nie. Der Gasfuß drückt aufs Pedal, der Motor röhrt auf. Der Opel beschreibt einen „Winnetou“, so sagt man, wenn der Fahrer eine Hundertachtzig-Grad-Halse hinlegt, und ab geht’s in Richtung Schönbrunner Tor. Am Beginn des Grünen Berges hört man vom Wacker-Wien-Platz ein Gejohle, was bedeutet, dass die Heimmannschaft ein Goal geschossen hat. Gegen Fußball ist die Mutter allergisch, weshalb die Fensterscheibe hinaufgekurbelt wird.
„Mach das Fenster auf, Pupperl, ich ersticke“, sagt der Vater.
Fenster auf.
„Es zieht“, raunzt die Omama, die im Fond sitzt.
Fenster zu.
Der Kleine wird nicht gefragt.
In Mödling, im Süden Wiens, endet die Fahrt fürs Erste.
Inzwischen wurde der Bub mit Apfelspalten versorgt, der aber hasst die Fütterung, weil die Finger der Omama nach Maggi riechen. Er hasst diesen Geruch. Der Vater hupt. Am gegenüberliegenden Gehsteig steht eine dicke Dame, die gewisse Frau Plsek, und winkt. Als sie ins Auto steigt, hört man, dass ihre Oberschenkel aneinanderreiben und ein seltsam sirrendes Geräusch erzeugen. „Nylonreiber“ nennt man das, und das weiß der Erstklassler von seinem Schulfreund, dem rothaarigen Werner Karli, der zwar alles andere als ein Freund ist, weil er den Buben während des gemeinsamen Schulweges regelmäßig verprügelt, aber das Wissen um versteckte Geräusche verdankt er halt doch dem „Feuerpatsch’n“, wie manche in der Klasse zum Karli sagen.
Mit großstädtischem Schwung hält der Vater die Wagentüre auf, und sein „Pupperl“ mit der Dauerwellenfrisur wechselt in den Fond, während sich die Plsek auf den Beifahrersitz fallen lässt. Die Dicke ist Maklerin, das heißt, sie vermittelt Häuser, die gekauft werden – oder eben nicht. Ihr Risiko. Der Vater lässt den Motor aufheulen und ab nun wird die ganze Fahrt über geredet und geredet, die Vor- und Nachteile eines Eigenheims besprochen und das finanzielle Risiko abgewogen.
Der Opel ist schneidig unterwegs zu jenem Ort, der zu meiner zweiten Heimat werden sollte: ein Dorf, in dem die Felder noch mit Pferden bestellt wurden und die Schweine aus den Wohnküchen quiekten. Genau in einem solchen „Kuhdorf“ wollten die Eltern ein „Ferienhäusl“ für die Sommerfrische kaufen, wie sie sagten. Das aber weiß der Bub zum Zeitpunkt des Einsteigens der Frau Maklerin Plsek noch nicht.
Was er weiß, ist dies: Die Dicke riecht nach Fisch. Kaum nämlich hat sich die Reisegesellschaft in Bewegung gesetzt, entfaltet sie auch schon ein Butterbrotpapier und legt ein Mordstrumm Stück Scholle frei, das in reichlich Fett herausgebacken wurde. Im Auto wird es still. Der Vater schnippt mit dem Finger, das tut er, wenn seine Hände das Lenkrad umfassen und er nervös ist. Er schnippt also, während die Mutter das Fenster herunterkurbelt, die Omama eine neuerliche Apfelspalte abschneidet und sie mit ihren Maggi-Fingern dem Buben in den Mund stopft – die Gelegenheit ist günstig, denn der hat alle seine Sinne auf die Frau Plsek gerichtet. Die ganze Fahrt über schnabuliert die Maklerin am Fisch herum, wie die Omama später nicht müde wird zu erzählen.
In der Hinterbrühl ist der Fisch Geschichte, und während der Wagen das berühmte Gasthaus Höldrichsmühle passiert, kommt Frau Plsek zur Nachspeise. Ein riesiger Pfirsich landet auf dem Fischpapier und wird mit einem Taschenfeitel fachgerecht zerlegt. Der Saft trenzt auf den Plsek’schen Schoß, während der Vater schnippt, die Mutter auch das gegenüberliegende Fenster herunterkurbelt und die Omama die letzte Apfelspalte im Mund des Spangerlbuben versenkt.
Wir sind da. Der Vater steigt aus und fingert nach einer Belohnungs-Nil. Ronson. Flamme. Nicht hält er der Maklerin die Autotüre auf, denn kaum sind wir angekommen, hat er nur noch Augen für das „Objekt“. Alle bis auf die beleibte Plsek steigen aus. In einem schönen, großen Obstgarten liegt ein verfallenes „Pförtner-Häusl“. Vater, Mutter und die Omama umrunden es und wackeln mit den Köpfen. Ich wage nicht, die dicke Frau anzusehen, denn mir gefällt hier genau nichts. Ich weiß nur eines. Meine neue Leibspeise ist Backfisch und Pfirsich, beruflich wäre ich am liebsten Maklerin, und das alles muss ich unbedingt dem Werner Karli erzählen, vielleicht verprügelt er dann nicht mich, sondern die Plsek.
2020. Alles war wohlüberlegt, gut geplant und mit Bedacht gewählt, nur die Vorbereitungen, die ließen sich Zeit. Es brauchte eine Menge Geduld, aber bei großen Entscheidungen ist das so. Auch das Gepäck konnte sich sehen lassen: So ziemlich alles, was sich in den letzten Jahren angesammelt hatte, musste mit. Über die Dauer dieser Reise mochte ich mir keinen Kopf machen. Nun, da so vieles hinter mir liegt, wollte ich mir Zeit nehmen für den entscheidenden Schritt. Und eines Tages war es so weit. Wie bei allen Abschieden wagte ich nicht, zurückzublicken. „Die Türe fiel ins Schloss, eine andere wird sich auftun“, dachte ich. Ich fasste nach jener Hand, die ich im Leben nie, nie wieder loslassen möchte. Der Unterschied zwischen Reisenden und Touristen ist der, dass der eine seine Gewohnheiten zu Hause lässt, während der andere das Gegenteil tut. Für den Touristen ist nichts so, wie er es gewohnt ist, der Reisende aber genießt, dass die Welt auf den Kopf gestellt ist.
Wir ließen unseren Gefühlen freien Lauf und heulten um die Wette. Wir beide. Auch Erwachsene tun dies, wenn sie sich freuen. Wir stiegen aus. Erst jetzt bemerkten wir, dass wir einander immer noch an den Händen hielten. Das Haus, auf das wir uns so lange gefreut hatten, unser Haus, war fertig. Wir betraten es.
Das „Ferienhäusl“, das mein Vater damals erwarb, und in dem ich den Großteil meiner Kindheit verbracht habe, ist längst verkauft. Als ich zum Mann wurde, übersiedelte ich zurück in die Großstadt. Nun, da ich erwachsen bin, zieht es mich wieder hinaus in den Wienerwald – ins hundertjährige Niederösterreich. Zwischen damals und heute liegt ein Menschenleben. Reisen ist immer auch eine Möglichkeit, mein Leben neu zu ordnen, um mich vor der Müdigkeit zu bewahren. Ich bin angekommen. Endlich. Bei dir.
Gscheitblöd
Museum Nonseum, Poysbrunner Straße 9, 2171 Herrnbaumgarten
Was haben die Kunst des Scheiterns, reziproker Unsinn oder die Absurdität der Logik gemeinsam? Sie sind das Ergebnis jahrelang betriebener Forschung der Denkfabrik Verein zur Verwertung von Gedankenüberschüssen, der am Flaschenhals des nordöstlichen Weinviertels seine Claims eingeschlagen hat. Schon alleine die Anreise lohnt, führt sie doch vorbei an den Säulenheiligen hiesiger Volkskultur: Grüner Veltliner, Welschriesling und Burgunder. An unüberschaubar weiten Anbauflächen, schmucken Weingärten und romantischen Kellergassen schlängelt sich der Weg an Schänken und Bänken, Trauben und Lauben entlang. Langsam, aber zielgerichtet schluckt sich der Vespista durch regionale Edelreben, bis hin zu den Disponibilitäten der hübschen Marktgemeinde Herrnbaumgarten, Bezirk Mistelbach. Dort angekommen, geht’s erst richtig los. Lebensversteher und Schluckspechte kommen Glas um Glas auf ihre Rechnung. Im hiesigen Nonseum nämlich ist der tiefe Unsinn zu Hause, verfügt das Haus doch über ein reichhaltiges Angebot an Erstaunlichem: Die Palette reicht vom mechanischen Nasen-Bohrer, hölzernen Ein-Tritt und würfelförmigen Tisch-Tuch, bis hin zum selbst gestrickten Trachten-Pärchen-Wärmer, eine Art „Loden-für-Hoden“. Hier gibt’s nichts wirklich, davon aber mehr als genug.
Der phantastische Regionalist Fritz Gall
Vor dem „Zentrum zur Abkehr von Nützlichkeitsgedanken“ schwinge ich ab. Tiefer Sinn erschließt sich nur demjenigen, der zu denken gewillt ist. Für Flachwurzler ist das nichts, versteht sich das Institut doch als Bedarfsanstalt für Überlebensstrategien.
Da ich für jede Art von Oberflächenberatung empfänglich bin, habe ich für heute einen Behandlungstermin gebucht. Pünktlich wie der Unsinn erscheine ich vor Ort – gut ausgeruht und, das vor allem, halbwegs nüchtern. Der „phantastische Regionalist“ und Bildhauer von Weltruf Fritz Gall, einer der Gründerväter der „Anstalt nonsealen Schwachsinns“, bittet mich, am Behandlungsstuhl Platz zu nehmen.
„Hier werden alle Arten von Lebenshilfe gebaut, müssen Sie wissen“, sagt er, mustert mich mit einer Mischung aus Fachwissen und Desinteresse, und bevor ich noch antworten kann, eröffnet er die Sitzung mit einer Gewissensfrage: „Weiß oder Rot?“ Ich muss mich, scheint’s, noch einhören in hiesige Terminologie, also frage ich: „Wie bitte?“, und ehe mein Gegenüber nach Luft schnappt, sage ich: „Espresso.“ Prof. Gall zuckt die Achseln und schleppt sich zur Hausbar, direkt hinter der Museumskassa. Das Gespräch, kaum begonnen, ist jäh beendet. Ich blicke mich um. Klimbim und Kokolores, Kitsch und Klumpert. Ein Sammelsurium sinnloser Wichtigkeiten rundum: Der „Anonymitätsbalken zur Wahrung höchsteigenen Inkognitos“, der „Suppenteller mit integriertem Abfluss“, ein, im Fall der Fälle, „selbstfahrender Nachttopf“, oder, einer der Höhepunkte der Sammlung, das „Potjomkin’sche Knopfloch aus dem zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts“. „Wenn wir schon beim Loch sind, die gibt’s bei uns in verschiedenen Größen, stilistisch quer durch die Epochen“, sagt Prof. Gall, der mich wohl schon eine Zeit lang beobachtet und auf ein paar Plastiksäckchen deutet. Ich bin offensichtlich recht am Ort. All jene, die das Nichts suchen, werden hier fündig.
Der Herr Direktor platziert eine winzig kleine Schale auf ein Tischchen, darin ein tiefschwarzes Gebräu schwabbelt, als hätte er Holzkohle weich gekocht.
„Wo waren wir stehen geblieben?“, fragt er und ich, der ich mich durch die Hitze des Getränkes kämpfe, bin kurz ratlos. „Richtig!“, sagt er, „Klamauk mag ich gar nicht.“ Er ruckelt einen Heizstrahler heran, dabei verheddert er sich im Kabel, sodass das Ungetüm ins Schwanken gerät und auf mich zu stürzen droht. Beide reißen wir die Arme hoch, dabei entgleitet ihm das Weinglas und mir schwappt die heiße Schlutze über die Hose.
„No problem“, flüstere ich, und er sagt: „Wir sind hier auf der Suche nach dem Missing Link für Situationen, die nicht gelöst sind. Das sollten Sie wissen.“ Darauf ich: „Der Gedanke ist mir soeben auch gekommen.“ Damit wäre das Wichtigste geklärt, wir können uns Nebensächlichem widmen.
Herr Gall zündet sich ein Zigarettchen an und beginnt den Rundgang mit: „Scheitern ist Lernen“, worauf ich erwidere … ja, was sagt man darauf? Ich grunze ein bisschen herum, womit auch dieses Thema durch ist. Hernach wieseln wir kreuz und quer durch die Ausstellungsräume, vorbei an Vitrinen, Schaukästen und Glasschränken, und ich staune und ich nicke und ich versuche weder-noch zu wirken, bloß nicht zu intelligent, aber keineswegs dümmlich. Ich bin reichlich verwirrt.
„Unser Museum ist Freiraum“, sagt der Professor, „wir entwickeln hier Dinge, die kein Mensch braucht. Die Optik aber, die muss stimmen. Verstehen Sie?“
Ich nicke.
„Mit dem ‚Wandertag für Pessimisten‘ haben wir die hiesige Zivilbevölkerung für uns gewonnen. Ein Riesenerfolg. Getoppt wurde er noch von der Veranstaltung ‚Handtuchwerfen für Politiker‘. Von überall kamen sie angereist: Gemeinderäte, Mandatare, sogar ein Bürgermeister war dabei. Es war überwältigend. Und alle haben geworfen. Alle.“
In einem der Glaskästen sind ein paar Vogelknöchelchen ausgelegt. „Was ist das?“, frage ich.
Herr Gall blickt mich streng an: „Eines unserer wertvollsten Exponate – das Skelett des österreichischen Doppeladlers.“ Gleich daneben liegt eine kolorierte Fotografie, auf der die Kaiserin Sisi zu sehen ist, neben ihr hockt ein Adler mit Vespentaille, aber zwei Köpfen. „Man hat die Knochen hier in einem Keller gefunden. Eine archäologische Sensation. Ging durch die gesamte Lokalpresse.“
Das einzige Sockenhospiz des östlichen Weinviertels
Der Herr Direktor öffnet eine Türe und gleitet hinaus in den noch winterschläfrigen Hof. Hier wartet die nächste Überraschung: Wäscheleinen, darauf jede Menge gekluppter Socken. „Wir sammeln Einzelstücke.“
„Findeln?“, frage ich, einfach, um auch ein bisschen lustig zu sein.
„Ein Hilfsprojekt …“, sagt Herr Gall streng, „Socken kommen von Natur aus paarweise auf die Welt, im Laufe der Jahre aber geraten sie in Gefahr, zu vereinzeln, so wie wir Menschen auch. Wissenschaftler beobachten das mit Sorge und deshalb gönnen wir ihnen hier ein Altern in Würde. Eine Art Sockenhospiz, wenn Sie so wollen. Die Anteilnahme der Bevölkerung ist überwältigend: Mit Schicksalsschlägen kann sich jeder identifizieren.“
Und jetzt sprudelt’s nur so aus ihm heraus. Meine Feder glüht: „Unser Verein ist aus der ‚1. Österreichischen Nonsens-Erfindermesse‘ hervorgegangen. Bald danach kam das ‚24-Stunden-Weinbergschneckenrennen‘, der ‚Seufzersteig‘, auf dem die Teilnehmer so viel seufzen konnten, wie sie wollten (‚Oh mei!‘, ‚Warum grad i?‘), und die ‚Unglückskonferenz‘, eine Kombi aus Krenreißen und Zwiebelschneiden, wobei eine Publikumsjury entschied, welcher Kandidat als Erster heult.
Startschuss für unser Haus aber war das ‚Aufstellen von Vogelscheuchen‘ (unzählige Besucher kamen und stellten ihre Scheuchen auf), der ‚Urstrumpf-, Erb- oder Milli-Tanten-Tag‘, die ‚Denkumenta Triviale‘ oder das ‚Festival der Gerüche – Wenn Nasen große Augen machen‘, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, die unser Haus groß machten.“
Seither gilt das Nonseum den Gscheitblöden aus nah und fern als der Nabel ihrer geistigen Übernachtung. Ein weißer Fleck in der Topografie des Weinviertels wurde bunt, der Rand der Republik geriet zum Epizentrum von Spritz-Findigkeit. „Das Leben ist eine Lawine: Einmal rauf und einmal runter“, befand der jenseits unser aller Grenzen forschende Karl Valentin – und er sollte recht behalten. Aber auch hier, in tiefer Grundlosigkeit, wird drauflosgescheitelt, dass es eine Freude ist: Herr Gall und seine Schutzbefohlenen denken, was der Kopf hergibt. Und das ist gar nicht wenig. Unsinn destilliert Weisheit, Weisheit Witz, Witz Nonsens und Nonsens Unsinn. Der Kreis schließt sich. Alles wird gut, aber nichts besser. Das ist wichtig. Die Welt wäre ärmer ohne die Gscheitblöden aus Herren- und Damenbaumgarten.
Solange Fernsehstationen wie die BBC oder der ORF, Berichterstatter aus Südafrika, Korea oder Mauerbach sich zu ihnen bemühen, liegt ihr Haus keineswegs am Arsch der Welt. Und wenn schon, dann eben an einem besonders hübschen. So viel Ehre darf, soll, muss sein!
Veronika, der Lenz ist da
Biogemüse Gut Markhof, Familie Brandenstein, Gut Markhof 1, 2293 Schönfeld im Marchfeld
Er gilt als der Graf Bobby des Gemüses: exquisiter Geschmack, fulminantes Aussehen und eine Attitüde, die sich gewaschen hat. Gemeint ist der unter der botanischen Fachbezeichnung bekannte Asparagus officinalis, seine Majestät der Spargel. Mit Pauken und Tschinellen hielt er alljährlich, kaum dass sein signifikantes Ponem das Licht der Welt erblickte, Einzug in die seitenblickende Promi-Gaststätte im nördlichen Norden Wiens. In Deutsch-Wagram kamen sie zusammen, die oberen und die unteren Zehntausend heimischer Prominenz, einberufen und vor die Linse geschubst vom legendär-schnurrbärtigen Szenewirt Gerhard B.
Wer konnte sich seiner Gastfreundlichkeit entziehen? Kaum nämlich schwoll das fesche Spitzerl in den aufgehäuften Feldfurchen des Marchfeldes, marschierten auch schon die Wagramer Majoretten in Reih und Glied durch die mit Botox-Jaukerln hochgetunte Promi-Schar, die sich dicht an eng im Speisesaal der Weltwunderkuriosität Marchfelder Hof drängte. Unter den Augen Ihrer Herrlichkeit, der örtlichen Spargelkönigin, dirigiert vom Herrn Chef persönlich, hielt Krethi und Plethi den Korb mit der aphrodisiakumösen Ware in die Kameras, und während die alten Herren losprusteten vor Anzüglichkeit, senkten die Damen den Blick zu Boden und kicherten verschämt in sich hinein – oder war’s umgekehrt? Auch der Schreiber dieser Zeilen war ein ums andere Mal adabei, sehr zur Verwunderung seiner hochkulturigen Kollegen, die aber nur so lange lästerten, bis sie selbst die Vorladung erhielten, der sie nichts lieber als nachkamen. Der Beginn der Spargelzeit war dem Marchfelder Promi-Wirt ein ums andere Jahr ein langstieliges Fest wert.
Das Spitzerl muss atmen.
Manch ein Liebhaber des zarten Wohlgeschmacks teilt sein kulinarisches Jahr in „Spargelzeit“ und die Zeit „davor“ und die Zeit „danach“ ein. Ob als Mousse oder Flan, Parisienne oder Flamande, das Kaisergemüse schmeckt immer gut. Voraussetzung: Er ist frisch, nicht holzig, gut abgebrüht und mit einer knackfesten Krone versehen. Die Köche dieser Welt überbieten sich: Risotto, Pudding, Eis, Salat oder Suppe. Aus Spargel lässt sich alles machen, dazu muss man nicht einmal kochen können oder wie meine Mutter, eine gefürchtete Gourmetkritikerin, formulierte: „Frisch muss er sein und gut!“ Dem ist nichts hinzuzufügen.
Ein Bericht über das hundertjährige Land wäre unvollständig, käme nicht auch das ultimative Gemüse zu Wort. Im Marchfeld überbieten sich die Spargelbauer alljährlich mit dessen Qualität und Quantität. Ich wähle eine Nummer und bitte um Audienz. Mein Augenmerk fiel auf die Bio-Landwirtschaft Brandenstein, den Markhof im fernen Schönfeld. Dort residiert die Familie, die herkunftsmäßig so gar nicht aus hiesiger Scholle stammt.
„Meine Frau und ich haben uns beim Studium kennengelernt …“, erzählt Herr Brandenstein, „so manch eine Vorlesung haben wir aber lieber gemeinsam am Bauernhof beim Ernten oder Stecken verbracht. Taschengeld inklusive. Schon damals faszinierte uns die Kultivierung des Spargels: Sie ist kompliziert und komplex.“
Tatsächlich gibt’s die Langhälsler beinahe so lange, wie es Menschen gibt. Die ersten sprangen vermutlich in Vorderasien aus der Erde, aus dem Sandboden feuchter Flusstäler. Auch die (damals jungen, heute alten) Griechen und Römer liebten das feine Gewächs. In Eurasien, Afrika, China, überall dort, wo Menschen Wert auf gutes Essen legten, kam die elitäre Stange auf den Tisch. Die Völkerwanderung und das Ende des Römischen Reiches waren der vorläufige Marktschluss in Europa. Nur in manch verschwiegenem Klostergärtlein überlebte die stimulante Pflanze.
Erst im 17. und 18. Jahrhundert feierte der Spargel sein Comeback, zu einer Zeit, als sich die Küchenchefs der Kaiserhöfe im Raffinement exquisit zubereiteter Speisen zu übertreffen begannen. Wie der Herr, so das G’scher, also besann sich auch der „Kleine Mann“ der unteren gesellschaftlichen Etage des köstlichen, nicht nur aus kulinarischer, sondern auch aus medizinischer Sicht hochinteressanten Stangenwerks. Das Kaisergemüse war plötzlich wieder in aller Munde. Das Symbol des Frühlings, die unsere Sinne stimulierende Vorfreude auf alles Wachsende tat das Ihre: Der Asparagus wollte nicht mehr vom Teller.
Mitte der 1970er-Jahre setzte sich die Aufzucht des Spargels hierzulande dauerhaft durch.
„Etwa zehn Jahre später begannen wir“, sagt Herr Brandenstein, nimmt auf seinem Traktor Platz und beginnt, mich auf seinem Zwanzig-Hektar-Gutshof herumzukutschieren.
„Warum Bio?“, schreie ich, denn der Motor des Ungetüms ist so laut, dass unsere Konversation schwierig zu werden droht.
„Gesunder Boden, gesunde Pflanze – gesundes Grundwasser, gesunder Mensch!“, brüllt er zurück und legt sich in die Kurve des Feldweges, sodass ich mich festkrallen muss, um nicht Block und Bleistift zu verlieren.
„Einleuchtend. Aber wo beginnen?“, rufe ich und verkeile mich am Gerät, einige Halsen liegen noch vor uns.
„Man muss in die Natur hineinschauen, versuchen, die Zusammenhänge zu durchschauen. Eines bedingt das andere. Natürlich verteuert es die Ware, aber es macht sich bezahlt. Irgendwann wird Bio billiger sein als konventionell gezogenes Gemüse.“
Bio-Landwirt Brandenstein
Dann nämlich, wenn wir die Folgeschäden für das Gift, das im Boden zugunsten schnellen und perfekten Wachstums versenkt wird, bezahlen müssen. Das sagt er aber nicht, das denke ich. Und ich denke noch etwas: Wie unsinnig nämlich „genormte“ Ware ist, die aus logistischen Gründen in den Verkaufsregalen der Supermarktketten landet: gleiche Größe, gleiche Farbe, gleiches Aussehen. Wie schön wäre es, wenn Diverses, Ungenormtes, aus der Art Schlagendes in Körben landen dürfte. Um wie viel lieber würde Hausfrau/Hausmann zugreifen? Aber nichts da: Aussehen schlägt Inhalt. So lange, bis das große Umdenken beginnt.
„Unser Betrieb ist einer der größten Bio-Landwirtschaftsbetriebe Österreichs, einer der wenigen Bio-Spargel-Höfe, dessen Produkte unter der Ja! Natürlich-Linie angeboten werden. Das macht mich stolz. Und es ist der schöne Lohn für die unendlich viele Arbeit, die der Spargelanbau bereitet.“
„Weshalb macht der so viel Arbeit?“, frage ich. Ich möchte die ganze Wahrheit hören.
„Spargel ist Handarbeit. Und der erste Ertrag lässt Jahre auf sich warten. Erst wenn die Wurzel bereit ist, schickt sie zaghafte Triebe aus der Erde. Das ist der Spargel. Die Dicke hängt von der Sorte und vom Widerstand der Erde ab. Je schwerer sich das bleiche Stangerl tut, um sich durchs Erdreich zu buddeln, desto muskulöser und ausgeprägter wird es.“
Wissen ums Wesentliche. Gemüse anbauen, so scheint es, ist komplex. Allzu schnell verdirbt die Ernte, aus welchen Gründen immer. Die Existenz des Landwirtes hängt davon ab. Und dass Ernten gelernt sein will, erklärt mir der Herr Spargelphilosoph zum Abschied: „Erst mal muss man die richtigen Erntehelfer finden, man muss sie und ihre Familien gut unterbringen und verköstigen, man muss sie fair bezahlen, man muss sie in eine Gesellschaft, oft tausende Kilometer weit weg von zu Hause, integrieren. Dies ist die Gegenleistung für ihre harte, sehr harte Arbeit.“