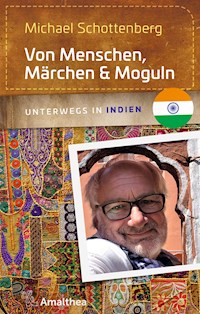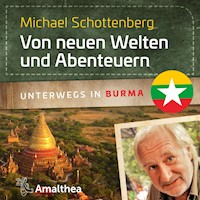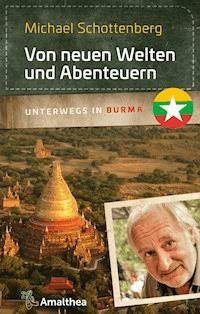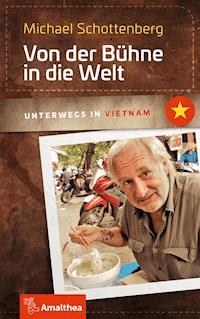Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Schotti to go
- Sprache: Deutsch
Mit Schotti durch Wien "Wien ist Orient und Okzident, Gemütlichkeit und Perfidie, eine Melange aus himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt." Reisephilosoph Michael Schottenberg hat eine besondere Beziehung zu der Stadt, in deren schummrig beleuchteten Nachkriegsgassen er einst das Licht der Welt erblickte. Mit liebevoller Zuneigung und doch kritischem Blick trifft er hier neben Wiener Grant und Heurigenglück auf alteingesessene Originale, versteckte Friedhöfe und Märkte sowie bewegende Orte der Erinnerung … »Wien für Entdecker« ist die Liebeserklärung eines Weltenbummlers an seine Heimatstadt: ein Kaleidoskop von menschlichen Begegnungen, persönlichen Momentaufnahmen und überraschenden Entdeckungen. Mit zahlreichen Extra-Tipps und Reisefotos in Farbe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
SCHOTTI TO GO
Michael Schottenberg
Wien für Entdecker
Mit 71 Fotos
Bildnachweis
Alle Bilder stammen von Michael Schottenberg mit Ausnahme der folgenden: Ulrik Hölzel (5,8, 10, 34, 102, 141, 174, 208, 218, 223, 224), Archiv Michael Schottenberg (15, 16, 19, 20, 168), Josephinum – Ethik, Sammlungen und Geschichte der Medizin, MedUni Wien/Foto: Ablogin (94), Archiv Amalthea Verlag (122), Blühendes Konfekt (203, 205), PID/Christian Jobst (216)
Der Verlag hat alle Rechte abgeklärt. Konnten in einzelnen Fällen die Rechteinhaber der reproduzierten Bilder nicht ausfindig gemacht werden, bitten wir, dem Verlag bestehende Ansprüche zu melden.
Besuchen Sie uns im Internet unter:
amalthea.at
© 2022 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und Satz: Johanna Uhrmann
nach einem Design von Valence/www.valencestudio.com
Umschlagfoto: © Ulrik Hölzel
Lektorat: Madeleine Pichler
ISBN 978-3-99050-221-1
eISBN 978-3-903217-89-8
Für Claire
Inhalt
Die Reise beginnt
Von einem, der sprachlos zur Welt kam und erst viel später die Worte fand
1 Am Fliederfriedhof
Friedhofspark St. Marx, Leberstraße 6–8, 1030 Wien
2 Der Mistkistlgott
Josef Thon und die MA 48, Deponie Rautenweg 83, 1220 Wien
3 Die Geschichtenstadt
Gartenstadt Lockerwiese, Camillianergasse 1–35, 1130 Wien
4 A. E. I. O. U.
Domkirche St. Stephan, Stephansplatz 3, 1010 Wien
5 Die Vermessung des Glücks
Alpaka-Wandern, Ecke Zemlinskygasse/Willergasse, 1230 Wien
6 Der Tag des Herrn Vo
Vegan Soul – Vegan Vietnamese Kitchen, Reinprechtsdorfer Straße 56, 1050 Wien
7 Der Blick zurück
Wiener Liliputbahn, Prater 99, 1020 Wien
8 Wann wenn jetzt nicht
Studio Six, Zieglergasse 54, 1070 Wien
9 Bim, na bumm!
Rent a Bim – Oldtimerstraßenbahnfahrten, Fruethstraße 11, 1030 Wien
10 Schuhspitzenverlängerungstänzer
Peter Sengl, Leopold Museum, Museumsplatz 1, 1070 Wien
11 Eine Schönheit aus Wachs
Josephinum – Sammlungen der Medizinischen Universität Wien, Währinger Straße 25, 1090 Wien
12 Denk mal
Lueger-Denkmal, Dr.-Karl-Lueger-Platz, 1010 Wien
13 Es grünt so grün
Rapid-Charly, Allianz-Stadion, Gerhard-Hanappi-Platz 1, 1140 Wien
14 Der andere Raum
Trauerredner Carl Achleitner, Friedhof Mauer, Friedensstraße 6–16, 1230 Wien
15 Donaudampfschifffahrtsgesellschaft
Am Donaukanal, 1010 Wien
16 Heut’ kommen d’ Engerln auf Urlaub nach Wean
Wien und der Wein – Von den Buschenschänken der Außenbezirke
17 Loos-Punk
Marianne Kohn, Loos American Bar, Kärntner Durchgang 10, 1010 Wien
18 Fake as fake can
Fälschermuseum, Löwengasse 28, 1030 Wien
19 In anderen Zeiten
Hornmanufaktur Thomas Petz, Nobilegasse 13, 1150 Wien
20 Die Erinnerung
Verein Steine der Erinnerung, Ungargasse 46/4, 1030 Wien
21 Mein Kamm
Erich Joham, Salon Hoaschneida, Griechengasse 7/Top 5/6, 1010 Wien
22 Reif für die Insel
Die Donauinsel – vom Einlaufbauwerk Langenzersdorf bis zum Ölhafen Lobau
23 Occhi e bocca
Magischer Klub Wien, Präsident Magic Christian, Stiegengasse 9, 1060 Wien
24 Opa Fritz und die Unverkäuflichen
Karmelitermarkt, Im Werd, 1020 Wien
25 Ob-La-Di, Ob-La-Da
Oblaten-Erzeugung O. Sacher, Rechte Wienzeile 25–27, 1040 Wien
26 Weil’s Wurst ist
Würstelstand Zum scharfen René, Schwarzenbergplatz 15, 1010 Wien
27 Vom Retten der Welt
Reparatur- und Service-Zentrum R. U. S. Z., Lützowgasse 12–14, 1140 Wien
28 Unterm Zuckerhut
Blühendes Konfekt, Schmalzhofgasse 19, 1060 Wien
29 Draußt im Liebhartstal
Zur blauen Nos’n, Johann-Staud-Straße 9a, 1160 Wien
30 Willkommen in Kakanien!
Gipsdepot im Keller des Leopoldinischen Traktes, Hofburg, 1010 Wien
Der Autor
Die Reise beginnt
Von einem, der sprachlos zur Welt kam und erst viel später die Worte fand
Ein eleganter Herr überquert die Alser Straße. Mitten auf der Fahrbahn bleibt er stehen und fingert ein blaues, verdrücktes Nil-Päckchen aus seiner Sakkotasche. Es ist früh am Morgen, der Tag verspricht heiß zu werden. Ein Mistkistlwagen bremst ab, der Fahrer beugt sich aus dem Fenster: „Das nächste Mal schieb i Ihnen z’samm mitsamt Ihnerer feinen Wäsch’, Sie Pinkel, Sie!“
Ronson. Flamme. Der erste Zug ist der beste. Der Mann geht ein paar Schritte in Richtung Pelikangasse. An der Ecke befindet sich das kleine Papierfachgeschäft, in dem er stets die Minen für seine Druckbleistifte und Unmengen von Pauspapierrollen besorgt. Um diese Zeit aber ist es noch geschlossen. Gleich nebenan liegt das Café Elli.
Ein Servierfräulein sortiert Schinkenkipferln in die Kühlvitrine. Der „feine Pinkel“ stellt seinen Schuh auf die Fußablage des Barhockers und kratzt mit dem Fingernagel über die Plastikverkleidung der Sitzfläche. Das Geräusch ist ekelhaft. Die Kellnerin hebt den Kopf. Seine Lippen sind schmal, die Nase markant. „Wir haben noch nicht geöffnet, der Herr.“
Seine Augen streifen durch das Lokal, als ob er Bestand aufnähme. Draußen hupt es. Ein Arbeiter rollt einen leeren Koloniakübel zu dem auf der anderen Straßenseite wartenden Wagen.
„Sind Sie neu hier?“
„Wieso?“
„Weil ich Sie hier noch nicht gesehen habe.“
„Ich Sie auch nicht.“
Die Blondine angelt die letzten Kipferln aus dem Karton, während der Mann einen Rauchkringel durchs Lokal schickt. Die letzte Nacht steckt ihm in den Gliedern.
Das Dekolleté der Kleinen ist eine Augenweide.
„Was darf’s denn sein?“
„Schale Gold.“
„Is was, der Herr?“
Nervös greift der Mann nach dem Hut, den er auf die Theke gelegt hat, während sich die Blondine der Gaggia zuwendet, das Brühsieb füllt und lasziv den Hebel zu sich herunterzieht. Langsam tropft der Kaffee in die Schale. Geistesabwesend betrachtet der frühe Gast das Fräulein. Aus der Espressomaschine zischt heiße Luft in ein Kännchen und schäumt Milch auf. Hinter der Budel liegt ein Podest, weswegen sich die junge Frau zur Theke herunterbeugen muss.
„Sind der Herr ein Süßer?“ Sie lächelt. Ihre Zähne sind makellos.
Keine zwanzig, denkt der Mann. Laut sagt er: „Sacharin. Woher kommt denn die junge Dame, wenn man fragen darf?“
„Fünfzehnter.“
Die Kellnerin stellt die Schale auf den Tresen, worauf der Mann zwei winzig kleine, viereckige Ersatzzuckerstückchen aus seiner Pillendose angelt und in den Kaffee schnippt. Der heiße Schluck tut gut. Der Nil-Kaiser landet im Aschenbecher.
„Polente?“
Er schüttelt den Kopf.
„Dachte nur“, sagt sie und beugt sich erneut zur Vitrine hinunter. Ronson. Flamme. Nil, die zweite. Die Nacht sollte nur einen Drink lang dauern. Hat sie nicht. Der Mann zieht die Manschette hoch und sieht auf die Uhr, eine Schaffhausen. Kurz nach sieben. Sein Blick fällt auf die Uhr direkt oberhalb des großen Spiegels. Schmale Messingstäbchen markieren die Fünf-Minuten-Abstände, sie sind direkt an der Wand angebracht. „Café Museum …“ murmelt er. „Was bin ich schuldig?“ „So eilig, der Herr?“ Draußen setzt der Mistkistlwagen seine Tour fort und verschwindet in der gegenüberliegenden Feldgasse. Der Mann legt eine Münze auf den Tresen und verlässt das Tschocherl. „In zwei Stunden werde ich Vater, Sie Kind.“
Ich bin genau 33 384 960 Minuten alt. Das sind 556 416 Stunden, 23 184 Tage, 3312 Wochen. Oder 828 Monate. Wenn Sie dies lesen, habe ich schon ein bisschen mehr draufgelegt.
Mein Vater war Kirchenbauer. Vor dem Krieg. Nach dem Krieg nicht mehr. Keine Ahnung, weshalb. Wenn ich an ihn denke, sehe ich einen schweigsamen Mann vor mir. Haare nach hinten gekämmt. Brillantine. Fingernägel manikürt. Darauf legte er Wert. Als ich begann, ins Kino zu gehen, fand ich, dass der Filmstar Curd Jürgens genauso gut mein Vater sein könnte. Oder Hans Albers. So ganz weit weg von ihm waren sie nicht. Ich behielt es aber für mich, ich wollte nicht, dass mich meine Freunde auslachten. Die lachten schon wegen weit weniger. Auch wenn ich es mir selbst nicht eingestand, es machte mich stolz. Wer hat schon einen Vater, der wie Curd Jürgens aussieht? Oder wie Hans Albers?
Sprechen war nicht seine Stärke. Vielleicht, weil er während all der Nachkriegsjahre, als man ihn gefangen hielt, die Worte verloren hatte. Und ich, ich war wohl noch zu jung, um sie gefunden zu haben. Mit der Zeit begannen mich die vielen ungesagten Worte zu schmerzen.
Heute, Jahre nach seinem Tod, suchen wir das Gespräch miteinander öfter als zu seinen Lebzeiten. Was ließ ihn verstummen? Ich konnte den großen, dunklen Raum, der zwischen uns lag, nicht wegtun. Ich war zu schwach dafür. Die größte Zärtlichkeit, zu der er fähig war, war die, mir mit der Hand langsam über den Kopf zu streichen. „Goldschädi“, sagte er dann. Ich weiß noch, dass mich das erstaunt hat, ich dachte nämlich, dass ich brünett war. Das kam wohl daher, dass ich meine ganze Jugendzeit über nicht fähig war, mich im Spiegel zu betrachten. Ich fand, dass alle Welt besser aussah als ich. Spiegelblicke mag ich übrigens immer noch nicht. Fand mich mein Vater schön? War er stolz auf mich? Auf ein blondes Kind mit mäßigem Schulerfolg konnte man nicht stolz sein. Das habe ich mir so zusammengedacht.
Der Mann betritt das dunkle Haus und wendet sich der Portiersloge zu.
„Zu wem wollen Sie? … Otto?“
„Kennen wir uns?“
„Berta Kunz! Vor dem Krieg!“
„Vor welchem Krieg?“
Der Portier erhebt sich und öffnet ein niedriges Türchen: „Ja weißt denn nicht mehr? Klavier …“ Seine Wurstfinger machen ein paar Bewegungen, als wollte er ein Luftklavier anschlagen. „Na so was, Otto, dass ich dich hier treff!“
Du bist also mein Vater.
Goldschädi
Der Mann starrt den Portier an. Die Bar war tatsächlich „sein“ Lokal gewesen. Die neueste Musik, die schicksten Gäste, die feschesten Mädels. Die Berta Kunz! Gleich gegenüber der Albertina. Der Otto war Stammgast. Wer etwas gelten wollte in Künstlerkreisen, ging hier ein und aus. Und plötzlich war da noch jemand. Ein junges, fröhliches jüdisches Mädel. Anfangs kam sie in Begleitung ihrer Freundin Ilse. Später dann alleine. Man trank, man lachte, man tanzte. Das ging ein paar verliebte Wochen so. Und dann wurde es plötzlich still um die beiden, während es draußen auf den Straßen laut wurde. So lange, bis eines Augusttages die Zeit um sie herum den Atem anhielt. Hochzeit.
„Ich war dabei, als die Bombe einschlug, ganz in der Nähe. Ich bin hingerannt. Mehr als ein Krater war da nicht mehr. An diesem Tag ist nicht nur die Berta Kunz gestorben. Auch das Lachen“, sagt der Portier und hält Otto die Hand hin.
„Danke“, sagt Otto.
„Wofür?“
„Dass du gespielt hast. Ich bin dir noch etwas schuldig“ – und er greift in die Innentasche seines Sakkos.
„Bist du deppert, Otto? Du schuldest mir nix. Gar nix.“
„Doch. Ich wollte damals noch zurück. Ich erinnere mich. Du spieltest das Lied von der Zarah Leander. Aber das Pupperl …“
„Bist du wegen ihr nie mehr wiedergekommen?“
Der Mann wendet sich ab, und der Portier zwängt sich in seine Loge zurück. „Dritter Stock!“, ruft er dem Otto nach.
Keiner soll sagen, dass eine Geburt nicht so ziemlich das Anstrengendste ist. Kaum auf der Welt und schon überfordert. Neugierige Augen sehen mich an. Alle haben mächtig zu tun. Eine behäbige Frau hebt mich auf. Ich schreie. Jemand klopft mir auf den Popo. Ich schreie. Die Dicke legt mich auf eine Chromschüssel. „Vier Kilo zehn! Strammer Mann!“
„Sie Arme!“, sagt die Krankenschwester und beugt sich zu meiner Mutter hinunter. Jemand gießt mir Wasser über Kopf und Körper. Ich hasse das. Ich schreie. Ein riesiges Gesicht taucht vor mir auf.
„So, das wär’s. Gucki, Gucki! Gratuliere, Frau Architekt! Gut gemacht. Wenn Sie was brauchen, die Schwester Antschi ist für Sie da. Wiederschaun.“
Die Antschi legt mich auf eine Anrichte, und der Doktor verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Dann werde ich in eine Windel eingeschlagen. Ich schreie. Irgendwie fühlt sich das alles an, als wäre ich eine fette, kleine Made. Die Schwester legt mich in die Arme der Frau, die mich gerade geboren hat. In diesem Moment geht die Türe auf. Das Erste, was ich zu sehen bekomme, ist ein Hut. Ich denke: „Wenn das nicht Curd Jürgens ist.“ Nein, das denke ich nicht. Ich denke nämlich gar nichts. Doch, ich denke: „Du bist also mein Vater.“ Der Mann beugt sich herunter und streicht mir über den Kopf: „Goldschädi.“ Dann küsst er seine Frau. „Danke.“ „Er bedankt sich bei ihr. Aber ich habe die Arbeit gemacht“, denke ich. Ich bin auf der Welt.
Ankunft Winkelmannstraße. Meine Omama hat Tränen in den Augen. Vorsichtig befreit sie mich aus den Armen der Mutter und schleppt mich in die Küche, gleich rechts vom Vorzimmer, während meine Eltern in Richtung Schlafzimmer unterwegs sind. Mutter braucht Ruhe. Die Frau hat sich ziemlich verausgabt. Ich bin wirklich ein „Brocken“, wie Schwester Antschi befunden hat.
Meine geliebte Omama
Die Reise beginnt.
„Sch, sch, sch …“, sagt die kleine Omama, wiegt mich im Arm und dreht den Rechaud auf. Der Kaffee riecht gut, die Bohnen sind frisch gemahlen. Linde-Kaffee. Später werde ich mit den Plastiksachen spielen, die in jeder Packung vergraben sind. Kleine, bunte Möbel für ein Puppenhaus. Die alte Frau bedeckt mich mit Küssen. Das tut gut. Dann werde ich zu meinen Eltern hinübergetragen. Meine große Schwester beugt sich über mich, genau so etwas hatte sie sich gewünscht. Aber jetzt hat sie den Salat, denn zum Spielen tauge ich noch lange nicht. Als ich alt genug dafür war, war sie schon erwachsen.
„Mein Bruder riecht nach Petersilie! Ich hasse den Geruch von Petersilie!“, sagt sie und richtet sich erbost auf. Mein Kopf riecht nur deshalb nach Petersilie, weil die Omama gerade eine Gemüsesuppe zugestellt hat. So sollte es bleiben: Meine Mutter ist fertig von der Geburt, mein Vater murmelt „Goldschädi“, meine Schwester ist enttäuscht, weil ich nicht als Spielkamerad tauge und meine Großmutter kocht Suppe. Draußen quietscht der Siebenundfünfziger um die Ecke. Meine Reise beginnt.
Am Fliederfriedhof
Friedhofspark St. Marx, Leberstraße 6–8, 1030 Wien
Es gilt Kleintierverbot. „Bitte führen Sie Ihren vierbeinigen Freund in eine der Hundezonen im Bezirk“, steht auf einer Tafel gleich neben dem Eingang. Floristen allerdings sind hier ausgesprochen erwünscht: In keinem anderen Park in Wien gibt es so viel Blühendes auf engstem Raum. In unmittelbarer Nachbarschaft zur größten Staumeile Österreichs, der Südosttangente, befindet sich die wohl eigenartigste Grünanlage Wiens: der Fliederfriedhof von St. Marx. Auf einer Fläche von rund sechzigtausend Quadratmetern reihen sich inmitten eines im Frühjahr betörend duftenden Blütenmeeres Erinnerungen an eine längst versunkene Welt. Zuweilen wird diese lebendig. Wer Geschichten zu begreifen versteht, dem sei der Ort anempfohlen.
Betritt man das einzige vollständig erhaltene Biedermeier-Freiluftmuseum Wiens durch das aus Backsteinen errichtete Tor, findet man sich in einer anderen Zeit wieder. Längst wurden die Toten nach anderswo umgebettet. Manche von ihnen fielen wohl auch dem Vergessen anheim. Hinter so manchem Grabstein aber verbergen sich höchst lebendige Erzählungen. Der Zauberort ist Zeitreise pur. Schräge Steine in grasbewachsenen Gräberzeilen, vermooste Steinplatten, uralte Bäume. Die Grabinschriften offenbaren die eitle Welt der „Fabricanten“ und „Privatiers“, die bürgerliche Welt der „Officiale“, die der standesbewussten „Kanalräumers-Gattinnen“. Man verheddert sich im Gestrüpp hochtrabender Worte und Titel, wird umfangen vom Geist vergangener Tage, erfährt von Angestellten und Abgestellten, Bürokratie und Beamtenschaft, Witz und Willkür. Man muss nur verstehen zu sehen, und sehen, um zu verstehen. Zunächst wird man mit Namen überschüttet: Karajan, Kornhäusel, Kastan, Käfer. Ihnen gemeinsam ist der Vorname Josef. Josef K. Ich nehme auf einer der Bänke Platz.
Der Fliederfriedhof
Schuhe. Eine ausgetretene Zigarette. Menschen hasten aneinander vorbei. Andere stehen da und blicken sehnsuchtsvoll in die Ferne. Vor dem Blumenstand drängen sich die Verliebten. Eine verzerrte Lautsprecherstimme gibt die Ankunft des Personenzuges bekannt. Die riesige Lokomotive tut einen letzten, ohrenbetäubenden Seufzer. Dampf hüllt den Bahnsteig ein und nimmt den Wartenden die Sicht. Gepäckträger schieben schwer beladene Kofferwägen durch das Gedränge. Aus einer der Türen steigt ein junger Mann. Er trägt einen dunklen Mantel, auf dem Kopf sitzt eine Melone. Bedächtig schreitet er den Perron entlang. Seine Gesichtsfarbe ist fahl. Er könnte „Behelfskonzipient in auspicio“ einer jedweden Unfallversicherung sein, retour von einer kurzen Urlaubsreise in die Kaiserstadt. Er bleibt stehen, nimmt einen Bleistiftstummel zur Hand und kritzelt ein paar hastige Zeilen in sein Notizbuch. Auf der Mariánská-Straße, vor dem großen Jugendstilbahnhof, warten Droschken. Nicht eine davon besteigt er. Der junge Mann lässt das Geschiebe der sich gegenseitig die Limousinen abwerbenden Ankömmlinge hinter sich und geht zügig auf die ihn bald schon umfassende Stadt zu. Wie ein Tier der Nacht schmiegt er sich an feuchten Hauswänden entlang und geht durch düstere, vom fahlen Licht der Straßenlaternen spärlich erhellte Gassen des Bahnhofsviertels.
„Ihr Name, mein Herr?“ Ein Mann löst sich aus einem Hauseingang. „Nach einundzwanzig Uhr besteht Ausweispflicht.“
„Seit wann?“, fragt der junge Herr.
„Seit heute“, antwortet der Amtmann, „zu viel Ungeziefer auf den Straßen. Ihre Nummer?“
„R 31003. Ich bin selbst ein Käfer. Guten Tag.“
Über die Einfriedung eines der Gräber bewegt sich eine mit schweren Lasten bepackte Ameisenkolonne. Geschichten tragen mich fort. Ich folge dem Kiesweg aufwärts und streife zwischen Erdhügeln herum. Als Kaiser Joseph II. die Totenäcker außerhalb des Linienwalls anlegen ließ, wurde jedem Stadtsegment ein Friedhof zugeordnet. So fanden in St. Marx nicht nur die Verstorbenen der Bezirke Landstraße und Leopoldstadt ihre letzte Ruhestätte, sondern auch jede Menge beautiful people: Ringelspielbesitzer und Schausteller des fahrenden und fliegenden Gewerbes, der Nähmaschinengott Josef Madersperger, der griechische Zauberkünstler und Gasthausbesitzer Basilio Calafati, der Ingenieur, Erfinder, Komponist und Dirigent Josef Strauss, der Verleger und Komponist Anton Diabelli, der erst dadurch berühmt wurde, dass er alle namhaften österreichischen Komponisten bat, Variationen über ein von ihm vorgegebenes Thema zu schreiben (Ludwig van Beethoven beteiligte sich gleich mit Dreiunddreißig Variationen). Sogar das ewige Schweindl und unbändige Musikgenie W. A. Mozart fand hier in St. Marx seine Ruhe. Ein steinerner Engel mit Fackel wacht heute noch über ihn.
Ich verweile im Augenblick geborgter Zeit. Ein Mann nickt mir zu. „Wir kennen uns“, sagt er.
„Pardon?“
Er zuckt mit den Schultern und ich wende mich ab. Drüben, jenseits des Wiesenweges, sehe ich ihn wieder. Diesmal hält er ein Notizbuch in der Hand und studiert eine Grabinschrift.
„Seltsam“, sagt er. Ein Kind läuft mir in die Arme und erschrickt.
„Wir kennen uns nicht“, sage ich.
„Doch“, sagt der kleine Bub, beginnt zu weinen und hopst hinüber zu dem Mann.
„Es sieht ganz so aus, als ob du an mir hängst, mein Sohn?“, flüstert dieser und beugt sich zu dem Kind hinunter.
„Ich hänge nicht an dir, Vater. Ich bin fast schon groß.“
Das Grab des Genies
„Wann du groß bist, bestimme ich“, sagt der Mann und wischt dem Kleinen behutsam die Tränen aus dem Gesicht.
„Ich dachte, das bestimmt das Leben?“
„Ich habe es dir geschenkt.“
„Ohne, dass ich es wollte?“
„Deine Mutter wollte es ebenso wie ich.“
„Ist sie auch an dir gehangen, Vater?“
„Sehr. Und wir beide an dir. Das tue ich übrigens immer noch.“
„Ist es das, was mir manchmal wehtut?“
„Liebe tut immer weh.“
„Aber sie ist dennoch schön?“
„Schöner noch.“
„Und sie tut weh, Vater?“
„Sie tut weh, mein Sohn.“
Auf dem Grabstein vor ihnen steht in goldenen Lettern: „Frau Anna Schönmann, Bürgers und Hausinhabersgattin, gestorben am 20. Februar 1859 im 57. Lebensjahr“. Der Kleine setzt sich ins Gras, in der Hand hält er eine fünfblättrige Fliederdolde. Wieder beginnt er zu weinen, dabei fällt mir auf, dass Tränen stets gleich groß sind, egal ob auf dem Gesicht eines Kindes oder auf dem eines Greises. „Du hast Glück“, sagt der Mann und dann verschwinden beide zwischen den Grabsteinen.
Erinnerung zeichnet diesen Ort aus. Wie viele Mütter und Väter wohnten dicht an eng in ihren kleinen Grubenhäuschen, so lange, bis sie auf die Reise geschickt wurden. Mit der Errichtung des Wiener Zentralfriedhofes hat die Stadtverwaltung die St. Marxer Anlage als Friedhof geschlossen, ein Teil der Bestatteten übersiedelte nach Simmering. Später wurde der „Fliederfriedhof“ unter Denkmalschutz gestellt und als Park wiedereröffnet. Den nützen seither Söhne und Töchter aller Generationen, sie flanieren durch die schmalen Gassen der Ewigkeitsstadt und lauschen der Wehmut des Windes, der ihnen die Erinnerung an ihre Vorfahren ins Ohr flüstert.
Hier lagen sie alle, das „Einfache Mitglied der niederösterr. Landwirthschafts-Gesellschaft“, der „Herrschaftliche Wirthschaftsrath“, die „Fürstl. Esterhazy’sche Oberbuchhalters Witwe“, der „Bürgerl. Kanalräumer“, die „K. & K. Hofmundwäscherin“, der „Erfinder des giftfreien Emails“ bis hin zur „Geprüften Lehrerin“ und „Bürgerlichen Fischhändlers Witwe“.
Hinaus also, ihr Traumsucher, hinaus nach St. Marx, und lest die alten Geschichten, die sich hinter dem Vergessen verbergen. Entziffert die Zeit und lasst euch wegtragen von eurer Fantasie, die die Wurzeln verborgener Geheimnisse entwirrt. Wer an der Vorvergangenheit seiner Stadt Gefallen findet, dem steht der Besuch im Perfektum offen. Täglich von sechs Uhr dreißig bis zwanzig Uhr (von Oktober bis März bis achtzehn Uhr dreißig).
Der Mistkistlgott
Josef Thon und die MA 48, Deponie Rautenweg 83, 1220 Wien
Der Chef wieselt zwischen Kisten und Containern herum, vorbei an Laufmetern von Regalen, angefüllt mit Plüsch und Plunder, die nächste Halle ist befüllt mit Kehrwägen, Schneeräumern und Kiesfahrzeugen aus einer anderen Zeit, anderswo stapeln sich Berge von Tandlzeug wie Skistöcke, Kinderwägen, Fernsehleuchten und Kuscheltiere, draußen im Freien stehen ein paar dem Verschrotten entgangene und auf Hochglanz gebrachte Rübenbomber mit dem Emblem „Kehr Force One“, nebst einer stolzen Flottille ausrangierter Aufleger-Brummis. Sogar ein bestens instand gesetzter „Abort I. und II. Klasse“ aus dem Jahre Schnee ist aufgestellt.
„Das Waschbecken macht den Unterschied!“, ruft der Herr Direktor. Ein Gabelstapler kreuzt den Weg und der Chef springt zur Seite, lacht, grüßt, winkt nach links und nach rechts, schüttelt da eine Hand, klopft dort auf eine Schulter, spricht alle Mitarbeiter per Vornamen an, mit den meisten ist er sowieso per Du.
Der Herr über dreitausend 48er ist erstaunlich gut drauf. Hier am Rautenweg läuft alles wie am Schnürchen. Das tut es auch in den anderen städtischen Mistkübeln, den Müllverbrennungsbetrieben Spittelau, Flötzersteig und Pfaffenau, den Sonder- und Schlammentsorgungsanlagen (Wien ist weltweit die einzige Großstadt, die ihr Abwasser so gründlich von Schlamm und Unrat klärt, bis der Rest neunundneunzig Prozent Wasser-Sauberkeit hat), dem Kompost-Werk (das größte seiner Art in Europa), dem Biomasse-Kraftwerk und der Biogas-Anlage, ganz zu schweigen von den zweihundertsiebzig Mistkistl-Fahrzeugen, die sich täglich durch die Gassen quälen, um zweitausend Tonnen Abfall durch das Stadtgebiet zu transportieren.
Josef Thon, der Umtriebige, der mit knapp dreiundvierzig Jahren vom Stadt-Oberhäupl in den Job gehievt wurde, hält bei einer großen Plastikwanne. Sein begehrlicher Blick streift über unzählige Plattencover, um dann mit spitzen Fingern die LP seines Vertrauens herauszuklauben.
„The Doors – Jim Morrison, Robby Krieger, ein Traum!“ Dies ist, wie vieles andere auch, als Findelware aus Fundbüros, Entrümpelungen oder Zwangsversteigerungen angelandet und wird im Vorzeigebetrieb 48er-Tandler in der Siebenbrunnenfeldgasse 3 in Wien Margareten für gute Zwecke verhökert. Musik ist Chefsache: In seiner kargen Freizeit zerreißt der Herr Direktor für seine 48er-Tandler-Band Gitarrensaiten. Flugmaschinen sind sein anderes Hobby. Oder „schrebergrantln“. Oder Pinzgauer Ziegen und Sulmtaler Hendln streicheln. Jede Menge von denen tummeln sich nämlich als Rasenmäher auf den Abhängen der sattgrünen Donaustädter Müllentsorgungswiesen.
Abseits der täglichen Inspektionsfahrten tüftelt der Workaholic an Abfallstrategien. Wie wird aus Mist Strom, aus Energie Wärme? Als einer der international versiertesten Müllfüchse hat er erreicht, was keinem sonst gelungen ist. Wien ist weltweit die einzige Stadt, die ihren Dreck selbst entsorgt, vollständig und auf eigenem Terrain. Den Kollegen der Metropolen New York oder Rom treibt es Tränen der Begehrlichkeit in die Augen, und es bleibt ihnen nichts anderes übrig, als vom Wiener Know-how zu lernen. Das bitte möge der alten 48er-Dame, die im Jahre 2021 ihr Fünfundsiebzig-Jahr-Jubiläum feierte, einmal einer nachmachen. Josef „Pepi“ Thon ist zu Recht stolz auf seine lebenslange Liebe.
„Kehr Force One“