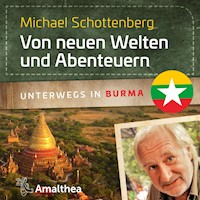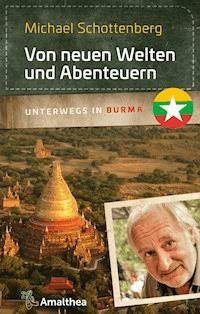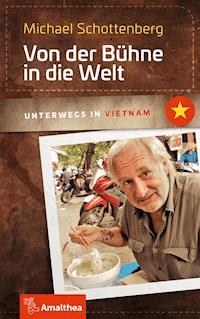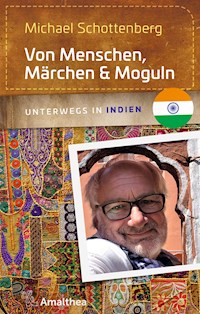
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Unterwegs mit Michael Schottenberg
- Sprache: Deutsch
Wo die Schönheit auf der Straße liegt Indien, Land der Wunder und Gegensätze, ist eine Herausforderung für jeden Reisenden. Auch für Michael "Schotti" Schottenberg, der fünf Wochen lang mit Rucksack und Notizbuch quer durch den asiatischen Subkontinent fährt, von Mumbai im Westen bis Kolkata im Osten. Was sich ihm bietet, ist eine Welt mit zwei Gesichtern, in der prunkvolle Märchenpaläste und leuchtende Farben neben bitterster Armut zu finden sind. "Indien ist ein unfassbar verwirrendes Land, ein Land der Zukunft, das im Mittelalter feststeckt. Indien ist Horror und zarter Liebeshauch aus 1001 Nacht, Fluidum geheimnisvoller Düfte und fauliger Geruch brennender Leichen …" Begleiten Sie Michael Schottenberg auf eine unvergessliche Reise, bei der Leben und Tod, Schönheit und Schrecken untrennbar miteinander verbunden sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Schottenberg
Von Menschen,Märchen & Moguln
UNTERWEGS IN INDIEN
Mit 80 Fotos
Die in diesem Buch beschriebene Reise fand von 15. Februar bis 20. März 2018 statt. Referenzen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Ereignissen beziehen sich auf den angegebenen Zeitraum.
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2020 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker/OFFBEAT
Umschlagfotos sowie alle Abbildungen im Buch: © Michael Schottenberg
Umschlaghintergrund: © iStock.com
Karte Seite 11: © arbeitsgemeinschaft kartographie
Lektorat: Madeleine Pichler
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11,25/14,7 pt Minion Pro
ISBN 978-3-99050-182-5
eISBN 978-3-903217-57-7
Für Claire
Inhalt
Welcome to Mumbai!
Amsterdam – Mumbai, 15. Februar
Eine Landung wie im Märchen
Mumbai, 16. Februar
Die Kuhherberge von Panjrapole
Mumbai, 17. Februar
Die große Seele
Mumbai, 18. Februar
Liebe auf Rädern
Mumbai, 19. Februar
Für meinen Freund
Mumbai – Udaipur, 20. Februar
Glück
Udaipur, 21. Februar
Ein Denkmal für ein Pferd
Udaipur, 22. Februar
Quer durch Rajasthan
Udaipur – Jodhpur, 23. Februar
Die Eroberung des Himmels
Jodhpur, 24. Februar
People of Bishnoi
Jodhpur, 25. Februar
Mitten im Leben
Jodhpur, 26. Februar
Die Wiedergeburt
Jodhpur – Jaisalmer, 27. Februar
Auch Göttinnen können beißen
Jaisalmer, 28. Februar
Happy Holi!
Jaisalmer, 1. März
Unglaubliches Indien
Jaisalmer – Bikaner, 2. März
Von Kamelen
Bikaner, 3. März
Die Ratten von Deshnok
Bikaner, 4. März
In neuen Städten
Bikaner – Jaipur, 5. März
Das Reiskorn
Jaipur, 6. März
Letzte Fragen
Jaipur, 7. März
Über Reisen
Jaipur – Agra, 8. März
Ein Grabmal der Liebe
Agra, 9. März
Paharganj
Agra – New Delhi, 10. März
In Nöten
New Delhi, 11. März
Mein Freund »Schotti«
New Delhi, 12. März
Das Museum
New Delhi, 13. März
Im Fegefeuer
New Delhi – Varanasi, 14. März
Burning Bodies
Varanasi, 15. März
An der Grenze
Varanasi, 16. März
Kleines Reisebrevier
Varanasi – Kolkata, 17. März
Sein oder Nichtsein
Kolkata, 18. März
Von Menschenrechten und Straßenbahnen
Kolkata, 19. März
Der letzte Weg
Kolkata, 20. März
Schottis Indien-Tops
Schottis Indien-Flops
Schottis Rezepte aus Indien
Welcome to Mumbai!
Amsterdam – Mumbai, 15. Februar
Das Zeug besteht aus Hefe, Mehl und Wasser, fühlt sich labbrig an und erinnert an die Edelreife einer Pampers. Riechen tut das Ganze entsprechend ambitioniert. »Happy Meal« nennt sich der Dreck, Süßgetränk inklusive. Willkommen in der Welt der Burger und Bouletten.
Tatort Schiphol, Amsterdam, Terminal 2. Ich trommle meine Bestellung gegen die Mattscheibe und ziehe Nummer 075. Eine gefühlte Ewigkeit später wirft ein Fräulein mit goldenem M auf der Schildkappe die Henkersmahlzeit auf den Plastikuntersatz. »Zero Seven Five!«, hallt es durch den Airport. Die Stimme klingt weltweit gleich. Meine letzte Mahlzeit auf europäischem Boden. Gate E7. Draußen parkt einer der hellblau bemalten Riesenvögel der Royal Dutch Airlines. Er wird mich in eine andere kulinarische Liga heben, in die Welt von Chili, Chutney und Chapati. Wie oft schon habe ich Abendgesellschaften mit extra scharfen keralanischen Genüssen verwöhnt. Der Weg ins Paradies führt geradewegs durch die Hölle: Auf dem Resopal vor mir stapelt sich ein Müllberg, als hätte ich ein Kleinkind gewickelt. Die Irrfahrt durch ein lasches Burger-Erlebnis endet auf der nächsten Toilette, zu Beginn eines Langstreckenfluges nicht unerheblich.
Meine Geburt als Reiseautor liegt hinter mir. Bücher, Lesungen, Interviews: Mein neues Leben hätte nicht abwechslungsreicher beginnen können. Nach so vielen Jahren auf der Bühne bin ich in einer anderen Hemisphäre aufgeschlagen – um erst recht wieder zu meinem Publikum zurückzukehren, als Weltenentdecker und Geschichtenerzähler. »Ich setze auf Inhalte« steht auf dem Umschlag des roten Büchleins, das ich erneut mit abertausenden Buchstaben vollkritzeln werde. Es wird nicht bei dem einen bleiben. Möge es eine phantastische Reise werden – eine Reise zu Menschen, Märchen und Moguln.
Neun Stunden später zwänge ich mich durch einen engen Geburtskanal: Dort vorne liegt Indien! Später als alle anderen betrete ich den Subkontinent. Ich habe bewusst einen Platz in der letzten Reihe gebucht, so habe ich alles noch länger vor mir.
Am Schalter mit der Aufschrift »Foreigners« drängen sich die Passagiere. Die Warterei dauert beinahe so lange wie der Flug. Es ist zwei Uhr nachts. Endlich bin ich dran. Der Beamte der Einwanderungsbehörde spricht Hindi-Englisch, er wackelt mit dem Kopf. Ununterbrochen stellt er dieselbe Frage. Ich sage, dass ich schon einmal den Süden seines Landes unsicher gemacht habe. Es sollte ein Scherz sein. Wieder schüttelt er den Kopf, wieder blättert er in meinem Pass. »Selbst gemacht«, sage ich und hoffe, dass er mich ebenso wenig versteht wie ich ihn. Er rülpst. Zehntausende Arrivals hat er bereits hinter sich, zehntausende liegen vor ihm. In seinem Blick liegt alles Elend dieser Welt – ähnlich einem Gecko-Baby, das seine Mutter sucht. Er deutet, ich möge die Brille abnehmen. Lange betrachtet er mein von schlaflosen Stunden gezeichnetes Gesicht. Ich halte dem Blick stand. Er schürzt die Lippen zu einem Kussmund. Was wird das, denke ich. Unsicher zwinkere ich zurück. Hinter ihm ist eine Kamera angebracht, die den Ist-Zustand des Asylsuchenden festhält. Und ich dachte schon, meine Reise beginnt mit einer kleinen Koketterie. Nichts da, er wartet auf einen entspannten Gesichtsausdruck meinerseits. Kann er haben. Klick. Stempel. Ich werde zum Handgepäckschalter weitergereicht. Wie jetzt? Was könnte ich gerade eben noch ins Gepäck geschummelt haben? Kurz darauf habe ich auch die letzte der sieben Prüfungen bestanden.
Ich bin drin. Das Abenteuer beginnt. Da lokale Banknoten nicht eingeführt werden dürfen, bleibt dem Globetrotter nichts anderes übrig als die Jagd nach Barem. Dabei aber sollte man besser ausgeschlafen sein. Die erste Maschine streikt, die zweite akzeptiert die Karte nicht, die dritte ist außer Betrieb und um die vierte balgen sich meine übermüdeten Kollegen. Per Zufallsgenerator spuckt die Maschine Geld aus – oder eben nicht. Bei mir nicht. Jemand weist mir den Weg aus der Halle hinaus, dort stehen angeblich noch weitere dieser Wunderkästen. Nachteil: Man muss den Airport verlassen und wird, so schnell kann’s gehen, zum Spielball von Häschern und Heilsversprechern. Inzwischen ist es vier vorbei. Der Rummel ist gewaltig. Wo, wenn nicht hier liegt das Geld auf der Straße. Arrivals sind willfährige Barzahler. Im Nu bin ich umringt von hilfsbereiten Geistern. Gemeinsam starren wir auf die Mattscheibe. Wird man vor dem Eintippen des Codes nicht immer vor »unbefugten Blicken« gewarnt? In Indien ist Geldbeschaffung Gruppenarbeit. In meiner Linken verspüre ich ein paar Weihrauchkörner. Rechts montiert mir ein Jünger Krishnas ein rotes Wollband ans Handgelenk. »Karma!«, flüstert er und rollt die Augen. Was soll ich um vier Uhr früh mit Karma? Ich brauche Geld. Aber das wollen andere auch. Die Menschentraube schnürt mich ein. Wer sagt’s, die Money Machine ist leer. Der Tross wechselt zur nächsten. Wie ich es letztlich geschafft habe, meine neuen Fans zu überlisten, weiß ich nicht, noch weniger, wie ich sie alle wieder loswurde. Mit einem Bündel glatt gebügelter Mahatma-Gandhi-Gesichter kämpfe ich mich in die Ankunftshalle zurück und lande bei einem der Prepaid-Taxi-Schalter. Ich bin viel zu müde, um auf den Bus ins Stadtzentrum zu warten – falls es so etwas überhaupt gibt. Mumbai hat über achtzehn Millionen Einwohner und mindestens die Hälfte davon strecken mir gerade die Hände entgegen.
»What’s your name?« Ein Kleinwuchs schnappt nach meinem Rucksack.
»Austria«, sage ich gedankenverloren.
»I’m Sebastian. European name. Cochin, Kerala!«
Na bitte. Vor Jahren bin ich kreuz und quer durch den Süden gereist, in der Stadt Cochin am Arabischen Meer habe ich eine schöne Zeit verbracht. Wenn das nicht verbrüdert. Ich versuche, mit Sebastian Schritt zu halten, eine endlose Rolltreppe bringt uns zwei Etagen tiefer.
»I never heard a name like Austria!« Der Kleine denkt nicht daran, mein Gepäck loszulassen. Der Chhatrapati Shivaji International Airport, benannt nach einem Marathenkönig aus dem 17. Jahrhundert, ist eine weit verzweigte Stadt unter der Stadt. »Short cut. Time is money!« Sebastian wackelt mit dem Kopf und verschwindet zwischen unzähligen mit laufenden Motoren wartenden Taxis.
»Air conditioning, Sir?« Wie aus dem Nichts taucht er vor mir auf.
»No«, sage ich. »AC is expensive!«
Er hält mir eine Autotüre auf und ich lasse mich auf die steinerne Rückbank fallen. Der Aufschlag in Mumbai ist härter, als ich dachte. Sebastian wirft die Kiste an, ich kurble die »Aircondition« hinunter. Sein Kopf erscheint neben mir im offenen Fenster.
»Small money, Austria. Please!« Er lächelt und hält mir die Hohle hin. Ich schüttle sie. Sein krätziger Schädel ist jetzt dicht neben mir, er riecht nach Patschuli und Raubtier. Ich krame den kleinsten der großen Scheine heraus, der Südinder schnappt sich den Lappen und verschwindet in der Dieselwolke eines unmittelbar vor uns startenden Rosthaufens. Hopsend vor Fehlzündungen verlassen wir das Flughafengelände.
»Otel?« Sebi betrachtet mich im Rückspiegel. Ich dachte eigentlich, dass das auf dem Prepaid-Formular steht. Bentley’s Hotel, Colaba. Letzteres ist der Name des Stadtteils. Der Typ hat sichtlich keinen Tau. Entweder ist meine Aussprache so miserabel oder es ist heute nicht sein Tag. Wahrscheinlich beides. Colaba war vor Kurzem in aller Munde, hier ereignete sich ein schwerer Terroranschlag. Indien und Pakistan werden in diesem Leben keine Freunde mehr.
»Close the window«, zischt Sebastian. Er hat recht. Hier ist sie, die Smog-Glocke, von der man in so ziemlich allen Touristenführern liest. Über dem Moloch hängt Tag und Nacht eine undurchdringliche Chemiewolke. In ein Taxi mit Klimaanlage zu investieren, wäre nicht verkehrt gewesen. Mit Vollgas brettern wir durch die Nacht. Schlaglöcher, Kühe, Mopeds, auf der Straße liegende Menschen, streunende Hunde. Die Fahrt nimmt kein Ende.
Am Colaba Causeway erwache ich in einem Nebel aus Dunst und Diesel. Die Gegend ist mir bekannt. Shantaram von Gregory David Roberts, eine abenteuerliche Mischung aus Science-Fiction- und Lovestory, ist ein Muss für Bücherwürmer.
»Otel?« Sebastian wendet sich genervt um, wahrscheinlich hat er die Frage bereits mehrmals gestellt.
»Bentley’s.«
Er wackelt mit dem Kopf und brüllt einen jungen Mann an, der gerade die Straße kreuzt. Ein Köter springt jaulend zur Seite, so scharf hält der Wagen. Der Junge schreit zurück. Das Taxi fährt, es hält, es fährt, es hält. Jedes Mal unterbrochen von Schreierei und ebensolcher Antwort. Mein Hotel ist, scheint’s, unbekannt. Weiter vorne steht das Taj Mahal Palace. Dort, wo einmal Straßen waren, wird jetzt Ackerbau betrieben. Wir befinden uns in einem willkürlichen Einbahnchaos.
Das Bentley’s sollte in unmittelbarer Nähe zum Gateway of India liegen. Hier betrat vor etwas mehr als einhundert Jahren der Opa von Königin Elizabeth II. erstmals indischen Boden. Ihm zu Ehren bauten sie einen Triumphbogen. Von hier aus will auch ich das Land erobern. Die ersten Europäer allerdings waren schon vierhundert Jahre früher da. 1498 legte Vasco da Gama in Kerala an, danach fielen nach und nach die Pioniere der Pauschalreisenden ein und begannen den Subkontinent zu plündern: Portugiesen, Holländer, Engländer, Franzosen und Dänen. Sie alle gründeten Handelsniederlassungen. Lückenlos.
Ich beschreibe Sebi den Weg, zu Hause habe ich mir den Stadtplan von Colaba eingeprägt. Einige Straßen später bringt er die Karre zum Stehen. Der abgewrackte Kasten liegt in einem ebenso verwahrlosten Garten. Es ist kurz vor sechs. Vor dem verschlossenen Gittertor schreckt eine auf dem Gehsteig liegende Gestalt auf. Conciergen leben gefährlich, das Taxi hätte ihn beinahe überrollt. Missmutig entriegelt er das Tor.
In der Rezeption brennt kaltes Licht, einige Gestalten dösen auf Bänken und Böden. Ich rufe meinen Namen, hinter der Rezeption taucht der Schädel des Nachtportiers auf. Er mustert mich feindselig. Sein Finger gleitet die Namensliste in einem nach Naphthalin stinkenden Buch entlang, meiner scheint nirgends auf. Schließlich entdecke ich einen Eintrag, bei dem die Abreise mit der meinen übereinstimmt, der dazugehörige Name allerdings lautet auf »Enssinger«. Daneben ist eine Handynummer notiert. Der Mann wackelt mit dem Kopf. Zu Recht. Inder sind Bürokraten, besonders um diese Uhrzeit. Ich lege mein Mobiltelefon auf den Tresen. »Try!« Er dreht die Wählscheibe eines uralten, schwarzen Apparates. Mein Handy brummt. Ich hebe ab. »Enssinger?« Er starrt mich an. Der Name ist falsch, aber Handys lügen nicht. Draußen geht die Sonne auf. Ein paar blütenreine Gandhi-Köpfe wandern von Hand zu Hand. Augenblicke später halte ich den Zimmerschlüssel in der Hand. Die Straße hinunter rechts, Nebenhaus. Tourist Austria Enssinger in der Morgendämmerung von Mumbai.
In einem kleinen Park hockt ein Mann breitbeinig im Gras und massiert die Schenkel eines Kampfhahnes. Vielleicht bereitet er ihn auch nur auf sein Morgengebet vor. »Welcome to Mumbai!«, krächzt der Alte. Oder der Hahn? Ich wackle mit dem Kopf, ahne, von wem ich wenig später geweckt werde, steige ein paar Treppen hinauf, betrete einen muffigen Raum und öffne das Fenster. Der Hahn spaziert über den Kiesweg und bleibt mitten auf einem kleinen Rasenstück stehen. Majestätisch bläht er den Hals zum Kropf, reckt den Schnabel in den Morgensmog, holt tief Luft und tut einen Schrei, der so laut ist, als gälte es, ganz Maharashtra aus dem Tiefschlaf zu holen. Außer einen, der lässt sich genau in diesem Augenblick auf eine steinharte Matratze fallen. Welcome to Mumbai!
Eine Landung wie im Märchen
Mumbai, 16. Februar
Der Gockel lässt nicht locker. Nach drei traumlosen Stunden wache ich auf. Über mir dreht sich ein Monstrum von Ventilator. Durch die Jalousien fallen grelle Sonnenstrahlen und werfen Linien durch den Raum, als wären sie Teil eines Bildes der englischen Op-Art-Künstlerin Bridget Riley. Auf dem Fenstersims hockt eine Krähe und starrt mit bösen Augen auf den großen weißen Mann, der sich unter falschem Namen in ihr Reich geschmuggelt hat. Scharfe Federn kratzen gegen das Scherengitter. Eine zweite Krähe linst herein. Was sehen sie? Wer hat bis gestern hier gewohnt? Enssinger? Wie begreifen Vögel die Welt? Die letzte Spielzeit meines Theaters habe ich mit Aristophanes’ gleichnamigem Stück eröffnet. Die Tiere errichten ihr Wolkenkuckucksheim. Was mit der »besten aller Welten« beginnt, endet in der schlechtesten – dem Faschismus. Mein geliebter Kumpel, der theatralische Querkopf Schulte-Michels hat inszeniert. Indem ich das Theater verließ, habe ich auch viele meiner Wegbegleiter verloren. Schumi war einer der Liebenswertesten.
Um ins Badezimmer zu kommen, muss ein Vorhängeschloss geöffnet werden. Das Hotel gleicht einer geschlossenen Anstalt. Mit abgekochtem Wasser putze ich mir die Zähne und stelle mich unter das eiskalte Rinnsal einer Dusche. Die Seife fühlt sich nach Klostein an. Vielleicht ist sie auch einer. Der allgegenwärtige Smog verfolgt mich bis hierher: Im Bad stinkt’s nach Diesel. Kein Wunder, das Hotel heißt Bentley’s.
Am Colaba Causeway liegt ein geschichtsträchtiger Ort. Das Leopold Café ist einer der Hauptschauplätze des Romans Shantaram, der bizarren Lebensgeschichte eines australischen Drogendealers, der in einem der unzähligen Slums Mumbais untertaucht. Das Leopold ist auch noch aus einem anderen Grund in die Schlagzeilen geraten. Vor Kurzem bekamen hier zehn Menschen ein paar Kugeln in den Kopf. Vier Tage später sperrte der Besitzer seinen Laden wieder auf, in der berechtigten Hoffnung, dass Verbrecher ihre Handschrift nie zweimal am selben Ort hinterlassen. Unzählige Löcher an den Wänden erzählen eine grausige Geschichte. Ich bestelle Toast, gefüllt mit einer undefinierbaren Pampe, und überlasse ihn dem unentwegt mit dem Kopf wackelnden Kellner. Täusche ich mich oder sehe ich in seiner Backe ein Einschussloch? Ich zahle und verlasse den Ort blutiger Facts and Fakes.
Das Gateway of India liegt in unmittelbarer Nähe zum Taj Mahal Palace Hotel und ist das Wahrzeichen der Stadt. Ein Willkommensgruß für all jene, die sich der Stadt vom Wasser her nähern. Es sollte Jahrhunderte dauern, bis sie alle wieder gingen. Ein klein gewachsener Mann, in der Rechten einen Wanderstab, auf der Nase eine Nickelbrille und an den Füßen ein Paar Sandalen, brachte es zuwege. Mahatma Gandhi war Rechtsanwalt. Am 30. Jänner 1948 stellte sich ihm ein fanatischer Hindu in den Weg. Der kleine, große Mann begab sich zum Gebet, das Hindus gleichermaßen galt wie Moslems. »Du bist zu spät«, sagte der Fremde. Unmittelbar darauf trafen Gandhi drei Kugeln, zwei in den Bauch, eine in die Brust. Die Kugeln töteten nicht nur die Ikone des gewaltfreien Widerstandes, sie galten der Vision, Religionen zu einen. Gandhi hatte einen gewaltfreien Kampf gewonnen, die Macht der Engländer wurde gebrochen. Das Todesurteil aber hatte eine andere Ursache. Sein Aufruf zur Versöhnung der Religionen führte letztlich zur Gründung zweier neuer, unabhängiger Staaten: Westpakistan, das heutige Pakistan, und Ostpakistan, Bangladesch. Der Mord war der Startschuss eines bis heute schwelenden Konfliktes. Auch das Gateway wurde Ziel eines blutigen muslimischen Terrorangriffes. Heute ist das Gebäude entsprechend geschützt, man muss einen Kordon von Polizeischranken überwinden, um es zu besichtigen. Wenn man drinnen ist, ist man schon wieder draußen. Mehr als ein Tor gibt’s nicht zu sehen.
Im Taj Mahal Palace möchte ich ein Gläschen auf die Freiheit des indischen Staates heben. Die Revolutionsfeier muss allerdings verschoben werden. Weshalb? Ich finde den Hoteleingang nicht. Kein Witz. Keine Türe.
Ich spaziere durch ein Viertel, in dem ein monumentales Gebäude neben dem anderen steht: Kala Ghoda. Das größte Museum der Stadt befindet sich in einem traumhaft schönen Park gleich am Beginn der Mahatma Gandhi Road. Hier lagern die meisten ethnischen Kunstschätze Indiens. Ein anderes Haus, schräg gegenüber, zieht mich noch mehr an: Der sephardische Jude David Sassoon hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Stadt ein »Haus der Weisheit« geschenkt. Der Mann konnte sich’s leisten, sein Vermögen machte er mit Opium. Nicht jeder Dealer aber spendiert gleich eine Bibliothek. Hundert Jahre später existiert das Legat immer noch. Über dem Eingang prangt ein Relief des Stifters: Mit Rauschebart und Turban grüßt der Jude seine Schüler.
Der Eintritt in die Bücherwelt ist mystisch und – stockdunkel. Ein Typ mit Bart und Turban steht vor mir. Er ist aus Stein. Die Hände hat er zum Himmel gerichtet.
»Yes, please?«
Ich sehe den Golem an. Spricht er zu mir? Jemand tippt mir auf die Schulter. Ich erschrecke.
»In the name of Mr. Sassoon, I welcome you!«
Ein Mann aus Fleisch und Blut wendet sich einem Berg von Schlüsseln zu und legt sie der Größe nach geordnet auf den Tisch. Ich sage, dass ich es wunderbar finde, der Welt Buchstaben zu hinterlassen, verneige mich vor dem versteinerten Mr. Sassoon, nicke seinem menschlichen Ebenbild zu und betrete den Garten des Hauses. Vögel hopsen durch das Gras. Wenn sie die trockenen, am Boden liegenden Blätter der großen Banyan-Bäume berühren, klackt es, als legten hinten in der Laube der Opiumhändler und seine Freunde Dominosteine auf die Tischplatte. Auf einer Bank strecke ich mich aus und schließe die Augen. Inmitten der unüberschaubar großen Stadt habe ich einen Platz der Ruhe gefunden. Wissen und Bücher machen es möglich. Lange liege ich da, im Schatten der Vergangenheit, so lange, bis es mich zu frösteln beginnt.
Gleich nebenan steht das Esplanade Mansion, vormals erstes Hotel der Stadt. Die Straße davor wurde nach ihm benannt. Ein Autobus kracht in ein Taxi. Der Fahrer springt aus dem Wagen, trommelt gegen die Scheibe des Buslenkers, tritt gegen die verbeulte Türe und verpasst dem Monstrum weitere Dellen. Ungerührt lässt der Chauffeur den Angriff auf sein Fahrzeug geschehen, legt unter Seufzen der schweren Maschine eine nachtschwarze Dieselwolke über den Tatort und löst sich vor den Augen der staunenden Menge in nichts auf. Resigniert steigt auch der Taxilenker in seinen ramponierten Wagen und entfernt sich, seiner Wut geschuldet, gegen die Einbahn fahrend. Schon bald ward auch er, gleich einem Zaubertrick des berühmten Magiers Copperfield, nicht mehr gesehen.
Die Gebrüder Lumière schrieben im Esplanade Stadtgeschichte: 1896 führten sie zum ersten Mal auf indischem Boden ein kinematografisches Experiment vor, das die High Society Mumbais entzückte. Die Sensation strahlt bis heute nach: Die hiesige Filmindustrie zählt zu den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen des Landes. Längst ist das Esplanade eine verfallene Ruine. Betritt man das Gebäude, wähnt man sich in einem Bollywood-Action-Movie. Vor Kurzem krachte ein Balkon auf den Gehsteig und begrub zwei Menschen unter sich. Eine Unmenge von Messingschildern sind im Entrée angebracht. Advokaten und Versicherungen betreiben hier ihre Büros. Das scheint das Problem zu sein, das Haus ist im Besitz von Rechtskundigen. Eine Renovierung scheint nicht in ihrem Interesse zu liegen. Balkone abstürzen zu lassen und die Versicherungssumme zu kassieren, ist lukrativer.
Ich spaziere den Oval Maidan entlang, eine riesige Grünfläche, die für Kricket genutzt wird, vorbei an den beiden viktorianischen Trutzburgen Universität und High Court. Zwei Bahnhöfe ziehen mich an: die Churchgate Railway Station und der regierende Weltmeister in dieser Disziplin, der Chhatrapati Shivaji Terminus, eine Merkwürdigkeit, die weltweit ihresgleichen sucht. Es dämmert gerade und der Blick, der sich mir bietet, ist unbeschreiblich: eine indo-sarazenische Mischung aus Grottenschloss und Geisterberg. Von Weitem grüßt das Wiener Rathaus. Nie zuvor habe ich einen ähnlich bombastischen Kitsch gesehen. Blau-rot glänzt die Fassade, die Fenster grün, die Türme gelb, und die Mauervorsprünge, Nischen und Erker, wovon es jede Menge gibt, sind mit Glühlampen bestückt. Man traut seinen Augen nicht: Hogwarts, von Mumbais größenwahnsinnigsten Filmarchitekten nachgebaut und ausgeleuchtet.
Ich betrete die bombastische Kassenhalle, gleich dahinter erstreckt sich ein Labyrinth aus Wandelgängen, Couloirs und Foyers, die für die Krönungsfeierlichkeiten des englischen Königshauses herhalten könnten. Endlos viele Gleise enden hier, im größten Kopfbahnhof der morgenländischen Welt. Im Minutentakt kommen Züge an. Menschen hängen an den Türen wie doldenartige Wucherungen. Der erste Waggon eines jeden Zuges ist ausschließlich Frauen vorbehalten. An der Fahrerkabine, groß wie ein geräumiges Kontor, prangt das Schild »Motor Man«. Damit ist alles gesagt. Die Branche ist sauber gegendert, zumindest hier. In unzähligen Filmen spielte der Chhatrapati die Hauptrolle. Neben Millionen Reisenden beherbergt der Bahnhof auch Heerscharen von Bettlern und Straßenkindern, die hier auf den Perrons ihr Zuhause haben. Vorsicht ist geboten: Über sie zu stolpern, heißt in die Welt der Unberührbaren einzutauchen.
Direkt hinter dem Monstrum hat ein Nachtmarkt seine Pforten geöffnet. Hier und jetzt erfüllt sich erstmals auf dieser Reise meine Leidenschaft für Street Food: Ein zu allem Entschlossener schaufelt Unmengen von Reis auf einen Blechteller, dazu Dhal, Curry und Mixed Pickles, das Ganze wird mit Schichten von heißen, frisch zubereiteten Fladenbroten versehen, nebst einem Vada Pav, einer Art vegetarischen Burgers bestehend aus frittierter Kartoffelmasse in einem weichen Brötchen (Pav). Das fertige Kunstwerk drückt er mir, garniert mit höllenscharfem Chutney und grünen Chilis, in die Hand. Dafür will er dreißig Rupien, das sind umgerechnet vierzig Cent. Nie zuvor habe ich eine köstlichere Mahlzeit genossen. Ich schlinge, schaufle, gaffe, werde begafft und schlinge und schaufle weiter, vergesse das Chaos rund um mich und bin mittendrin und lebe und bin glücklich – und bin angekommen.
Das Sahnehäubchen des Tages bildet das Regal, eines der ältesten Kinos der Stadt. Wer etwas auf sich hält, muss dort hinein. Um stramme zweihundertfünfzig Rupien leiste ich mir im Dress Circle den »ersten« Platz. Ein sündteures Vergnügen, aber es ist jeden Cent wert. Das Kino ist gesteckt voll. Es wird gegessen und getrunken, die Stimmung ist bestens. Plötzlich schnellen alle wie auf ein geheimes Zeichen von ihren Plätzen auf: Über die riesige Leinwand flattert die indische Fahne. Mit einem Mal herrscht Ruhe im Saal. Ehrfurchtsvoll, die Hand am Herzen, lauschen wir der Hymne. Danach geht’s los: Party! Der Streifen heißt Aiyaary und spielt in indischen Geheimdienstkreisen. Die Sprache ist Hindi, ich verstehe Bahnhof, kein Wunder bei meinem heutigen Programm. Egal, ich bin der Zuschauer wegen hier und das entschädigt das Fehlen jeglichen Fachwissens. Mein erster Tag in Indien geht zu Ende, wie er begonnen hat: in einem Bollywood-Märchen.
Die Kuhherberge von Panjrapole
Mumbai, 17. Februar
Ich sitze im Study Center des Municipal Children’s Park, so wie viele rund um mich. Der Platz der Stille inmitten dieser wirbeligen Metropole ist der Familie Shekhar zu verdanken, in zweiter Generation tätig bei der Stadtverwaltung Mumbais. Hier wird gelesen, geträumt und geschrieben. Das ist was für mich. Dahinter befindet sich ein riesiger Kinderspielplatz.
Was immer ich in Südostasien gesehen habe, es wird in den Schatten gestellt von dem, was ich in dieser Stadt erlebe. Mumbai ist unglaublich, in jeder Beziehung: Grell und laut und bunt und voller Leben. Mumbai ist der Wahnsinn! Hier nimmt niemand auf niemanden Rücksicht, am wenigsten auf sich selbst. Schon die Straßenseite zu wechseln, ist Abenteuer pur. Kreuz und quer strömen die Kohorten. Die Mutigen lassen sich treiben, inmitten von Lastenträgern, Kindern und Bettlern. Sie schieben, schubsen, stoßen, drängeln. Man stolpert vorbei an Krüppeln, Heiligen, Unberührbaren. Man plumpst in Löcher, gerät an Kühe, Ziegen und Hunde, verheddert und verkeilt sich in Massen von Menschen, von denen jeder, sein Ziel vor Augen, Gleiches tut. Handkarren, beladen mit meterlangen Stangen, Rohren, Eisenteilen sind ebenso unterwegs wie Fahrräder, Busse, Taxis, Motorräder. Die Polizisten, dem Ganzen nicht gewachsen, pfeifen und tröten, was das Zeug hält. Sie fuchteln mit den Armen, rollen die Augen, wackeln mit den Köpfen und schreien sich die Kehlen heiser, es nützt nichts. Der Moloch gehorcht eigenen Gesetzen. Der Starke gewinnt, der Schwache gibt nach. Einen Tag in Mumbai herumzumarschieren heißt, sich durchs Fegefeuer zu kämpfen. Es gibt nichts Aufregenderes, als auf eigene Faust in Maharashtras Hauptstadt unterwegs zu sein. Überlebenskampf pur.
Den haben die Kollegen meines heutigen Zieles bereits hinter sich. Ich marschiere die Maharshi Karve Road entlang, in Richtung Sonapur, einer Art Open-Air-Krematorium. Gegründet und gespendet wurde die gespenstische Location zu Beginn des 19. Jahrhunderts von Mr. Jagannath Shankarseth, Millionär und Menschenfreund, der seinen Landsleuten die ewige Ruhe geschenkt hat. In diesem »Vorraum des Schlafes« wird in Schichten gearbeitet, die Öfen brennen Tag und Nacht. Über den Holzstößen sind riesige Abzugshauben angebracht, wie sie in Großküchen hängen. Nur dass das Grillgut ungleich delikater ist. Dicke, runde Scheite, gut eineinhalb Meter lang, darüber das schmälere Zündholz. Die Toten sind in Tücher gehüllt, um den Hals tragen sie Blumenschmuck. Hindus müssen innerhalb von vierundzwanzig Stunden nach ihrem Tod verbrannt werden – und das öffentlich. Die Stimmung der Trauergemeinde ist alles andere als gedrückt. In der Regel bedeutet der Eintritt in ein neues Leben eine zweite Chance. Und die darf ruhig auch gefeiert werden, besonders wenn die Vergangenheit nur mäßig komisch war.
Mehr als eine Steinbüste ist von Mr. Shankarseth nicht übrig, die aber ist gut erhalten. Allerdings dreht er seinen Schützlingen den Rücken zu. Hat er schon zu viel gesehen? Dabei hätte er seine Freude daran, die Branche brummt. Eine Lagerhalle ist bis unters Dach mit den unterschiedlichsten Hölzern befüllt. Und das Material ist alles andere als billig. Weitaus günstiger für die Hinterbliebenen ist das nahe gelegene Electric Crematorium. Hier wird die Sache umweltfreundlicher erledigt, allerdings auch weniger romantisch.
Die konventionelle Verbrennungszeremonie in Mumbai geht so vor sich: Ein junger Mann umkreist den Scheiterhaufen. Auf der Schulter trägt er einen Tonkrug, aus dem Wasser tropft. Bei der zweiten Umrundung wird das Leck größer geschlagen, bei der dritten noch etwas mehr. Danach landet der Krug am Boden, er zerbricht. Das irdische Leben hat ein Ende. Jetzt beginnt die Einäscherung. Am nächsten Tag kommen die Angehörigen und holen die Asche ab. Sie wird in ein Gefäß gefüllt, auf einen Fluss gesetzt und die symbolische Reise ins nächste Leben beginnt.
Einige Männer hocken in dem Bereich, der den Trauernden vorbehalten ist. Ich nicke und nehme Platz. Einer der Herren blickt mich feindselig an. Seine Augen laufen Gefahr, aus den Höhlen zu treten. »That’s life«, brummt er, angesichts des Todes. Die anderen brüllen vor Lachen, und ich verstehe auf sehr einfache Weise etwas mehr vom Leben.
Zurück aus dem Reich der Toten nähere ich mich dem Mumbadevi Tempel. Er ist jener Göttin geweiht, die der Stadt ihren Namen gibt. Ihr will ich meine Reverenz erweisen, ich denke, das gehört sich so. Im Innenhof stehen ihre unmittelbar Untergebenen, die heiligen Majestäten – gut genährte Kühe. Gläubige versorgen sie mit frischem Gras. Die fetten Damen blinzeln mich träge an. Vorsichtshalber murmle ich einer von ihnen ein nettes Wort ins Ohr, man weiß ja nie. Draußen kann ich mich kaum der Liebesbezeugungen eines Krätzigen erwehren, der mich in einen heiligen Bund aufnehmen will. Er umklammert mein rechtes Handgelenk und ist dabei, mir dreckige rote Wollbänder umzubinden, als äußeres Zeichen innerer Reinheit. Ich habe Glück, eine Woge Menschenleiber spült mich in die Bhuleshwar Road, wo ich in einem Marktgewirr von Tieren und Waren aller Art lande. Zu beiden Seiten der Straße: Tempel. Keinen davon nehme ich wahr, zu sehr nimmt mich das hiesige Leben gefangen.
Ein Gewürzladen zieht mich an: »Mr. Motilal Masalawala« steht in roten Lettern über dem Geschäft, und ich lese in meinem »gescheiten Buch«, dem Lonely Planet, dass der Gewürzladen eine Anlaufstelle heimischer Hausfrauen in Sachen Gaumenfreuden ist. Ich schnuppere mich durch die Regale. Mr. Motilal nickt mir zu und bleckt dabei seinen zahnlosen Mund. Ich erwidere den Gruß – allerdings mit Zähnen. Zwei Herren unterschiedlicher Welten nicken mit den Köpfen. Der Duft göttlicher Gewürze bewirkt Völker verbindendes Einverständnis.