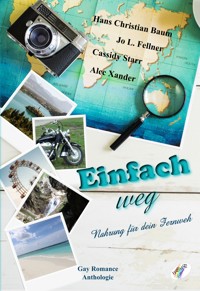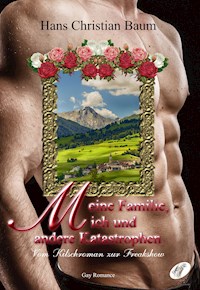Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Homo Littera
- Kategorie: Erotik
- Sprache: Deutsch
Nach dem Ende seiner Beziehung hofft Sebastian auf erholsame Feiertage im trauten Familienheim. Doch der Rohrbruch in der Villa von Maximilian von Birkheim zerstört ihm das heimelige Glück, denn der zufällige, aber gehasste Bekannte wird von seinen Eltern zu den Feiertagen eingeladen. Gerüchte im Dorf entstehen, und Sebastians Vater entpuppt sich als schwulenfeindlich. Hinzu kommt, dass sich die versnobten Eltern seiner Mutter selbst einladen, sein Bruder die frohe Botschaft überbringt, sich scheiden zu lassen, und Tanta Frieda den Eierlikör findet. Da erscheint das alljährliche Kochduell zwischen seiner Mutter und der Großmutter gar nicht mehr so schlimm. Das größte Problem aber: Alle schlafen unter einem Dach – und für Maximilian bleibt nur noch die zweite Hälfte von Sebastians Bett übrig. Schöne Bescherung – kann man da nur noch wünschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BAUM
Inhaltsverzeichnis
Noch einmal schlafen, dann ist ... Schöne Bescherung
Noch einmal schlafen, dann ist ... Schöne Bescherung
Impressum
Über den Autor
Noch einmal schlafen, dann ist ... Schöne Bescherung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Epilog
Danksagung
Programm
Holy Night
Meine Familie, ich und andere Katastrophen (1 und 2)
Einfach weg
Winter im Frühling
Liebe zwischen geschriebenen Zeilen
Hans Christian Baum
Gay Romance
© Hans Christian Baum, Noch einmal schlafen, dann ist ... Schöne Bescherung
© HOMO Littera Romy Leyendecker e. U.,
Am Rinnergrund 14, A - 8101 Gratkorn,
www.HOMOLittera.com
E-Mail: [email protected]
Grafik und Gestaltung: Rofl Schek
Bildnachweis: Christmas tree and fireplace © Marina113– iStock by Getty images
Kapitel: Holly © Gordon Johnson – Pixabay.com
Alle Rechte vorbehalten. Ein Nachdruck oder eine andere Verwertung, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages gestattet.
Die geschilderten Handlungen dieses E-Books sind fiktiv! Im realen Leben gilt verantwortungsbewusster Umgang miteinander und Safer Sex!
Originalausgabe: November 2021
ISBN Print: 978-3-903238-86-2
ISBN PDF: 978-3-903238-87-9
ISBN EPUB: 978-3-903238-88-6
ISBN PRC: 978-3-903238-89-3
Über den Autor
Hans Christian Baum ist ein österreichischer Schriftsteller. Er schreibt unter einem anderen Pseudonym seit Jahren erfolgreich Horror- und Fantasygeschichten. „Survival Camp – Wild Adventure“ (erschienen in der Anthologie „Einfach weg“ bei HOMO Littera) war seine erste Kurzgeschichte im schwulen Bereich. Hans Christian lebt mit zwei Hunden und seinem Lebensgefährten in der Untersteiermark.
Veröffentlichungen bei HOMO Littera:
Survival Camp – Wild Adventure in: Einfach weg – Nahrung für dein Fernweh, Anthologie (2018)
Holy Night, Gay Romance (2018)
Meine Familie, ich und andere Katastrophen, Teil 1, Gay Romance (2019)
Meine Familie, ich und andere Katastrophen, Teil 2, Gay Romance (2019)
Sie: Ich bin sprachlos!
Er: Gott erhalte dir diesen Zustand!
Aus: Peter Steiners Theaterstadl
Ich gähnte hinter vorgehaltener Hand und versuchte, wach zu bleiben. Seit einer Dreiviertelstunde ließ ich mich von Pfarrer Augustus Adventmesse berieseln, seit einer Dreiviertelstunde war ich mit meinen Gedanken weit weg von der Predigt. Die Orgel ertönte und hallte in dem Kirchenschiff wider, sodass ich spätestens jetzt wach war. Ich seufzte leise, gähnte noch einmal und rieb meine Finger aneinander. Es war saukalt in der Kirche, aber das hatte Mama und Oma nicht gehindert, die Adventmesse zu besuchen. Als anständiger Christ gehörte sich das.
Ich muss zugeben, dass ich kurz am Überlegen gewesen war, zu widersprechen, weil wir ganz bestimmt keine gute Christen waren, aber das hätte nur zu einem unnötigen Streit geführt. Außerdem war Mama im Kirchenchor, womit es ihre Pflicht war, in die Mette zu gehen.
Oma rutschte unruhig im Kirchenstuhl neben mir herum. „Heiß ist es, gell?“
Ich nickte und ruckte ebenfalls auf meinem Platz hin und her.
Heiß! Ja, am Arsch! Keine Ahnung, was sich der Pfarrer gedacht hatte, als die Heizung für die Kirche eingebaut worden war, aber er hatte auf alle Fälle nicht sein Hirn eingeschaltet. Oder sie war ein Sonderangebot gewesen. Es gab nämlich nur eine Sitzbankheizung in der Kirche, die dazu neigte, so heiß zu werden, dass man das Gefühl hatte, mit nacktem Hintern auf glühenden Kohlen zu sitzen, während der Rest der Kirche so kalt war, dass der Atem vor dem Mund regelrechte Wölkchen bildete. Ich war am ganzen Körper steif gefroren, nur mein Arsch schwitzte, besser gesagt, schmerzte, weil die Sitzfläche förmlich kochte.
„Hoffentlich hält das mein Mantel aus!“, flüsterte Oma. „Nicht, dass der nachher einen Brandfleck hat.“
Ich nickte erneut. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Mantel anbrannte, war gering, aber ich wollte jetzt nicht mit ihr über die dämliche Sitzbankheizung diskutieren – sie würde das Thema zu Hause noch oft genug anschneiden. Seit die Heizung in die Kirchenbänke eingebaut worden war, existierte der Diskussionsbedarf darüber fast jeden Sonntag. Notfalls auch per Telefon zu mir nach Wien, wo ich bis jetzt gelebt hatte. Vor einer Woche war ich wieder in das elterliche Haus gezogen, bis ich im Januar eine eigene Wohnung in der Nähe erhalten würde.
„Wie spät ist es?“, fragte Oma, weil ich nicht mit ihr über die Heizung reden wollte.
Ich schnaubte leise, dann streifte ich mit steifen Fingern die Handschuhe ab und schälte meine Uhr am Armgelenk unter dem Mantel, dem Pullover und dem Hemd hervor. „Kurz nach acht!“, flüsterte ich.
Sie riss den Mund lautlos auf und verzog ihr Gesicht, was so viel bedeutete wie: Schon so spät? Der überzieht heute aber lange!
Ich wusste, was sie meinte. Auch wenn die Adventmessen immer stimmungsvoll waren, so neigte Pfarrer Augustus dazu, sie ewig hinauszuzögern und die Leute hinzuhalten. Zu Ostern brauchte er so lange für die Messe am Samstagabend, dass viele der Osterfeuer bereits abgebrannt waren, wenn er mit der abendlichen Fleischweihe begann. Das hatte zur Folge, dass die Fleischweihe am Karsamstag nicht mehr gut besucht war. Wer ging schon gern in die Kirche, wenn es im Ort mehrere Osterfeuer-Feiern gab, wo Schnaps, Bier und Wein ausgeschenkt wurden? Das Fleisch für die Osterjause konnte auch noch sonntagvormittags gesegnet werden. Was machte es schon, einmal weniger zu fasten, wenn man das bereits neununddreißig Tage lang getan hatte? Auf die vierzig kam es nicht an. Der Wille zählte schließlich …
Der Kirchenchor beendete endlich sein Lied, und Pfarrer Augustus gab die Termine für die nächsten Metten bekannt – für all jene, die das Pfarrblatt nicht ausführlich gelesen hatten. Allen voran natürlich die Christmette zu Heiligabend in zwei Tagen.
Ich erhob mich mit Oma, als er endlich fertig war, und reichte ihr meinen Arm, nach dem sie sofort griff, als wir den Kirchenstuhl verließen. Langsam schoben wir uns mit der Menschentraube nach hinten Richtung Ausgang.
„Du, wo treffen wir die Mitzi und den Gustl?“
„Mama ist beim Chor, aber wir treffen uns draußen vor der Tür“, erklärte ich Oma, weil sie schon wieder vergessen hatte, wer wo aus unserer Familie war. „Und Papa ist mit Opa zu Hause.“
„Ach so, ja. Die Mitzi findet uns aber eh?“
„Sicher“, murmelte ich und bewegte mich Zentimeter für Zentimeter weiter, was nicht allein an Omas Geschwindigkeit lag, sondern auch an der Menschenmenge, zu der sich immer mehr aus den Kirchbänken gesellten. Hinzu kamen noch der Chor und die Kirchenbesucher, die oben am Balkon gesessen hatten.
Als wir endlich draußen waren, erblickte ich Mama, die anscheinend schneller als wir gewesen war, da sie bereits etwas abseits bei ihren Freundinnen stand und auf uns wartete.
„Wo gehen wir hin?“, fragte mich Oma, während ich mit ihr auf die Damenrunde zuschlenderte.
„Zu Mama.“
„Zur Mitzi?“ Oma blickte sich neugierig um. Als sie Mama erkannte, watschelte sie schneller. Fast war es, als hätte sie Angst, etwas würde ihr entgehen. Als würde Mama etwas vom Dorfklatsch aufschnappen, das sie nicht mitbekam.
„Grüß Gott“, schrie Oma in einer Lautstärke, als wir bei der Chorrunde ankamen, damit sie auch ja nicht übersehen wurde. Dann blieb sie stehen und blickte eine Frau nach der anderen aufmerksam an. Sie achtete genau darauf, wer sie grüßte und wer womöglich nur nickte. Am Land war es noch immer üblich, dass die Jungen die Alten grüßten. Nachdem Oma schon den Mund zuerst aufgemacht hatte, war es nun die Pflicht der Chorfrauen, dass sie artig vor ihr den Diener machten.
Oma schweifte über die Frauen hinweg und blieb bei Gitti Moosbacher hängen – die Frau des Orgelspielers. „Na, du schaust auch gut aus!“ Sie grinste breit.
Ich war mir nicht sicher, ob ihr bewusst war, dass sie Gitti Moosbacher indirekt gesagt hatte, fett zu sein und zugenommen zu haben, denn so freundlich wie Oma lächelte, war es auch möglich, dass sie dachte, Gitti ein Kompliment gemacht zu haben.
„Ja, geht uns auch gut!“, antwortete Gitti lächelnd und rieb über ihren runden Bauch.
Na ja, vielleicht interpretierte ich etwas in die Aussage hinein, schließlich konnte Gitti nicht auf ihre Leibesfülle stolz sein – oder womöglich doch. Am Land zeigte sich Wohlstand noch immer durch üppige Kurven. Wer etwas auf den Knochen hatte, konnte anpacken und war gesund – eine Einstellung, die eigentlich aus dem Mittelalter kam, die ich aber besser nicht hinterfragte. Nicht, wenn ich mich nicht in Teufels Küche bringen wollte. Am Land gab es seine eigenen Regeln, wer sich daran nicht hielt, wurde zum Aussätzigen.
Oma musterte Gitti. „Na, wäre schlimmer, wenn’s dir schlecht gehen würde. Dir und dem Xandl.“
Gitti lächelte übertrieben. „Eben! Und Ihnen, Frau Lindner? Wie geht’s Ihnen?“
Dass Oma Gitti duzte, bedeutete nicht zwingend, dass es auch umgekehrt erlaubt war. Oma war alt, damit hatte sie mehr Rechte – was so viel bedeutete, wie: allen und jeden zu duzen, der jünger war als sie. Auch so eine Landsache.
„Mir?“ Oma streckte den Rücken so weit es ging durch. „Gut! Siehst eh, wie gut ich noch ausschau – obwohl ich schon 87 Jahre alt bin!“
Ich rollte innerlich mit den Augen. Keine Ahnung, ob man so wurde, wenn man alt war, aber Oma war regelrecht stolz auf ihr hohes Alter. Ich musste zugeben, dass man ihr ihre fast 90 Jahre nicht ansah. Hätte ich sie nicht gekannt, hätte ich sie auf höchstens 75 geschätzt.
„Und dir, Sebastian? Dir geht’s auch gut? Dich sieht man ja kaum noch“, begann Gitti ihren Hunger nach Neuigkeiten zu stillen. „Die Mitzi hat uns erzählt, du kommst wieder heim?“
Ich sah vorwurfsvoll zu Mama. Das war so typisch, dass sie die Kunde sofort in der Damenrunde breitgetreten hatte. Jetzt wusste es das ganze Dorf – wenn es der Kirchenchor wusste, hätten wir die Angelegenheit auch auf der Gemeindetafel anschlagen können, die Mitteilung hätte sich ebenso schnell verbreitet.
„Vorübergehend sieht es wohl so aus“, gab ich als Antwort, ohne Mama aus den Augen zu lassen. Nur über meine Leiche würde ich wieder zu Hause einziehen.
„Ist das Stadtleben doch nichts für dich?“ Gitti schmunzelte. „Na ja, dazu muss man geschaffen sein. Die Tochter von meinem Xandl seinem Bruder ist auch in Wien – für die ist das Großstadtleben etwas. Die war schon immer so selbstständig und gescheit.“
Oh ja, die Tochter von Xandls Bruder … Wollte Gitti mir indirekt sagen, dass ich dumm und unselbstständig war? „Das hat damit nichts zu tun“, rechtfertigte ich mich. „Meine Firma plant eine Zweigstelle in der Nähe, und dort soll ich die Führung übernehmen. Da das Ganze schnell gehen muss und die Wohnung erst im neuen Jahr frei wird, werde ich vorübergehend zu Hause wohnen …“
„Wohnung,geh1!“, rief Traudi und winkte ab. „Du wohnst wieder zu Hause – ist nicht nur billiger, sondern auch praktischer!“
Ich lächelte gekünstelt und warf Mama einen weiteren Blick zu. Sie hatte die Sache also auch schon mit Traudi besprochen. Traudi war Mamas beste Freundin seit Kindertagen – und meine Patentante. Alles, was ich Mama erzählte, wusste auch Traudi – und umgekehrt. Als ich ein Kind war, war ich mir oft nicht sicher gewesen, wer eigentlich meine Mutter war und wann die beiden Frauen die Zeit fanden, sich jedes Detail unserer Gespräche zu erzählen.
Was die Wohnung betraf, war das letzte Wort noch nicht gesprochen – nein, eigentlich war es bereits gesprochen: Ich würde mit Sicherheit nicht fix zu Hause bleiben. Auch wenn es vielleicht billiger käme und praktischer wäre, aber ich war nicht verrückt genug, um mir mit 26 noch einmal die Wäsche von Mama waschen zu lassen. Sie würde nicht damit klarkommen, wenn sie womöglich verräterische Spuren meiner nächtlichen Besucher darin fände – von den Besuchern gar nicht zu sprechen.
Ja, ich war schwul – das einzige Geheimnis, das Mama mit Traudi nie geteilt hatte. Auch Papa nicht, oder Opa und Oma. Es war in diesem Dorf leichter, so zu tun, als hätte ich die richtige Frau noch nicht gefunden, als zuzugeben, dass ich auf Kerle stand. Vermutlich würden die Einheimischen sich bekreuzigen, wenn ich ihnen auf offener Straße begegnete. Pfarrer Augustus würde mich wahrscheinlich aus seiner Kirche verbannen.
Nein, ich verstand das. Deshalb verschwiegen wir die Sache. Wenn ich zu Hause war, taten wir so, als wäre ich hetero, vor allem vor den Ortsansässigen. Ich brachte deshalb auch nie einen Freund mit, schließlich war ich Single, der die Richtige noch nicht gefunden hatte.
Meine Beziehungen waren ohnehin meist eine Katastrophe, ich hatte auch erst zwei Partner gehabt, aber selbst wenn, hatten wir vor elf Jahren beschlossen, dass es das Beste wäre, meine Homosexualität vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Manchmal nervte mich das, weil ich mich damit eine Spur verleugnen musste. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob wir es nicht doch geheim hielten, weil niemand daheim damit klarkam. Mama wurde immer nervös, wenn es um Freunde von mir ging – auch wenn es sich um platonische handelte –, und Papa wirkte stets beschäftigt, sobald das Gespräch nur annähernd in diese Richtung ging. Aber es war okay für mich. Die wenigen Tage, die ich während der Feiertage und des Jahres zu Hause war, verbrachte ich getrost ohne jegliche Art von Beziehung. Danach lebte ich in Wien mein Leben weiter. Ich war immer noch ihr Sohn, sie liebten mich, und ich hatte nicht wirklich das Bedürfnis mit Mama oder Papa über mein Sexleben zu sprechen. Die Angelegenheit war also völlig in Ordnung, solange meine Familie es akzeptierte.
Mit meinem Umzug würde sich die Lage eventuell verkomplizieren. Die Kleinstadt, in der mein neuer Job war, lag zwar rund 50 km entfernt und war groß genug, um mein Leben gefahrlos verbringen zu können, andererseits funktionierte der Buschfunk in kleinen Gemeinden ziemlich gut. Ich lief Gefahr, gesehen zu werden und damit aufzufliegen. Keine Ahnung, wie ich die Sache lösen sollte, am besten war es, mit meinen Eltern noch einmal darüber zu sprechen – für den Fall der Fälle.
„Wenn du den ganzen Tag hart arbeitest, dann hast du keine Zeit, abends noch etwas Anständiges für dich zu kochen“, schob Traudi hinterher und riss mich aus den Gedanken. Fast war es, als wollte sie mir das Mutterhaus schmackhaft machen. „Du bist jetzt schon so dünn! Nein, wirst sehen, sobald du wieder zu Hause bei der Mitzi wohnst, nimmst du auch zu.“
„Ja, sonst nimmt dich keine, wenn du so dünn bist!“, gab Gitti gehässig ihren Senf dazu und rieb abermals ihren runden Bauch.
Eindeutig, sie war stolz darauf.
„Jede brauchen wir auch nicht“, konterte Oma laut.
Die Damenrunde lachte, ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Welcher Teufel hatte mich geritten, meinem Chef zuzusagen, diese Außenstelle zu übernehmen? Ab jetzt war meine Freiheit dahin. Ich kannte Mama. Selbst wenn ich bereits eine Wohnung hätte, wäre ich in Reichweite. Sie würde jeden Tag anrufen und ein neues Argument wissen, warum ich abends vorbeikommen musste. Jeder Vorteil, den der neue Job bringen würde, wog nicht so schwer auf, wie Mamas Gluckengehabe. Freiheit adé, Leben ciao-ciao!
„Schaut“, flüsterte Irmi, die Frau des Bürgermeisters, unerwartet. „Dreht euch aber nicht alle gleichzeitig um, macht es unauffällig! Da kommt gerade das Mannsbild, das im Birkheim-Haus wohnt. Gekauft hat er es noch nicht laut Melderegister, sagt mein Mann, aber es waren die Umzugswagen da. Also wird er sich noch anmelden, nach den Feiertagen vermutlich.“
Wie auf Kommando wandte sich die ganze Damenrunde um und starrte unauffällig zu dem Mann, der die Straße entlangkam. Ich fragte mich, ob Irmi bewusst war, dass es so etwas wie Datenschutz gab und der Bürgermeister ihr nicht einfach Auskunft über das Melderegister geben durfte – auch nicht, wenn es ihr Mann war.
Vermutlich nicht.
Ich war versucht, mich ebenfalls umzudrehen, aber ich wollte nicht den Neuen im Dorf anglotzen, so, wie die Frauenrunde es tat. So viel Anstand hatte ich.
„Groß ist der“, murmelte Gitti.
„Wer?“, fragte Traudi. „Der Hund oder der Mann?“
„Der Hund!“, zischte Gitti, als hätte Traudi eine selten dämliche Frage gestellt.
„Ist das überhaupt ein Hund?“, mischte sich auch noch Gerti ein, Irmis rechte Hand und Vorzeigefreundin. „Schaut wie ein Bär aus.“
Irmi nickte sofort. „Ja, das ist sicher so ein wildes Vieh, für das man eine Extragenehmigung braucht.“ Sie zog ihre hauchdünn gezupften Brauen hoch und meinte dann: „Ich werde meinen Mann gleich informieren, ob wenigstens das Vieh gemeldet ist, nicht dass da noch was passiert. Womöglich steht der auf der Liste!“
Mit Liste meinte sie jene Hundeliste, die mittlerweile in Österreich wie auch in anderen Ländern existierte, auf der Hunderassen vermerkt waren, die als gefährlich eingestuft wurden.
Unsicher blickte auch ich mich um. Ich wollte nicht starren, aber das wilde Vieh interessierte mich.
Ah ja! Ein dunkelbrauner Neufundländer mit Wintermantel – groß, ja, gefährlich, nein. Die Rasse galt sogar als besonders familienfreundlich. Aber das überstieg Irmis Wissen. Der Hund war groß und zottelig. Ergo: Er war böse und aggressiv.
„So ein großes Vieh!“, murmelte Gerti, vermutlich nur, um Irmi recht zu geben. „Hat der überhaupt einen Beißkorb oben?“
„Ich seh’ nix!“, wisperte Traudi verschwörerisch und runzelte die Stirn. „Aber das Mannsbild ist auch groß … und fesch, ha?“
Ich war mir nicht sicher, ob sie die letzte Bemerkung hatte laut aussprechen wollen, denn sie kicherte Sekunden darauf und strich sich über den Hubertusmantel. Sofort starrte die komplette Damenrunde erneut auf den Fremden – inklusive Oma, die mich ein Stück zur Seite schob, damit sie freie Sicht hatte. Ich seufzte leise, wandte mich aber wie die Frauen zu dem Kerl. Ja, er war tatsächlich groß, sicher an die zwei Meter, und seine Schultern waren so breit wie mancher Schrank.
„Soll ein Künstler sein“, flüsterte Irmi leise. „Mein Mann sagt, er schreibt Bücher …“
Die Damenrunde nickte unisono, ich versuchte mich peinlich berührt hinter Gitti und Traudi zu schieben, doch Oma hinderte mich.
„Grüß Gott!“, rief sie laut, stemmte die freie Hand in die Seite und fixierte den Fremden.
„Guten Abend“, antwortete der Mann in einem tiefen Bariton. Sein Blick streifte zu uns, dann sah er wieder auf die Straße und ging mit seinem Hund an uns vorbei. Letzterer registrierte uns nicht einmal.
Ich musterte den Kerl von hinten. Ja, ein Berg von einem Mann – aber wer so einen Hund hatte, musste groß und stark sein. Der Neufundländer hatte sicher an die sechzig Kilo.
Leider hatte ich nicht viel von dem Gesicht des Fremden gesehen, weil er eine dunkle Haube trug und sein Mund von einem Schal bedeckt war. Die Tatsache führte mich sofort zu der Frage, woher Traudi wusste, dass der Kerl fesch war. Kannte sie ihn? Oder hatte sie aufgrund seiner Größe auf ein attraktives Aussehen geschlossen?
„Ist das ein Hund?“, rief Oma unerwartet und schlurfte wenige Schritte von der Frauengruppe weg. Ohne mich wehren zu können, zog sie mich mit.
Der Mann hielt an und blickte sich zu uns um. „Ja, ein Neufundländer.“ Er sah von seinem Hund zu Oma und dann zu mir, während er den Schal von seinem Gesicht streifte.
Ein eckiger Kiefer kam zum Vorschein, ebenso ein dunkler Dreitagebart. Beides war sehr maskulin. Seine Augen wirkten fast schwarz, und die ...
Ich hielt schlagartig die Luft an. Shit – Shit – Shit! Den Kerl kannte ich – und er leider auch mich. Wenn ich mich recht erinnerte, hatte er mir bei unserem ersten und letzten Zusammentreffen mit der Faust gedroht. Es war in Wien gewesen. Mein bester Freund Lukas hatte einen Typen aufgegabelt, zu dem er mit nach Hause gekommen war. Lukas rief mich um Mitternacht an und bat mich, ihn abzuholen, da er getrunken hatte. Ich war nicht begeistert, aber Lukas war immerhin mein Freund, also fuhr ich zu der besagten Adresse. Dummerweise waren die beiden mit ihrer Nummer noch nicht fertig, womit ich vor Ort im Wohnzimmer auf Lukas wartete – und ich wartete lange, mindestens zwei Stunden. Als Lukas und sein Bettgefährte endlich ihr Spiel beendeten, war ich kurz davor, wieder zu gehen. Es nervte, mitten in der Nacht in einer fremden Wohnung herumzusitzen. Ich wusste aber blitzartig, warum Lukas mich angerufen hatte. Er war nicht nur betrunken, er war sternhagelvoll – ebenso wie sein Liebhaber. Letzterer wirkte sogar stoned, weil seine Pupillen verdächtig groß waren. Als ich Lukas aufforderte zu gehen, hing sich seine Liaison auf mich und begrapschte mich. Natürlich wehrte ich ihn ab, aber wir fielen dennoch auf die Couch – ich auf den Rücken, der Idiot auf mich, mit dem Gesicht genau zwischen meine Beine. Just in diesem Moment kehrte der wahre Eigentümer der Wohnung zurück und platzte in den Raum.
Tja, da hatte Lukas’ Bettgeschichte wohl vergessen, zu erwähnen, dass er in einer Beziehung war – oder es war Lukas egal gewesen, was wusste ich schon. Das Dumme war, dass der Lebensgefährte von Lukas’ Bekanntschaft nicht so begeistert ob unserer Anwesenheit war. Vor allem, dass sein Partner auf mir lag und sein Gesicht zwischen meine Beine vergrub. Er warf sowohl Lukas als auch mich kurzerhand vor die Tür, keine Ahnung, ob er mit seinem Freund ähnlich verfahren war. Fest stand, dass er uns drohte, wir sollen uns nie wieder blicken lassen – und ich muss gestehen, Lukas und ich suchten so schnell wie möglich das Weite. Der Kerl war ein Hüne, so breit wie ein massiver Balken – mindestens einen Kopf größer als wir. Wir flüchteten regelrecht und fuhren nach Hause, in der Überzeugung weder Lukas’ Bettgeschichte noch dessen Partner jemals wiederzusehen. Wer konnte schon ahnen, dass ich den Mann ausgerechnet in meinem Heimatdorf wieder traf?
Ich schluckte und steckte mein Gesicht tiefer in den Mantel. Wenn ich Glück hatte, erkannte er mich nicht. Schließlich dämmerte es, und obwohl Schnee lag und die Kirchen- sowie Straßenbeleuchtung auf uns schien, fielen sicherlich dunkle Schatten auf mein Profil.
Sein Blick brannte auf mir.
Nein, er erkannte mich, er wusste, wer ich war. Mist!
„Ein was?“ Oma stieß mich an und riss mich aus den Gedanken.
Unbeholfen linste ich zu dem Fremden, dann zu dem Hund. Ich schluckte abermals, bevor ich mich endlich Oma widmete. „Wie bitte?“
„Schläfst du?“, rief sie und zeigte danach mit der freien Hand auf den dicken Fellball vor uns. „Was ist das?“
„Ein Neufundländer“, wiederholte der Mann an meiner Stelle, ohne mich aus den Augen zu lassen.
„Aha. Und beißt der?“
„Nein!“ Die Muskeln an dem kantigen Kiefer des Kerls spannten sich, seine Augen schossen Blitze in meine Richtung.
Ich war am Arsch. Wenn der Typ für längere Zeit hier wohnte, konnte ich einpacken.
„Nicht“, murmelte Oma und zog mich näher zu dem Fremden. „Sie sind der Neue, oder?“
„Der Neue?“ Er sah zu Oma.
„Ja, der, der ins Birkheim-Haus gezogen ist!“ Oma stieß mir erneut in die Seite – das Zeichen dafür, dass der Typ dämliche Fragen stellte.
„Ach so, ja, das bin ich.“ Er musterte sie, bevor er wieder zu mir schaute.
Ich warf ihm einen nervösen Blick zu – hoffentlich sagte er nichts. Niemand im Dorf wusste über mich Bescheid, wenn er mich jetzt outete, dann hatte nicht nur ich eine Menge Probleme, sondern auch meine Familie. Ich hoffte wirklich, er trug den Streit mit mir nicht in der Öffentlichkeit aus.
„Schönes Haus!“, redete Oma unbekümmert weiter und beobachtete den Hund, der zwischen seinem Herrchen und uns hin und her glotzte. „Sehr groß vor allem – und sehr teuer. Was machen Sie beruflich?“
„Ich bin Schriftsteller“, gab er wortkarg Auskunft.
„Was?“ Oma schaute zu mir.
„Schriftsteller“, wiederholte er lauter, wahrscheinlich weil er dachte, sie wäre schwerhörig.
„Er schreibt Bücher“, erklärte ich unangenehm berührt und wäre am liebsten davongerannt. Nicht nur, dass ich in den Augen des Mannes der Arsch war, der mit seinem Freund geschlafen hatte, nein, Oma machte die Situation zusätzlich unerträglich. Sie war viel zu neugierig, fragte nach Dingen, die sie nichts angingen. Aber so war das am Land: Wenn jemand in ein kleines Dorf zog, wurde man zunächst von den Einheimischen mit Fragen durchlöchert. War das Loch groß genug, wurde es entweder mit Dingen gestopft, die man nie haben wollte, oder noch weiter ausgehöhlt. So oder so, beides war unangenehm. Aber da musste man durch.
„Und davon kann man leben?“, fragte Oma. „Wie viel hat das Birkheim-Haus gekostet? Das ist ja sicher nicht billig gewesen.“
„Oma“, murmelte ich. „Das geht uns nichts an.“ Vielleicht konnte ich die Situation retten. Aus Erfahrung wusste ich nämlich, dass die Schmerzgrenze des Fremden nicht sonderlich hoch war. Gut, das letzte Mal hatte er seinen Freund mit zwei wildfremden Kerlen erwischt, dennoch sprach er gerne mit Fäusten, wie mir schien.
„Wieso nicht?“ Oma starrte mich an, als hätte ich ihr verboten, in die Christmette zu gehen. Als hätte sie eine gewöhnliche Frage gestellt. Als ich nicht antwortete, widmete sie sich wieder dem Mann. „Ich darf das schon wissen, oder?“ Sie lächelte lieblich.
Jetzt war es der Typ, der nicht wusste, was er sagen sollte. Kurz entglitten ihm seine Gesichtszüge – auch wenn er sauer auf mich war, so versuchte er doch zu Oma freundlich zu bleiben. Er betrachtete sie, dann nickte er kaum merklich. „Ich habe dafür gar nichts bezahlt, es gehört meiner Familie.“
„Ihrer Familie?“, fragte Oma interessiert und riss erstaunt den Mund auf. „So was … dann haben die alle einen Blödsinn erzählt. Dann sind Sie gar kein Zugereister, sondern ein Birkheim? Ein von Birkheim, sozusagen?“
Er nickte abermals. Seinem Blick nach zu urteilen, wusste er nicht recht, wie er Omas plötzliches Wissen einordnen sollte.
„Ach so, das wusste ich gar nicht, dass es da so junge Kinder gibt.“ Oma beäugte ihn, dann meinte sie trocken: „Na ja, jung … so jung sind Sie auch nicht mehr.“
„Oma!“ Ich starrte sie mit großen Augen an. Wenn sie so weitermachte, dann würde er gleich unfreundlich werden.
Doch er überraschte mich, denn er lachte laut. Der Ton ging mir durch Mark und Bein, ich erzitterte leicht.
„Ja, wie es aussieht, komme ich langsam in die Jahre …“ Einzelne Fältchen bildeten sich um seine Augenwinkel, wenn ich das aufgrund des Lichtes und seiner Haube richtig deutete. Jede Wut verschwand – er wandelte sich zu einem ganz anderen Menschen.
„Sind Sie mit Ihrer Frau eingezogen?“, bohrte Oma weiter.
Frau, genau. Wäre er hetero, würde ihm jede Frau weglaufen. Vermutlich lief ihm auch jeder Mann davon.
„Nein, ich bin ledig.“ Er wurde ernst und sah zu mir. Seine Augen verengten sich, einzelne Blitze schossen abermals in meine Richtung.
Interessant. Entweder unterschätzte ich seine Intelligenz oder er kannte die Landregeln, denn er mimte den Heteromacker ziemlich gut.
„Ledig?“ Oma riss den Mund abermals ungläubig auf. „Und dann ziehen Sie in so ein großes Haus? Ohne Frau?“
„Ja, ohne Frau, dafür mit Hund.“ Er zeigte auf den Neufundländer, der mittlerweile näher zu Oma und mir herangekommen war.
Oma wich einen Schritt zurück, als er an ihrem Mantel schnüffelte. „Bist du ein großes Vieh!“
„Oma, bitte“, flüsterte ich und streichelte dem Hund über den Kopf, während er an mir roch.
„Wenn’s wahr ist“, murrte sie und schaute wieder zu dem Fremden. „Ach so, dann sind Sie ein Birkheim. Ein von Birkheim.“ Sie schmunzelte, als hätte sie das Wort „Vieh“ nicht benutzt. „Und ohne Frau … Na ja, der Sebastian will auch nicht heiraten.“ Sie zeigte auf mich. „Obwohl er in vier Jahren dreißig wird. Aber nein, heiraten, sagt er, ist nichts für ihn.“ Sie zuckte mit den Schultern. „Irgendwann wird er müssen. Ewig kann die Mami ihm nicht die Wäsche waschen.“
Mir fiel die Kinnlade nach unten. Sprachlos starrte ich zuerst Oma, dann diesen Birkheim an. Er grinste breit, kleine Fältchen bildeten sich erneut um seine Augenwinkel. Fast war es, als würde er die Situation genießen.
„Jetzt zieht er wieder nach Hause“, gab Oma weiterhin bereitwillig Auskunft. „Er hat eine Arbeit ganz in der Nähe angenommen. Damit ist er wieder bei uns.“ Sie zuckte abermals mit den Schultern. „Wird eh Zeit. Die Stadt ist nix für ihn. Frau findet er da keine anständige.“
„Oma!“, maulte ich zwischen zusammengebissenen Zähnen. Das war zu viel Information. Selbst wenn wir uns besser gekannt hätten, hätte ich nie so viel von mir preisgegeben.
„Ist ja so!“ Sie nickte eifrig und überlegte kurz, bevor sie sich wieder zu dem Mann drehte. „Obwohl … jede nehmen wir auch nicht. Anständig muss sie schon sein … und keine Zugereiste. Weil da weiß man ja nicht, woher die kommt.“ Oma stieg von einem Bein auf das andere, als müsste sie aufs Klo. „Bleiben Sie fix?“
„Vorübergehend, ja“, antwortete er, ohne mich aus den Augen zu lassen. Er lächelte wissend.
Tja, Oma hatte ihm brühwarm auf die Nase gebunden, dass ich nicht geoutet war. Zumindest nicht so richtig, aber Oma verzieh ich das. Sie war alt, sie erinnerte sich womöglich gar nicht mehr an mein Outing vor elf Jahren.
Wie auch immer, wenn der Kerl wollte, konnte er die Bombe jederzeit platzen lassen – als verspätete Rache sozusagen, als besonderes Weihnachtsgeschenk.
Ich schnaufte tief durch und schloss die Augen. Keine Ahnung, ob man es in dem Dämmerlicht sah, aber ich war sicher um drei Farbnuancen roter geworden. Als ich die Lider wieder aufschlug, sprach sein Blick noch immer Bände. Oh ja, er würde sein Wissen zum passenden Augenblick gegen mich verwenden – seine Art sich zu revanchieren.
„Und das ist für wie lange?“, fragte Oma ungeniert weiter.
„Jetzt sei nicht so neugierig!“, mischte sich endlich Mama ein und stellte sich neben Oma. Noch nie war ich so froh gewesen, dass Mama sich zu uns gesellte. Sie war auch manchmal peinlich, vor allem, wenn sie alles mit Traudi bequatschte, aber sie würde zumindest Oma auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Wenn ich Glück hatte, beendete sie das Gespräch schneller, als Oma sich verabschieden konnte. „Das geht dich nix an.“
Ich schaute erleichtert zu Mama, ihre Augen leuchteten vor Neugierde.
Nichts mit Erlösung, sie würde Oma benutzen, um selbst an die heiß ersehnten Antworten zu kommen.
Super, ich war am Arsch!
„Grüß Gott, ich bin die Tochter von der Frau Lindner. Maria Lindner-Kreuzer.“ Mama lächelte noch freundlicher. „Und das ist mein jüngster Sohn, der Sebastian.“
Der Mann nickte, bevor er mich erneut musterte. Seine Augen flogen abschätzend über mich, dann meinte er gelassen: „Ja, wir kennen uns.“
Ich schluckte, während ich wie automatisch seinen Hund streichelte, der zu meinen Füßen Platz genommen hatte.
„Ach so?“ Oma stieß mir schon wieder in die Seite. Ich brauchte gar nicht zu ihr zu sehen, ich wusste auch so, dass sie mich förmlich durchleuchtete. Ich kannte den Birkheim-Sohn und hatte ihr nichts davon erzählt. Unruhig biss ich mir auf die Innenseite meiner Wangen, die vor Hitze brannten. Die Blicke des Kirchenchors lagen auf mir. Jede einzelne der Frauen fragte sich gerade, woher ich den Birkheim-Sprössling kannte.
„Nur flüchtig“, murmelte ich und hörte selbst, wie sehr meine Stimme zitterte. Unruhig senkte ich die Lider und streichelte abermals den Hund, der mich hingebungsvoll anstierte.
„Aha!“ Oma stieß mir kräftiger in die Rippen. Ich antwortete nicht darauf, sondern ignorierte es. Stumm betete ich, heil aus der Sache herauszukommen. Hoffentlich outete er mich nicht, hoffentlich …
„Maximilian von Birkheim“, durchbrach er unerwartet die Situation und rettete mir so die Haut. Wahrscheinlich hatte er das unbewusst getan, aber ich atmete trotzdem erleichtert durch.
„Ah!“, machte Oma, als wüsste sie jetzt ganz genau, wer er war, blickte aber zeitgleich zu mir. Stumm erwartete sie noch immer eine Erklärung.
„Sind Sie der Sohn von der Elisabeth?“, mischte sich Traudi ein. Hinter uns scharrte sich wissensdurstig der komplette Frauenchor. Maximilian erhielt nun die volle Aufmerksamkeit. Wenn er nur einen Funken Verstand hatte, suchte er das Weite. Am besten weit weg von diesem Dorf – oder aber ich suchte das Weite.
„Nein, Elisabeth ist meine ältere Schwester.“
„Ach so?“ Gitti Moosbacher drängte sich an mir vorbei und musterte ihn unübersehbar. „So jung ist die noch?“
„Achtundvierzig“, gab Maximilian bereitwillig Auskunft. Sein Blick flog wieder zu seinem Hund, den ich noch immer streichelte. „Hermes, komm da weg!“ Er zog an der Leine, doch der Neufundländer hechelte nur liebestoll und bewegte sich keinen Zentimeter. Stattdessen drückte er seine feuchte Schnauze in meine behandschuhte Hand.
„Schon okay“, antwortete ich unbeholfen, weil ich nicht wusste, was ich sonst sagen sollte: Dein Hund ist netter wie du? Der droht mir nicht? Das klang doch sehr befangen und vor allem auch einfältig. Damit hätte ich ihm weiter die Karten in die Hand gespielt, was ich auf gar keinen Fall wollte.
„Ja,Viecher2 mögen den Sebastian“, gab Oma von sich. „Schon als er ein kleiner Bub war, hat er immer alles gestreichelt, was ein Fell hatte. Auch den schiach’n Ratz3 von der Karin.“ Oma schüttelte sich ob der unangenehmen Erinnerung.
Karin war mit mir in die Volksschule gegangen. Sie hatte von ihrem Vater eine Ratte zum Geburtstag erhalten – als Ersatz, oder als liebevolles Geschenk ihres Papis, der sich kurz davor von ihrer Mutter hatte scheiden lassen und mit der Ratte seiner Frau ein persönliches Abschiedspräsent gemacht hatte. Rache wurde hier auf vier weißen Pfoten mit einem langen Schwanz serviert.
Ich wünschte stumm, Maximilian würde mir eine Ratte geben – damit könnte ich leben. Mit Tieren verstand ich mich tatsächlich besser als mit so manchem Menschen.
Doch er runzelte ob der Worte nur die Stirn, bevor er mich schon wieder anschaute, als würde er mich gleich erwürgen. „Aha.“
„Und zu Weihnachten? Fahren Sie da nach Hause?“, fuhr Oma in unsere Gedanken und zerstörte damit zumindest die peinliche Stille.
„Nein, ich werde hierbleiben.“
„Nix nach Hause zu der Familie?“ Oma glotzte ihn erstaunt an. Zu Weihnachten gehörte die ganze Familie an denselben Tisch – Punkt und aus. Da gab es keine Diskussion.
„Nein, wir machen uns nichts aus Weihnachten.“
„Was?“, rief ein Dutzend Frauen zeitgleich.
„Hm, kein Weihnachten? Aber …“ Oma überlegte angestrengt. „Was machen Sie dann am Heiligabend?“
„Die Ruhe genießen – mich von etwaigen vergangenen Zwischenfällen erholen.“ Seine Augen trafen mich, ich wusste sofort, auf was er anspielte. Als wäre es meine Schuld gewesen, dass Lukas mit seinem Freund im Bett gewesen war und Letzterer fremdging.
„Ja, aber das geht doch mit der Familie auch“, schnatterte Oma ahnungslos weiter. „Bei uns ist es immer sehr besinnlich – und bei uns kommt die ganze Familie zusammen.“
Na ja, besinnlich war es leider nicht, stattdessen nervte wie jedes Jahr meine Schwester Magdalena, wenn sie uns ihr Leid über die Kinder und ihren dämlichen Idioten von Mann erzählte, während Oma und Mama sich über das Weihnachtsmenü stritten. Paps zog es noch vor der Christmette vor, sich mit meinem Bruder Albrecht zu betrinken, den ebenfalls die Kinder nervten, und Tante Frieda beschwerte sich grundsätzlich darüber, wie schräg unsere Familie wäre. Sie war allein, hatte nie geheiratet und auch nie ein Kind gehabt, deshalb kam sie zu Weihnachten zu uns. Obwohl sie Gast war, hielt sie das nicht auf, Mama bei jeder Gelegenheit unter die Nase zu reiben, wie dämlich ihr Mann sei. Opas Fest machte da mehr Sinn. Er setzte sich vor den Fernseher, wo er bis zum Essen blieb und sich das Weihnachtsprogramm anschaute.
„Wie geht denn das?“, bohrte Oma ohne Hemmungen weiter nach. „Wenn Sie kein Weihnachten feiern, wann stellen Sie dann den Christbaum auf?“
„Gar nicht, ich habe keinen Baum.“
„Keinen Baum? Wo legt das Christkind dann die Geschenke hin?“
Maximilian öffnete den Mund, dann klappte er ihn wieder zu. Er wusste nicht, was er darauf antworten sollte. Verwirrt hob er eine seiner geraden Augenbrauen, die durch die Haube leicht nach unten gedrückt wurden. Ich war mir nicht sicher, ob sie natürlichen Ursprungs waren.
„Es gibt keine Geschenke, Oma“, erklärte ich leise und warf ihr einen eindeutigen Blick zu. Hoffentlich kapierte sie, was ich meinte, und wir konnten verschwinden, bevor Maximilian mich doch noch vor der halben Gemeinde bloßstellte. „Kein Weihnachten, nichts.“
„Nichts?“ Oma sah ihn verblüfft an. „Und für was dann die Feiertage? Was machen Sie?“
„Ich genieße die Ruhe – erhole mich! Allein!“ Abermals ein stechender Seitenblick in meine Richtung.
„Versteh’ ich nicht!“ Oma schüttelte den Kopf. „Zu Weihnachten will doch niemand allein sein!“ Sie schaute sich in der Runde nach Zustimmung um, doch die Frauenbrigade war damit beschäftigt, Maximilian anzuglotzen. Hinter ihrer Stirn ratterte es.
„Also, wenn Sie niemanden haben zu Weihnachten, dann kommen’S zu uns. Bei uns ist es immer lustig, immer volles Haus“, bot Oma bereitwillig an, was ihr ein böses Schnauben von Mama einbrachte – und nicht nur von ihr, ich keuchte ebenfalls. Nur über meine Leiche würde dieser Maximilian mit uns Weihnachten verbringen, da konnte ich mir gleich mein Grab selbst schaufeln und mich hineinlegen. Wie ich diesen Arsch kannte, würde er mich sogar dazu bringen, mich selbst einzubuddeln.
„Mami, du kannst doch nicht einfach den Herrn von Birkheim einladen, ohne zu wissen, was er vorhat“, versuchte zum Glück Mama die Situation zu retten, jedoch aus anderen Gründen als ich. Sie mochte keine Fremden am Weihnachtstisch, dieser Tag war nur für die Familie reserviert.
Oma war das egal, war es schon immer gewesen. Als ich noch ein Kind gewesen war, hatte es deshalb einmal einen fürchterlichen Streit gegeben. Oma hatte bei der Christmette zwei völlig Unbekannte eingeladen.
„Ah geh!“, winkte sie ab und fixierte wieder Maximilian. „Wir haben einen Baum, da können Sie Ihre Geschenke drunterlegen.“
Maximilian kratzte sich unbeholfen am Hinterkopf. Mit dieser Logik hatte er nicht gerechnet. „Ähm … also …“
„Mami, bitte! Du kannst doch nicht die Pläne vom Herrn von Birkheim zerstören. Er kennt uns doch gar nicht“, mischte sich Mama erneut ein. Hoffend sah sie Maximilian an, dass er absagte.
Doch so weit kam es gar nicht, denn Oma war jetzt in ihrem Element: „Ja, aber warum denn? Er hat doch keinen Baum!“ Sie griff sich an die Brust und meinte theatralisch: „Mitzi, der ist doch arm, wenn er keinen Baum hat, wo er die Geschenke druntergeben kann!“
Maximilian fiel die Kinnlade nach unten. Sprachlos sah er Oma an.
Ich war versucht, zu lachen, deshalb senkte ich den Kopf und kraulte ausgiebig den Hund, der mich liebestoll ansah. „Na, du?“, flüsterte ich und vergrub meinen Mund im Mantelkragen, damit man mein Grinsen nicht sah. Augenblicklich spürte ich Maximilians Blick auf mir. Fast war es, als würde er mich auch dafür verantwortlich machen.
„Aber der Herr von Birkheim hat doch auch seinen Hund. Sein Hund fühlt sich sicher nicht wohl bei uns. Wir haben ja eine Katze!“ Mama lächelte Maximilian lieblich an und versuchte nach Oma zu greifen. Vermutlich um sie von ihm wegzuziehen.
Jetzt hatte auch Maximilian begriffen, dass Mama ihn an Weihnachten nicht bei uns zu Hause haben wollte. „Ich habe ohnehin keine Zeit.“
„Keine Zeit“, fauchte Oma und schüttelte anklagend den Kopf. „Für Weihnachten hat man immer Zeit, und was die Murli betrifft“, sie schaute zu Mama, „die schläft eh den ganzen Tag, außerdem tut ihr ein Hund vielleicht sogar mal gut. Ein wenig Abwechslung!“
„Abwechslung“, zischte Mama und warf Oma einen bösen Blick zu. „Die Murli ist eine Katze, die mag keine Hunde!“
„Wieso nicht?“ Oma überlegte, dann meinte sie trocken: „Die Murli soll sich nicht so anstellen, sonst wird sie noch gleich wählerisch wie der Sebastian, der will ja auch keine Frau …“
Ich starrte Oma perplex an. Sie hatte noch nie über meine Homosexualität gesprochen, ich zweifelte auch daran, dass sie sich an mein Outing erinnerte. Sie hatte schon vor elf Jahren nicht gewusst, was ich gemeint hatte. Dennoch passte die Antwort wie die Faust aufs Auge. Ich schluckte schon wieder trocken. Unruhig linste ich zu Maximilian. Bitte, bitte nicht!
„Ja, das kann ich mir vorstellen“, knurrte er in meine Richtung und lächelte gekünstelt.
Scheiße, ich war so etwas am Arsch – und mit mir meine ganze Familie.
„Weil er verzogen ist! Selbst schuld!“, schnatterte Irmi hinter mir.
Ich sog laut die Luft ein. Was sollte das? Ich wollte mich gerade zu Irmi umdrehen, doch da fiel mir Oma ins Wort.
„Verzogen! Geh! Er nimmt halt nicht jede … so wie dein Sepp!“ Sie warf Irmi einen warnenden Blick zu, dann stieß sie mir mit dem Ellbogen in die Seite. Gereizt rollte sie mit den Augen. Irmi mochte die Frau des Bürgermeisters sein, aber Oma gehörte zu den Dorfältesten, womit sie bestimmte Privilegien genoss. Irmis Sohn Sepp hatte mit 19 Jahren die Tochter vom ortsansässigen Tischler geheiratet, Gudrun. An sich eine gute Partie, wenn man darüber hinwegsah, dass Gudrun 12 Jahre älter war, zwei Kinder mit in die Ehe brachte und strohdumm war. Nicht, dass Sepp die größte Leuchte wäre, aber jeder im Dorf wusste, dass Sepp Gudrun nur geheiratet hatte, weil der damalige Noch-Vizebürgermeister beim Kartenspielen zu hoch gepokert hatte und mit der Eheschließung den Schuldenberg beim Tischlermeister abbauen konnte. Gudrun willigte freudig ein, als Sepp ihr, ohne sich kennenzulernen, einen Antrag machte. Selbst für das Land war die Hochzeit damals seltsam gewesen. Dass Oma diesen Triumph aus dem Ärmel zog, passte Irmi nicht, aber sie schwieg. Die Sache zwischen Sepp und Gudrun war auch ihr irgendwie unangenehm – und Oma war noch immer die Alt-Lindnerin, die Frau des größten Waldbesitzers in der Gegend. Da brauchte Oma gar nicht ihr Alter hervorholen, da reichte ihr Name durchaus.
„Waren Sie gar nicht in der Adventmesse?“, wechselte Oma das Thema und widmete sich wieder Maximilian. „Die war wirklich schön, wenn auch die Bänke etwas heiß waren …“
Womit wir wieder bei der Sitzbankheizung wären.
Ich war noch nie so froh über das Thema gewesen, auch wenn Maximilian das Problem nicht verstand. Seine Stirn furchte sich nämlich, zumindest bewegte sich seine Haube verdächtig.
„Ähm … also, nein, ich war nicht in der Kirche.“ Er zeigte auf den Neufundländer. „Ich war mit Hermes spazieren.“
Ich graulte den Hund, der wirklich nett war. Sehr sogar – was man von seinem Besitzer nicht sagen konnte. Hoffentlich verlor Oma bald das Interesse und wir konnten nach Hause fahren. Die Situation war bereits peinlich genug, Maximilian von Birkheim hielt uns sicher alle – mich eingeschlossen – für hinterwäldlerische Dorfleute, die fernab jeder modernen Zivilisation lebten. Als würden wir uns alle nur für das Unkraut in Nachbars Garten interessieren – was bei einigen der anwesenden Frauen leider zutraf. Wenn ich mich recht entsann, gehörten Mama und Oma ebenfalls dazu. Besonders Oma. Sie saß an der Spitze des Buschfunks. Wenn ich ehrlich war, hatte sie sogar das ein oder andere Feuer entfacht.
„Na, mit dem Vieh könnten Sie ohnehin nicht in die Kirche“, schnatterte Irmi unerwartet hinter mir. Anscheinend hatte sie den gröbsten Schock über Omas Kommentar bezüglich Sepp und Gudrun überwunden.
Die Antwort war frech und unverschämt – ich hätte mich am liebsten für Irmi bei Maximilian entschuldigt. Aber so war sie eben, so war es am Land. Irmi war und blieb die Frau des Bürgermeisters und durfte sich damit alles erlauben. Sie war aus ihrer Sicht die Dorfkönigin – Alter hin oder her.
„Hermes hat es nicht nötig, in die Kirche zu gehen“, gab Maximilian genauso frech zurück. „Er ist ja selbst nach einem Gott benannt, was braucht er da die Kirche?“ Er grinste übertrieben, zog Hermes von mir weg und machte einen Schritt zurück. „Wenn ich mich empfehlen darf?“ Er schlug seinen Schal wieder über den Mund und wandte sich damit um. Hermes folgte ihm sofort.
Oma – so wie der Rest der Damen – starrte ihm dümmlich hinterher.
„Ein komischer Kauz“, murmelte Gerti und bekam sofort reichlich Zustimmung. Die Damenrunde begann aufgeregt zu tratschen – inklusive Mama.
Oma wisperte: „Schnell eingeschnappt, der Herr, aber fesch, gell? So einen hätte die Magdalena heiraten sollen.“ Sie schüttelte sich. „Und wen haben wir bekommen? Den Horst!“
„Oma, bitte!“, flüsterte ich wie sie, weil ich nicht wollte, dass uns jemand hörte, wie sie sich vor allen Leuten über meinen Schwager ausließ. Wir wussten alle, dass Horst nicht der perfekte Ehemann für Magdalena war, aber zu seiner Verteidigung musste man ihm zugutehalten, dass Magdalena bei Gott nicht einfach war. Ihr passte nichts – wirklich nichts. Horst konnte nur alles falsch machen. „Horst ist schon in Ordnung.“
„Na ja.“ Oma seufzte, dann beugte sie sich wieder zu mir, was dazu führte, dass ich mich bücken musste. „Stell dir vor, die Magdalena und ein Birkheim!“ Sie riss theatralisch den Mund auf, bevor sie sich die freie Hand davorhielt. „Das wäre etwas.“ Sie zwinkerte mich an und zeigte dann zu Irmi. Ja, Irmi lästerte zwar über diesen Maximilian, aber neidisch wäre sie ihn Magdalena trotzdem gewesen.
„Irgendein Birkheim ist früher mit dem Albrecht unterwegs gewesen“, erklärte Oma nachdenklich. „Du warst damals noch ein Baby, aber der Albrecht … Ich muss ihn fragen. Die Birkheims sind eine große Familie …“
Ich zuckte unwissend mit den Schultern. Keine Ahnung. Ich war ein Nachzügler, Albrecht war 14 Jahre älter als ich, Magdalena 12. Was wusste ich, mit wem meine Geschwister in Teeniezeiten um die Häuser gezogen waren?
„Können wir langsam fahren? Mir ist kalt“, log ich, damit wir endlich den Kirchplatz verließen.
Oma nickte und setzte sich mit mir in Bewegung. „Mitzi, dem Buben ist kalt!“, rief sie so laut, damit auch ja jeder im Umkreis von fünfzig Metern Bescheid wusste. „Wir gehen schon mal zum Auto.“
Mama winkte sofort. „Ich komme gleich!“
„Jaja“, murmelte Oma und setzte einen Fuß vorsichtig vor den anderen.
Ich trottete langsam neben ihr her, achtete darauf, dass sie nicht auf eine Eisplatte trat, und schielte dann Richtung Berghang – dorthin, wo Maximilian von Birkheim verschwunden war. Er war natürlich nicht mehr zu sehen, dennoch starrte ich in die Dunkelheit.
Mann, wenn der Kerl ein wenig Verstand hatte, dann suchte er noch heute das Weite und verließ die Gemeinde. Er und sein Hund würden es hier nicht leicht haben. Auch wenn er ein Birkheim war, war er doch der Fremde im Ort – der komische Kauz mit Riesenvieh.
Ich seufzte. So viel Glück hatte ich sicher nicht.
Ich wälzte mich in meinem Bett herum.
Es war kurz nach halb 8, aber ich konnte einfach nicht mehr schlafen. So war das immer, wenn ich von meinem gewohnten Schlafzimmer in ein fremdes wechselte. Natürlich war mir mein Jugendzimmer nicht fremd, aber seit der Matura lebte ich in Wien. Ich war selbst zu Studienzeiten nur in den Ferien für wenige Tage nach Hause gefahren. Den Rest hatte ich für Praktika genutzt, um Erfahrungen zu sammeln. Dementsprechend hatte ich einen gut bezahlten Job bei einem Mobilfunkanbieter bekommen, wo ich rasch aufgestiegen war. Dass ich jetzt, nach nur zwei Jahren, sogar eine eigene Außenstelle führen sollte, sprach für meine Qualitäten – und nur ein ganz klein wenig davon, dass mein Chef mich aus seinem Umfeld entfernen wollte.
Er und ich hatten eine Art Beziehung geführt, die er wohl nicht so ernst genommen hatte wie ich. Demzufolge war der Ausflug in die Buchhaltung zu dem neuen Praktikanten für ihn eine Selbstverständlichkeit gewesen, während ich mir zu Hause die Augen ausgeheult hatte und an Appetitlosigkeit litt. Die neue Außenstelle war wohl ein Wink des Schicksals für mich – und für meinen Boss endlich die Erlösung, dass er mich loshatte.
Ich rollte mich auf den Rücken und starrte an die Zimmerdecke. Mann, warum konnte ich nicht einfach Glück haben? Warum war ich mit meinem Chef nicht schon genug bestraft? Musste jetzt auch noch dieser Birkheim hier leben? Konnte er nicht einfach wieder verschwinden?
Ich schloss die Lider und atmete tief durch. Vielleicht hatte er nach der gestrigen Gegenüberstellung am Kirchplatz bereits genug vom Dorf und zog in die Stadt zurück. Das würde mir viele Probleme ersparen. Nach wie vor fürchtete ich, dass er mich outete und damit auch meine Familie ins Unglück stürzte.
Ich schlug die Augen wieder auf und glotzte an den Plafond zurück. Noch ein Tag, dann war Weihnachten – und ich war in absolut mieser Stimmung. Kein Frieden, Freude oder Drang nach Lebkuchen, stattdessen hätte ich mich am liebsten in die Ecke gesetzt und geheult. Mein Leben verlief so gar nicht nach Plan, mit diesem Birkheim in meinem Umfeld würde es auch nicht besser werden. Bestimmt rannten wir uns irgendwann über den Weg, und dann würde er mich nicht nur outen, sondern mir auch den Kinnhaken verpassen, den er mir schon in Wien angedroht hatte. Mir und Lukas.
Eigentlich war alles Lukas’ Schuld, er hatte seinen Schwanz nicht in der Hose behalten können …
Unten klingelte es an der Haustür. Vermutlich ein paar Sammler, die vor Weihnachten noch ein wenig an jedermanns Mitgefühl rüttelten, um so Geld für diverse soziale Projekte aufzutreiben.
Ich hörte eine männliche Stimme, dann Oma, die lauthals nach Papa plärrte. Sekunden später plapperte sie aufgeregt mit der Person an der Tür.
Ich hievte mich aus dem Bett und schlüpfte in eine Jogginghose, bevor ich mich ins Bad aufmachte. Es half ja nichts – auch wenn ich liegen bliebe, würden sich meine Sorgen nicht in Wohlwollen auflösen. Vielleicht sollte ich Mama und Papa nach dem Frühstück zur Seite nehmen und sie über Maximilian aufklären, nur für den Fall, dass er Gerüchte in der Gemeinde streute. Natürlich eine abgeschwächte Form der Wahrheit, aber ein kleiner Hinweis wäre von Vorteil.
Barfuß tapste ich die Treppe nach unten. Oma schnatterte noch immer aufgeregt mit dem Fremden an der Tür. Gerade erzählte sie von Magdalena, die mit ihrem Mann kein Glück hatte.
Armer Kerl – sicher bereute er bereits, für welchen Verein auch immer, sammeln zu gehen.
„Warten’S, jetzt hör’ ich was. Das ist sicher der Gustl!“ Oma riss die Vorhaustür auf und schrie: „Gustl, jetzt mach!“
Ich schlenderte zum Bad, als mir Papa aus der Küche entgegenkam. Er war nicht gerade begeistert, um diese Zeit – und einen Tag vor Weihnachten – an die Haustür gerufen zu werden. Noch war es ruhig, aber heute Nachmittag würden meine Geschwister mit Partner und Kindern sowie Tante Frieda ankommen. Vier Kinder – alle unter acht – im Haus zu haben, machte jedes Weihnachtsfest zur lautesten Zeit des Jahres. Wahrscheinlich freute sich Papa bereits darauf, wenn die Feiertage zu Ende waren. Nicht, dass er seine Enkelkinder nicht mochte, aber sie waren zusammen immer etwas anstrengend.
Papa schloss die Tür zum Vorbau hinter sich und trat zu Oma an die Haustür. Ich hörte ihn mit dem Unbekannten reden. Oma warf ein „Um Himmels willen!“ ein.
Ich ging Richtung Badezimmer weiter, als Opa ebenfalls aus der Küche kam, von wo ich leise Oh, du Fröhliche hörte. Die Wiener Sängerknaben, wenn ich mich nicht irrte. Magdalena hatte Oma die CD vor drei Jahren zu Weihnachten geschenkt. Dementsprechend oft lief sie zur Adventszeit. Bei dem Gedanken, dass ich die nächsten Tage die Songs noch mehrmals hören würde, stellten sich mir sämtliche Haare am Körper auf. Nichts gegen die Wiener Sängerknaben, aber nach drei Liedern dachte ich immer an einem Hörschaden zu leiden. Prophylaktisch bekam ich auch immer Tinnitus.
„Was ist?“, fragte Opa und riss mich aus den Gedanken. Er zeigte zur Vorhaustür.
„Keine Ahnung.“ Ich linste zu den Filzpantoffeln, die er trug. Sie waren ihm viel zu groß, aber das hielt ihn nicht davon ab, sie anzuziehen. Die Dinger waren von Toni Krahbichel, der letzten Sommer verstorben war. Seine Frau hatte seine Kleider und Schuhe im Dorf verteilt. Am Land war das üblich. Man brachte die Kleidung eines Verstorbenen nicht zu einem Altkleidercontainer, sondern fragte sich einfach von Tür zu Tür durch, ob jemand etwas gebrauchen konnte. An sich eine gute Idee, ich persönlich würde aber nichts tragen, was jemand vor mir angehabt hatte, der jetzt tot war. Aber Opa sah das anders. Wäre ja schade drum, hatte er damals gesagt, als ihm Frau Krahbichel die viel zu großen Pantoffeln nebst einem Sack voll Kleider aufgedrängt hatte. Ihm passte nichts davon, alles war zu weit, aber das störte ihn nicht. Es war kostenlos, man konnte es noch tragen, damit zog er es an. Schließlich gab es Hosenträger, um zu große Hosen oben zu halten.
„Ich muss horchen, was los ist.“ Opa stakste zur Tür. Er war neugieriger als jedes Waschweib. Manchmal übertraf er Oma, und das hieß etwas. Vermutlich wusste er auch schon wieder seine Weihnachtsgeschenke. Seit ich denken kann, erinnere ich mich, dass Opa knapp vor Weihnachten immer Mamas Wäscheschrank durchstöberte, um einen ersten Blick auf seine Geschenke zu werfen.
Von draußen erklang ein weiterer Ausruf von Oma. „Um Gottes willen – sind Sie arm! Und das zu Weihnachten!“
Opa linste zu mir. „Warte – gleich ladet sie wieder irgendwen zum Essen morgen ein.“ Er wedelte mit der Hand vor der Stirn. „So eine blöde Wabn4! Verdirbt uns noch das Fest.“
Ich nickte nur. Gut, dass Oma ihn nicht gehört hatte, sonst hätte sie noch viel schlechtere Worte für ihn gefunden. Vielleicht irrte ich mich, aber die beiden wurden immer schlimmer. Jahr für Jahr gingen sie unfreundlicher miteinander um. Keine Ahnung, woran das lag, eventuell wurde man so, wenn man sich sein ganzes Leben kannte. Sie waren seit 68 Jahren verheiratet und zuvor Nachbarn gewesen. Möglicherweise verlor man mit den Jahren nicht nur jede Art von Hemmung voreinander, sondern auch jeden Respekt. Opa und Oma zumindest blieben sich nichts schuldig, sie stritten und beschimpften sich so oft wie möglich am Tag.