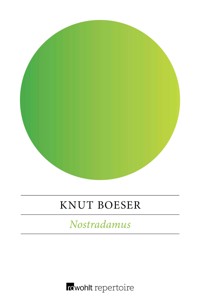
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Nostradamus war eine der schillerndsten Figuren der Renaissance, erfolgreicher Pestarzt und populärster Wunderheiler seiner Zeit, geheimnisumwitterter Prophet künftiger Epochen, Astrologe in Diensten des französischen Königshauses, naturheilkundiger Apotheker und eingeweihter Alchimist. Knut Boeser, Autor des Drehbuchs zum gleichnamigen Film, erzählt das Leben dieses außerordentlichen Mannes, der durch seine vielfältigen Begabungen Bedeutendes vollbrachte, gleichzeitig aber auch unter der bedrängenden Kraft seiner Fähigkeiten litt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Knut Boeser
Nostradamus
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Nostradamus war eine der schillerndsten Figuren der Renaissance, erfolgreicher Pestarzt und populärster Wunderheiler seiner Zeit, geheimnisumwitterter Prophet künftiger Epochen, Astrologe in Diensten des französischen Königshauses, naturheilkundiger Apotheker und eingeweihter Alchimist. Knut Boeser, Autor des Drehbuchs zum gleichnamigen Film, erzählt das Leben dieses außerordentlichen Mannes, der durch seine vielfältigen Begabungen Bedeutendes vollbrachte, gleichzeitig aber auch unter der bedrängenden Kraft seiner Fähigkeiten litt.
Über Knut Boeser
Knut Boeser, Dr. phil., geboren 1944, studierte in Berlin und Paris Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft und Philosophie, lebte dann in Berlin und Wien als freier Schriftsteller, wurde zunächst Chefdramaturg, dann Intendant am Renaissance-Theater Berlin, danach Chefdramaturg an den Staatlichen Schauspielbühnen Berlin; er gab Bücher über Max Reinhardt, Erwin Piscator und Oskar Panizza heraus; lebt heute als freier Schriftsteller in Berlin und schreibt Theaterstücke, Drehbücher, Essays und Prosa.
Inhaltsübersicht
1. Sophie
UND WIEDER TREIBT DER STURM die Flammen über das Land. Überall Feuer, das sich gierig Nahrung sucht. Der Himmel ist schwarz. Blitze zucken im Tumult der Wolken. Die Erde bricht auf. Häuser, riesengroß aus Eisen und Glas und Stein, fallen zusammen. Und alles stürzt in die tiefen Schlünde und Abgründe. Eine Flutwelle kommt über das Land. Aus der Erde schießt kochende Lava. Die Hitze ist so groß, daß das Wasser gleich verdampft. Dunkel ist es jetzt, kalt und wüst und leer. Kein Laut mehr. Nur noch Tod überall.
Michel schreit auf und schreckt hoch. Kalter Schweiß steht ihm auf der Stirn. Er zittert am ganzen Leib. Er weiß nicht, wo er ist. Verwirrt sieht er sich um. Das kleine Zimmer. Das Bett, der Tisch, der Stuhl, der Schrank, die Bücher, die Sternenkarten an der Wand. Durch das offene Fenster scheint die Sonne. Davor die inzwischen so vertrauten Dächer von Montpellier. Draußen der Lärm der Händler und Handwerker; die schweren Karren, die mit ihren großen Eisenrädern über das Pflaster rollen. Eine Glocke schlägt von der Kirche herüber.
Er ist an seinem Tisch über den Büchern eingeschlafen. Die ganze Nacht hat er wieder gearbeitet, der kurze Schlaf hat ihn nicht erquickt. Er reibt sich die Augen, rekelt sich. Alles tut ihm weh, jeder Muskel ist verspannt von der unbequemen Haltung am Tisch und von der Qual im Traum. Das alles kostet ihn so viel Kraft, sich zu wehren gegen das Entsetzliche, das immer wieder auf ihn einstürmt.
Michel deutet langsam auf jeden Gegenstand und sagt leise dessen Namen. Tisch sagt er und legt die Hand auf den Tisch, Buch, Feder, Tinte, Schrank, Stuhl. So buchstabiert er sich die Welt wieder zusammen. Alles ist an seinem Platz, genau wie immer. Nichts ist passiert. Gott sei Dank. Daß doch immer alles so bleiben möge, vertraut und verläßlich. Nichts soll sich je ändern, alles ist gut.
Lucille, seine Wirtin, kommt ins Zimmer. Sie ist so alt wie er, zweiundzwanzig. Sie streicht ihm über den Kopf. Sie kennt das schon.
«Es war ja nur ein Traum», sagt sie. «Ein Traum, Monsieur, nichts weiter. Wie so oft. Alles ist in Ordnung.»
Michel nickt. «Wie spät ist es?»
«Gleich zehn. Sie kommen zu spät zur Ihrer Vorlesung.»
«Warum hast du mir denn nicht gesagt, wie spät es ist?»
Sie seufzt. «Ich habe mich nicht getraut zu klopfen. Sie sind immer so wütend, wenn man Sie bei der Arbeit stört.»
«Aber ich habe doch gar nicht gearbeitet. Ich bin eingeschlafen.»
«Und woher soll ich das wissen? Bin ich ein Hellseher? Sie schüttelt den Kopf und geht aus dem Zimmer, dreht sich an der Tür noch einmal um. «Sie sollten besser im Bett schlafen.»
Michel nickt. Er steht auf, nimmt den Mantel vom Haken und setzt sich seinen Hut auf. Er sieht sich noch einmal um. Alles ist in Ordnung. Ja. Alles ist gut. Aber warum überfallen ihn nur immerzu diese fürchterlichen Bilder und verfolgen ihn? Was ist das für ein Fluch, der auf ihm liegt? Und das war schon so, schon als er ein Kind war. Immer wieder schreckte er in seinem Bett auf und lief schreiend aus dem Zimmer. Das erste Mal, als er solche Katastrophenbilder sah, war er gerade acht Jahre alt. Er war die Treppe hinunter in die Küche gerannt, wo der Vater mit dem Großvater, der für einige Tage zu Besuch bei ihnen war, zusammen saß und frühstückte. «Die Welt geht unter», hatte er geschrien, «alles brennt!»
Der Vater hatte ihn in seine Arme genommen, beruhigend auf ihn eingeredet und ihn zärtlich gestreichelt.
«Du hattest einen Alptraum. Es ist alles in Ordnung. Du hast einfach zu viel Phantasie.»
«Höchste Zeit, daß seine Mutter wiederkommt», hatte der Großvater gesagt.
Michel hatte sich ein Stück Brot vom Teller genommen und wollte zurück in sein Zimmer. «Die Tante stirbt erst in zehn Tagen», sagte er, ohne sich etwas dabei zu denken. «Und die Mama bleibt noch solange bei ihr.»
Der Großvater sah ihn erstaunt an. «Was hast du da eben gesagt?»
Michel drehte sich um. «Was habe ich gesagt?»
«Du hast gesagt, die Tante stirbt erst in zehn Tagen.»
«Dann wird es wohl stimmen.» Michel ging aus der Küche und nach oben in sein Zimmer.
«Hat er das öfter?» fragte der Großvater den Vater.
«Was?»
«Ja, er hat eben … eine Voraussage gemacht.»
«Ach was! Das hat er doch bloß so dahingeplappert.»
«Du solltest das beobachten.»
«Warum? Glaubst du etwa, er hat das Zweite Gesicht?»
«Hoffentlich nicht. Wer weiß, was die Zukunft bringt, der leidet doppelt. Eine furchtbare Strafe, von Gott auserwählt zu sein.»
Der Vater blickte erstaunt. «Keine Gnade?»
«Gott erhebt den Propheten über die gemeinen Menschen», sagte der Großvater, «und die rächen sich dafür schrecklich an ihm.»
Das hatte Michel noch gehört. Er war damals zu müde gewesen, um darüber nachzudenken. Doch vergessen hat er diesen Satz nicht.
Michel nimmt zwei Bücher vom Tisch und Papier und packt alles in seine kleine Ledertasche, die er vom Großvater geerbt hat. Auf dem Tisch liegt ein Laib Brot. Er bricht ein Stück ab und verschlingt es gierig. Im Flur kniet Lucille auf dem Boden und scheuert mit einer harten Bürste die Dielen. Sie schaut auf und lacht ihn an. «Immer müssen Sie zu spät kommen!»
«Ich weiß sowieso nicht, warum ich da überhaupt hingehe. Was die mir erzählen, weiß ich doch längst.»
Wie er sie so anschaut, erinnert sie ihn an Sophie. Ja, wie Sophie. Drall, rosig, blond. Groß die blauen, wachen Augen, die ein bißchen schielen. Derselbe Schalk. Dieselbe Kraft und Energie. Sogar dasselbe Grübchen hat sie. Wenn sie lacht und ihre weißen Zähne zeigt, dann lacht Sophie. Und groß quellen die Brüste aus dem Leinenhemd. Immer gehen ihr die Knöpfe auf, wenn sie arbeitet. Nie achtet sie darauf. So war es auch bei Sophie. Daß ihm das alles heute wieder einfällt …
Sophie war das Kammermädchen zu Hause. Sie stellte gerade einen großen Topf auf den Herd, als Michel in die Küche kam. Das war ein Jahr nach seinem ersten fürchterlichen Traum. Neun war er damals. Er setzte sich mit seinem Buch an den Tisch, nahm sich eine Scheibe Brot, biß ab und las weiter. Sophie beugte sich zu ihm, schnupperte und verzog angeekelt das Gesicht.
«Pfui! Du bist ein alter Stinker! Du hast dich wieder nicht gewaschen. Schäm dich.» Sie machte mit dem Mund ein schrecklich ordinäres Geräusch und hielt sich die Nase zu.
Michel lachte. «Keine Zeit. Außerdem: Waschen ist schädlich.»
«Ja, der Gesundheit. Wer sich nicht wäscht, wird krank. Sophie nahm ihm das Buch weg. «Und beim Essen wird nicht gelesen. Du benimmst dich, wenn du mit deinen Eltern ißt. Benimm dich auch bei mir. Ich bin kein Stück Vieh.» Und da sie wußte, was passieren würde, lief sie schnell um den Tisch herum. Sie lachte und hielt das Buch hoch über ihren Kopf. Michel kletterte auf den Tisch und wollte ihr das Buch wieder wegnehmen. Er sprang sie einfach an und klammerte sich an ihr fest, versuchte, ihren Arm herunterzuziehen. Aber sie war so stark. Sophie lachte immer noch. «Wer zuviel liest, wird dumm im Kopf!» Sie las den Titel des Buches. «Außerdem liest du nicht, was du lesen sollst. Ovid, ‹Die Liebeskunst›. Das ist nichts für kleine Kinder.» Sie gab ihm einen kleinen Nasenstüber. «Laß dich nicht von deinem Großvater erwischen.»
Michel sah sie erstaunt an. «Du kannst ja lesen.»
Sophie lachte und schüttelte den Kopf. «Den Plutarch sollst du lesen. Das hat dein Großvater gesagt. Ich werde ihm sagen, daß du nicht folgst. Ovid!»
«Dann werde ich sagen, daß du heimlich nachts in den Wald gehst. Mit der Gabrille vom Schmied. Und Kräuter sammelst.» Er legte seine Arme um ihren Hals.
«Für deinen Großvater mach ich das. Für seine Medikamente.»
«Und warum tanzt du mit der Gabrille und der alten Jacqueline ums Feuer? Mitten in der Nacht? Mitten auf einem Kreuzweg? Auch für die Medikamente meines Großvaters?»
Sophie wurde blaß. Sie ließ ihn hinunter, legte ihre Arme auf seine Schultern und sah ihn an. «Woher weißt du das?»
«Ich bin dir heimlich nachgegangen. Ich wollte wissen, wer dein Freund ist.»
Sophie kniete sich vor ihm hin. «Michel, wenn das einer erfährt …»
«… kommst du auf den Scheiterhaufen. Ich weiß. Denn dein Freund …» Er lachte und legte ihr seinen Zeigefinger auf die Brust «… ist der Teufel.»
Sophie war sprachlos. Die kurze Spanne nutzte Michel. Er riß ihr das Buch aus der Hand und lief aus der Küche.
Sophie rief ihm nach: «Michel …» Plötzlich waren Angst und Panik in ihrer Stimme.
Michel kam noch einmal in die Küche zurück. «Ich verrat dich nicht, Sophie, keine Angst», beruhigte er sie. «Aber sag mir, wieso kannst du lesen?»
Sophie zuckte die Schultern. «Bevor ich zu euch kam, als ich noch zu Hause bei meinen Eltern war, da habe ich öfter für einen Pfarrer gekocht, dem die Haushälterin gestorben war. Er hat es mir beigebracht.»
Michel schnappte sich noch schnell einen Kanten Brot vom Tisch und rannte nach oben in sein Zimmer. Er saß am offenen Fenster, las seinen geliebten Ovid, knabberte an der knusprigen Rinde und dachte an Sophie. Er liebte diese Spiele mit Sophie, liebte es, mit ihr herumzutoben. Sie dachte sich ja nichts dabei, wenn er sie umarmte und küßte, wenn er sie auf den Boden zog und niederrang. Sollte sie doch glauben, er sei noch ein kleiner Knirps. Für ihn war das wunderbar. Wenn sie sich auf dem Boden wälzten oder wenn sie sein Bett machte und er mit ihr in den Kissen tollte, wenn er dann den Ansatz ihrer Brüste sah, wenn er sie roch, wenn er sich in ihren Röcken vergrub, wenn er einen Blick auf ihre Schenkel erhaschte, wenn er sie schnell streichelte, das alles erregte ihn. Und manchmal nur fragte er sich, ob sie nicht doch längst bemerkt hatte, was da in Wirklichkeit geschah, ob sie sich nur verstellte, weil sie diese Spiele ebenso genoß wie er, die sie natürlich nur zulassen konnte, solange sie ihn für ein unschuldiges, anschmiegsames, sehr verspieltes, sehr liebebedürftiges und ausgelassenes Kind hielt. Manchmal, wenn er es zu toll trieb, dann lachte sie und sagte: «Was wird bloß noch aus dir? Du wirst die Frauen einmal gehörig verrückt machen.» Er sah sie dann fragend an. Und sie strubbelte ihm durchs Haar. «Das verstehst du noch nicht, du kleiner Schelm. Komm, geh lernen. Ich muß auch arbeiten.»
Auf der Straße spielten ein paar Freunde Ball. Sie sahen Michel oben am Fenster und riefen ihn. Er legte das Buch beiseite und kletterte aus dem Fenster. Geschickt ließ er sich am Spalier hinunter. Kaum war er unten, fing er den Ball auf, schoß ihn gleich auf die andere Seite der Straße, rannte hinterher, trickste und dribbelte. Da waren Ovid und Sophie und der Großvater und Plutarch vergessen.
Wenig später kam Sophie aus dem Haus. Sie war ärgerlich. Der Großvater hatte ihn schon überall gesucht. Sie wollte ihn ausschimpfen, aber Michel lachte nur und rannte davon. Sollte sie ihn doch fangen. Sophie lief ihm nach. Michel rannte über die Straße, stolperte, fiel auf den Schotter und verletzte sich am Knie. Die Wunde blutete und tat höllisch weh. Michel setzte sich auf eine Kiste. Er unterdrückte die aufsteigenden Tränen. Er pustete leicht auf die brennende Wunde, zupfte vorsichtig die kleinen Hautfetzen ab und pulte die spitzen Steine aus dem blutigen Fleisch. Sophie kam zu ihm. Ganz außer Atem war sie. Sie sah sich die Verletzung an, schüttelte leicht den Kopf, kniete sich vor ihn hin, beugte sich vor und leckte die Wunde aus. Michel beobachtete sie dabei erstaunt.
«Was machst du da?»
«Ich lecke die Wunde aus.»
«Warum?»
«So wie die Tiere das machen. Da heilt sie schneller. Sieh dir nur immer an, was die Tiere tun. Was sie für Kräuter fressen, was für Blumen, wenn sie krank sind. Die Tiere sind die besten Ärzte.»
Michel kann sich noch genau erinnern. Wie Sophie vor ihm kniete. Ihr roter Mund, ihre weiche rosa Zunge, die seine Wunde langsam ausleckte. Die Hände, die sein Knie hielten. Er sah in den Ausschnitt ihres Kleides. Er konnte ihre weißen Brüste sehen. Und plötzlich streckte er seine Hand aus, zögerte einen Augenblick und faßte ihr dann sacht ins Haar.
Sophie sah ihn erstaunt an. Das war ja nicht zu fassen. Dieser kleine Kerl sah ihr in den Ausschnitt. Sie schüttelte den Kopf, mußte aber über seine Frechheit doch lachen.
«Du bist schön, Sophie.» Das sagte er ganz leise und ganz ernst.
«Unsinn, du Schlingel. Deine Mutter ist schön. Ich komme vom Land. Da ist man gesund. Und kräftig. Aber doch nicht schön.»
«Doch, du bist sehr schön.»
«Du kleiner Stinker, was fällt dir ein? Du bist viel zu klein für so was!» Sie schüttelte den Kopf. Ganz verlegen war sie.
Michel erinnert sich an diesen Tag, als sei es gestern gewesen. Es war Spätsommer. Die Sonne schien. Er sah in Sophies große Augen. Und nichts anderes sah er mehr. Und nichts anderes hörte er mehr. Sie schüttelte den Kopf, beugte sich über sein Knie und leckte die Wunde weiter aus. Michel schloß die Augen und ließ sich die Behandlung genüßlich gefallen.
Plötzlich wurde Sophie hochgerissen. Vier Männer der heiligen Inquisition, alle schwarz gekleidet, standen hinter ihr. Sie hielten Sophie fest. Die Passanten wichen ängstlich aus und gingen schnell auf die andere Straßenseite. Niemand wollte da verwickelt sein.
Der Inquisitor legte seine Hand auf ihre Schulter. «Im Namen der heiligen Inquisition: Sophie Bertrand, du bist verhaftet. Angeklagt bist du der Lykanthropie, angeklagt, nächtlich bei Vollmond im Wald dich in einen Wolf verwandelt zu haben und als Wolf mit dem Teufel Unzucht getrieben zu haben. Sein Hinterteil geküßt, sein Geschlecht geleckt zu haben, dafür er dreimal in deinen wollüstigen Leib gekrochen und dir giftige Kräuter gegeben, deren Wirkung niemand nachweisen kann. Angeklagt, mit diesem Gift die ehrbare Frau des Schmieds getötet zu haben. Damit die Magd des Schmiedes, die Gabrille, sich den Schmied gefügig macht und an sein Vermögen kommt.»
Sophie schüttelte den Kopf. Sie mußte sogar lachen. «Aber das ist doch Unsinn.»
Michel war erstaunt, daß Sophie so gar keine Angst vor diesen Männern zu haben schien. War sie sich denn der Gefahr nicht bewußt? Sie sah ihnen in die Augen, und Michel bemerkte, daß sie ihrem Blick nicht standhielten. Nur der Inquisitor ließ sich nicht beeindrucken.
«Leugne nicht», sagte er. «Die Gabrille hat alles gestanden. Wie ihr das Gift in der Nacht zubereitet und der Frau des Schmieds heimlich in der Suppe verabreicht habt. Wie die arme Frau daran elendig gestorben ist. Wie ihr mit dem Teufel Unzucht getrieben und seinen Kot gefressen und seinen Urin gesoffen habt. Bei der Heiligen Jungfrau hat sie das geschworen, geschworen hat sie, du hast sie verführt mit allerlei Kräutern und Säften, mit dunklen Beschwörungen und unzüchtigen Berührungen. So hast du sie in deinen Bann gezogen.»
Der Inquisitor gab seinen Schergen ein Zeichen, und sie zerrten Sophie mit sich.
Michel warf sich dazwischen und schrie: «Laßt sie los!» Er hielt sie am Kleid fest, er versuchte, sie von den Männern loszureißen. Er schrie, sie sollten Sophie loslassen, sofort. Der Inquisitor packte ihn am Kragen und hob ihn hoch, drückte ihn so fest an sich, daß es weh tat, und zischte ihn an, er solle endlich stille sein. Aber Michel schrie. Er rief den Vater, den Großvater. Sophie sagte noch, er solle schnell ins Haus gehen. Dann zogen die Männer sie weg.
Der Großvater kam schnell über die Straße. «Komm ins Haus», sagte er nur und streckte die Hand aus. Der Inquisitor ließ Michel auf den Boden herunter.
Michel schrie, der Großvater müsse Sophie helfen. Er rannte ihr nach, umarmte sie. Tränen liefen ihm über das Gesicht. Er war verzweifelt. Einer der Schergen riß ihn von Sophie weg und brachte ihn zum Inquisitor. Michel strampelte und schlug aus, prügelte mit seinen kleinen Fäusten auf den Mann ein, biß und kratzte und trat. Der Inquisitor schüttelte den Kopf. Er sah Sophie an und murmelte: «Hast du den Kleinen auch schon verhext? Daß er sich wie ein verliebter Narr aufführt?» Und zum Großvater sagte er leise: «Wir werden das prüfen. Wir kommen wieder.»
Der Großvater nahm Michel bei der Hand und zog ihn zum Haus. «Komm.»
«Aber wir müssen Sophie helfen.»
«Wir können da nichts machen. Komm. Bitte.»
Die Männer der heiligen Inquisition schleppten Sophie mit sich. Sophie war ganz still, wehrte sich nicht. Der Inquisitor sah sich noch einmal um, zeigte auf Michel und wiederholte drohend: «Wir werden das prüfen.» Dann ging er den Schergen nach.
Am Nachmittag desselben Tages brannte Sophie schon auf dem Marktplatz. Unter der Folter hatte sie alles gestanden. Viele Menschen waren gekommen, um das Schauspiel zu sehen. Michel war auch da. Er hatte sich heimlich aus dem Haus geschlichen, denn er wollte jetzt bei Sophie sein. Er drängte sich durch die Menschenmenge nach vorn. Sie stand auf dem Scheiterhaufen, an einen Pfahl gefesselt, sah sich suchend um, fand Michel, und ein Lächeln huschte über ihr gequältes Gesicht. Sie sagte etwas zu ihm. Er verstand sie nicht. Alle um ihn herum redeten erregt durcheinander. Gleich würde sie brennen. Der Tod würde seine Flügel über den Platz legen und alle segnen, denn sie alle lebten unter dem Zeichen des Todes und erflehten seine Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt bekam er ja sein Opfer. Würde er sich damit zufriedengeben?
Ein Scherge stieg die Stufen zum Scheiterhaufen hoch. Er hielt eine brennende Fackel. Der Inquisitor stand auf einem Podest hinter dem Scheiterhaufen. Er hatte die Arme vor der Brust verschränkt und gab dem Mann mit einem leichten Kopfnicken zu verstehen, daß er den Haufen anzünden sollte. Das Reisig fing Feuer. Die Flammen schossen hoch, erfaßten Sophies Kleid und fraßen sich dann in ihre Haut. Sophie brannte lichterloh. Der heiße Feuerwind wehte ihre blonden Haare hoch, bevor die Flammen sie erfaßten. Und für einen Augenblick war es, als stünde da eine verklärte Heilige im Glanz himmlischen Lichtes. Dann hörte Michel Sophie schreien. Ein einziger, lauter, wunder Schrei kam tief aus ihrem Leib. Michel sah ihren weit offenen Mund. Die weit aufgerissenen Augen, die jetzt flehend zum Himmel hoch sahen. Doch der war blau, nur blau und gab kein Zeichen. Und dann fiel ihr der Kopf auf die Brust. Sie sackte ohnmächtig in sich zusammen, spürte die Schmerzen nicht mehr.
Der Großvater hatte sich nach vorne gedrängt. Er nahm Michel bei der Hand und zog ihn mit sich fort. Das letzte, was Michel sah, war der Inquisitor, der zu ihm und dem Großvater herüberschaute. Und da war ein feines, maliziöses Lächeln auf den dünnen Lippen. Und Michel wußte, daß er dieses Gesicht nie mehr vergessen würde, daß ihn dieses Gesicht ein Leben lang verfolgen würde.
Die Leute waren enttäuscht, das alles so schnell vorbei war. Sie blieben, bis der Scheiterhaufen völlig heruntergebrannt war. Michel und der Großvater standen am Rande im Schatten der Kirchenmauer. Über dem Platz lag schwer und süß und herb der Geruch von Sophies verbranntem Fleisch. Einzelne Aschenflocken wirbelten in der Luft. Michel sah zum Himmel hinauf, Sophie schneite schwarz auf ihn herab. Er fing eine Flocke in seiner Hand auf und leckte sie auf. Ach, Sophie! So süß, so bitter. Seitdem dachte er immer nur an Sophie. Kein anderes Mädchen, keine andere Frau haben ihn seitdem interessiert. Alles in ihm ist wie tot. Nur manchmal, nachts, da kommt Sophie zu ihm. Sie steht in Flammen und brennt lichterloh, um sie herum strahlt alles in herrlichem Glanz. Sie streckt ihre Hand nach ihm aus. Und wenn er dann zu ihr geht, zögernd, ängstlich, begierig, dann nimmt sie ihn auf den Arm. Immer ist er neun Jahre alt in diesen Träumen, er legt seinen Kopf an ihre Brust, sie streichelt ihn zärtlich und tröstet ihn, und dann brennt auch er.
Michel sieht auf Lucille hinunter. «Du brennst ja gar nicht», flüstert er und schüttelt den Kopf.
Lucille sieht zu ihm herauf. Sie wirft die Bürste in den Eimer und steht auf. «Was ist mit Ihnen? Sie sehen so merkwürdig aus. Als würden Sie ein Gespenst sehen. Da kriege ich ja direkt Angst.»
Michel schüttelt den Kopf. Er geht schnell an ihr vorbei zur Tür.
Lucille geht ihm nach. Sie trocknet sich die Hände mit der Schürze ab. «Kommen Sie spät nach Haus?»
«Wieso? Nein.»
Lucille richtet seinen Kragen. Immer sieht er so unordentlich aus, nie achtet er auf seine Kleider, immer ist er mit seinen Gedanken ganz woanders, alles vergißt er, wenn man ihn nicht erinnert, immer muß man sich um ihn kümmern, nicht einmal essen würde er. «Ich habe einen süßen Kuchen gebacken», sagt sie. «Davon sollen Sie ein großes Stück haben. Sonst fallen Sie mir noch vom Fleisch. Immer nur lesen. Und in die Sterne gucken. Und nicht wissen, was es Gutes hier unten gibt.» Sie streicht ihm über das Gesicht. «Ganz blaß sehen Sie aus. Ich werde mir was einfallen lassen, damit wieder ein bißchen Farbe in Ihr hübsches Gesicht kommt.»
Michel sieht sie an. «Ich muß los», sagt er.
«Ja», sagt Lucille. Sie hat ihre Hand auf seine Brust gelegt. «Dann gehen Sie, Monsieur.»
Michel nickt. Aber er bleibt stehen, sieht sie an. Er weiß ja, was sie will. Und er will es doch auch. Aber er ist so schüchtern. Er traut sich nicht, er ist sich auch nicht sicher. Will sie es denn wirklich? Er kennt sich mit den Frauen nicht aus. Lacht sie ihn an? Lacht sie ihn aus? Nein. Da ist dieser Schleier über ihrer Iris, und ihr Blick versenkt sich unendlich tief in seinen. Und dabei schielt sie ein wenig mehr als sonst. Nein, er kann sich nicht täuschen. Aber vielleicht gaukelt ihm das alles nur wieder seine überreizte Phantasie vor. Er kann ja kaum noch Traum und Wirklichkeit unterscheiden. Immer wieder überfallen ihn jäh Bilder. Nicht nur nachts, im Traum. Auch am Tage. Meist schreckliche Bilder der Verwüstung und Zerstörung, kaum je glückliche, heitere.
Was passiert, wenn er sie jetzt einfach in seine Arme nimmt? Will sie das nicht? Aber vielleicht ist sie dann empört. Und wütend. Und beleidigt. Vielleicht schreit sie und wehrt sich und schlägt und kratzt und beißt ihn und ruft ihren häßlichen Mann. Ein finsterer, grober, brutaler, ordinärer Kerl, ewig betrunken und übel aufgelegt. Er arbeitet in der Gerberei. Seine Haut ist schwarz und rissig. Und alles, was er tut, ist böse, rachsüchtig und gemein. Warum hat sie den bloß geheiratet? Michel versteht das nicht. Sie ist doch hübsch. Jung. Gescheit. Kräftig. Was findet sie bloß an dem? Immer wieder hat er sie beobachtet, die ganzen Wochen schon, vom ersten Tag an, seit er in dem Haus eingezogen ist. Das ist jetzt zwei Monate her. Da ist er von Avignon nach Montpellier gekommen und hat sich an der Universität für das Fach Medizin eingeschrieben. Immer wieder hat er Gründe gesucht, um sie zu sehen. Wenn sie in der Küche ist und mit ihren kräftigen Händen den Teig für das Brot auf dem Holztisch walkt, wenn sie am Herd steht, eine Suppe kocht und mit der Holzkelle umrührt, wenn sie Kräuter über dem Topf mit den Handflächen zerreibt. Er kann sich nicht satt sehen an ihr. Wenn sie Wäsche wäscht, wenn sie sich über den Zuber beugt und mit der harten Seife die Laken auf dem Riffelbrett einreibt. Das Geräusch der Seife auf dem Blech, das Geräusch der Stoffe, wenn sie sich energisch bewegt. Wenn der Stoff ihres Kleides sich über der Hüfte spannt. Wie sie sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn wischt. Stundenlang könnte er sie ansehen. Irgendeinen Vorwand findet er immer, um in ihrer Nähe zu sein. Er bringt ihr Holz, zündet das Feuer im Ofen an, trägt das Wasser in die Wohnung. Er steht dann in der offenen Tür und beobachtet sie. Sie dagegen scheint ihn nie zu bemerken. Immer ist sie konzentriert bei ihrer Arbeit. Wenn sie auf dem Boden kniet und die Dielen scheuert, den Rock hochgerafft, die Ärmel aufgekrempelt, die Haare offen, wenn sie eine lästige Locke, die sie stört, aus der Stirn schiebt. Die einfachen Bewegungen. Immer auf einen Zweck gerichtet. Nichts Überflüssiges. Kein Zweifel. Was sie tut, ist richtig und vernünftig, nützlich und gut, das macht sie so schön. Warum packt er sie nicht einfach und küßt sie? So, wie es die Kollegen im Seminar tun. Jedenfalls geben sie immer damit an, mit ihren Erfolgen bei den Weibern. Glaubt man denen, dann lieben es die Frauen ja geradezu, wenn man sie mit Gewalt nimmt und ihren Widerstand bricht. Und wenn sie sich wehren, keine Angst, dann doch nur, um die Wollust anzustacheln. Ihre und die des Mannes. Aber das ist vielleicht nur Protzerei, dummes Gerede. Michel weiß es nicht. Nichts weiß er. Er ist so unglücklich und voller Sehnsucht und Angst. Abrupt dreht er sich um und will gehen.
«Wozu wollen Sie denn überhaupt in die Vorlesung?» fragt ihn Lucille. «Wenn Sie, wie Sie sagen, ohnehin schon alles wissen, was die Ihnen da erzählen. Das wär doch nur Zeitverschwendung.»
Michel lacht. «Das ist wahr. Aber ohne das Diplom dieser Narren bin ich nichts.»
Und plötzlich nimmt sie seinen Kopf in die Hände und küßt ihn. «Komm», sagt sie. «Der Kuchen ist noch warm. Jetzt schmeckt er am besten.»
«Und dein Mann?»
«Ist ein Narr und Trunkenbold.»
Sie lacht und zieht ihn in ihr Zimmer. Die Tür schlägt sie mit dem Fuß zu. Sie stehen sich gegenüber. Sie legt die Arme um seinen Hals. «Küß mich», sagt sie. «Oder magst du mich nicht?»
«Doch. Ich will dich ja küssen. Die ganze Zeit schon will ich dich küssen.»
«Und warum hast du es nicht gemacht?»
«Weil ich Angst habe, daß es dir mißfallen könnte.»
«Aber ich warte doch nur darauf. Seit du hier bist. Hast du das nicht gemerkt?» Lucille küßt ihn sanft auf den Mund. «Und? War das jetzt so schwer?»
Michel zittert am ganzen Leib. Lucille knöpft ihm den Mantel auf.
«Du zitterst ja», sagt sie.
Michel zieht die Schleifen ihrer Schürze auf. Dabei macht er ungeschickt einen Knoten in die Bänder. Das dauert alles so lange. Sie reißt den Knoten auf, zieht ihr Kleid aus und läßt es fallen. Jetzt steht sie vor ihm, nackt. Michel sieht sie nur an. Regungslos, stumm, gebannt. Sie zieht ihm den Mantel aus, das Hemd, die Hosen. Dann zieht sie ihn auf den Boden. Da liegt sie neben ihm. Michel kann es noch nicht fassen. Der Duft ihrer Haut. Ihr Haar. Das Fleisch. Diese Wonne. Er glaubt, er wird gleich ohnmächtig. «Komm», sagt sie. «Bitte komm.» – «Ja», sagt er. «Ja.» Und sie zieht ihn über sich, führt ihn, lenkt ihn. Er ist so aufgeregt und ungestüm. Sie beruhigt ihn. «Du hast so weiche Haut», flüstert sie und steichelt ihn. Er kann gar nicht genug bekommen, er will immer mehr. Und sie will es auch.
Auf dem Holztisch liegt eine nackte Frau. Der Professor setzt das Messer unter ihrem Schlüsselbein an und zieht es langsam durch ihr Fleisch bis zum Schambein hinunter. Dann öffnet er ihren Leib. Der Professor hustet. Der Tisch steht genau in der Mitte des ovalen Saales, links und rechts vom Tisch steigen Treppen hoch an. Da sitzen die Studenten und sehen dem Professor zu. Der Professor wischt sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn, als Michel außer Atem hereinkommt. Er beißt noch von seinem Kuchen ein Stück ab und stopft sich den letzten Rest in den Mund und geht schnell auf einen freien Platz. Der Professor hält inne und sieht ihm nach.
«Ah! Monsieur de Nostradame gibt uns doch noch die Ehre», sagt er. «Ich bin entzückt.» Er wartet, bis Michel sich gesetzt hat, dann zeigt er auf die tote Frau vor ihm und wendet sich an die Studenten. «Diese Frau hat sich vergiftet. Das Gift hat das Blut erhitzt. Das Blut hat sich ausgedehnt und einen gewaltigen Druck auf das Gehirn ausgeübt. Daran ist sie gestorben. Aber es hätte eine Möglichkeit gegeben, die Frau zu retten.» Er zeigt mit dem blutigen Messer auf einen Studenten. «Wie?»
«Man hätte sie nur rechtzeitig zur Ader lassen müssen.»
«Richtig. Das hätte den Druck auf ihr Hirn verhindert.» Der Professor hustet, hält sich die Hand vor den Mund und wischt sich mit dem Handrücken den Speichel ab. Er hat Schweißperlen auf der Stirn. Michel sieht das. Er tippt den Studenten, der neben ihm sitzt, an und flüstert: «Der Mann ist krank!»
Der Professor sieht sich um. «Frage: In welchem Organ findet man das Gift?» Er zeigt auf einen Studenten.
«Im Herzen.»
Der Professor schüttelt den Kopf. Er zeigt auf einen anderen Studenten.
«In den Füßen.»
Der Professor lacht. Und die Studenten lachen auch. Der Professor hustet und zeigt auf Michel. «Monsieur de Nostradame, bitte erklären Sie es Ihren Kommilitonen.»
Michel nickt. «Die Antwort, die Sie hören wollen, ist: ‹In den Nieren.›»
«Richtig. Aber ich höre da einen Unterton in Ihrer Antwort, der mir nicht gefällt.»
«Die letzten Untersuchungen des Doktor Rabelais in Paris haben ergeben, daß man hohe Konzentrationen des Giftes auch in der Leber findet.»
«Paris!» sagt der Professor voller Verachtung. Er faßt der Frau in den Leib, packt die Leber, schneidet sie heraus und hält sie hoch. Er dreht sich einmal im Kreis, damit alle Studenten die Leber sehen können. «Die Leber. Bitte sehr. Und wo ist hier Gift? Ich sehe keines. Sie etwa?»
Einige Studenten lachen.
Michel nickt. Das kennt er alles zur Genüge, die dummen Witze auf seine Kosten. «Wenn Sie mir die Leber überlassen, ich werde es Ihnen beweisen.»
«Schnickschnack.»
«Und im Herzen findet man es auch.»
«Unsinn.»
Michel überlegt, ob er dem Professor widersprechen soll. Warum? Wozu? Es gibt doch nur wieder eine dieser blödsinnigen Auseinandersetzungen, in deren Verlauf er den kürzeren ziehen wird. Soll der Mann doch sagen, was er will. Und dann sagt Michel es doch. Er steht sogar auf. Dieser Unsinn, die Sturheit, die Uneinsichtigkeit, all das ärgert ihn. «Die medizinische Fakultät der Universität von Montpellier», sagt er kühl, «ist deshalb die beste in Europa, weil wir Leichen bekommen, die wir sezieren können. Warum, monsieur le professeur, geben Sie sich mit dem Wissen aus den alten Büchern zufrieden, anstatt wirklich zu forschen, was Sie ja hier können, und die Organe zu untersuchen?»
«Wollen Sie mir vorschreiben, was ich zu tun habe?»
«Nein.»
«Also stimmen Sie meiner Diagnose zu? Ich fühle mich geschmeichelt.»
Einige Studenten lachen.
«Sie haben recht, ja, das Gift hat das Blut erhitzt.»
«Danke, Monsieur de Nostradame.» Der Professor verbeugt sich leicht vor Michel.
«Aber daran ist die Frau nicht gestorben.»
«Sondern?»
Michel läßt sich nicht aus der Ruhe bringen. «Ich bin sicher, das Blut hat sich in der Folge der Vergiftung erhitzt, weil der Körper sich damit selbst helfen wollte. Das heiße Blut wollte den Infekt bekämpfen.»
«Unsinn.» Der Professor wirft verächtlich die Leber der Frau auf den Tisch. Er wischt das Blut an seiner Hand mit der Schürze ab.
«Und insofern wäre es die falsche Therapie gewesen, der Frau einen Aderlaß zu machen, weil man damit den Heilungsprozeß gerade verhindert hätte.»
Jetzt wird der Professor wütend. Diese Frechheit darf er sich nicht länger bieten lassen, das untergräbt seine Autorität. Er sieht, wie die Studenten lauern. Sie genießen das, denn sie mögen Michel nicht. Aber daß er sich mit dem Professor anlegt, gefällt ihnen, auch wenn es am Ausgang des Disputs keinen Zweifel gibt. Gleich wird dieser Großkotz, der mit seiner Besserwisserei allen schon lange auf die Nerven geht, der aber immer sofort ganz stille wird und geht, wenn die Zoten geschwinde rennen, der nicht mit ihnen säuft und flucht und spielt, den man noch nie mit einer Frau gesehen hat und auch von keiner was Lustiges zu erzählen weiß, endlich wird der kleingemacht und auf das rechte Maß gestutzt. Das hat sich schon oft so abgespielt. Doch diesmal kommt es hoffentlich und endlich zum Eklat. Das kann der Professor sich nicht mehr gefallen lassen. Vielleicht wirft er ihn ja raus. Dann wären sie ihn endlich los, diesen eitlen, größenwahnsinnigen Menschen.
Der Professor antwortet Michel scharf: «Monsieur de Nostradame …» Er hustet und atmet schwer, bekommt kaum Luft, öffnet den Kragen ein wenig. Schweißperlen stehen auf seiner Stirn. «Wenn wir Sie zum Doktor der Medizin promovieren wollen, dann sollten Sie zunächst einmal lernen, was wir Ihnen beibringen.»
«Sie können mich fragen, was Sie wollen», sagt Michel. «Ich werde Ihnen antworten. Und zwar so, wie Sie es hören wollen. Ich weiß, was in den alten Büchern steht.»
«Und nur deshalb höre ich mir Ihr Geschwätz überhaupt an. Weil Sie einer der Besten hier sind. Aber glauben Sie nicht, daß Sie sich deshalb Freiheiten herausnehmen können.»
«Ich habe doch nur auf die neuesten Forschungen des Doktor Rabelais hingewiesen.»
«Papperlapapp. Sie wollen Gott spielen, was? Wie dieser Salbader! Ein abgefallener Franziskaner, ein abgefallener Benediktiner, abgefallen von der Kirche überhaupt. Leichtfertig setzt der das Leben seiner Patienten für seine kleine Eitelkeit aufs Spiel. Für seine Unsterblichkeit rottet er ganze Landstriche aus. Seien Sie vorsichtig, Monsieur de Nostradame! Ihr Doktor Rabelais ist mit dem Teufel im Bunde. Und wird sicherlich, wenn er so weitermacht, bald Gelegenheit haben, seinem Herrn den Antrittsbesuch zu machen. Dann kann er ihm dankbar den Hintern küssen.» Der Professor winkt ab, wendet sich zu den Studenten und zeigt mit dem Messer auf die Frau. «Meine Herren, nur ein Aderlaß hätte dieser Frau geholfen.»
«Schneller zu sterben, ja», sagt Michel. Er hat keine Lust, sich länger diesen Unsinn anzuhören. Immer wieder hat er in den Spitälern gesehen, wie der Aderlaß, der bei jeder Krankheit als Allheilmittel angewendet wird, den Kranken schwächt, statt zu helfen. Und das soll nun als probates Mittel all den Schwachköpfen hier, die bald als Ärzte unterwegs sein werden, eingetrichtert werden.
«Jetzt seien Sie endlich still!» brüllt der Professor außer sich. «Und setzen Sie sich!»
«Ihr Aderlaß hätte sie nur noch mehr geschwächt. Sie hatte heißes Fieber, kein kaltes. Das haben Sie selber gesagt. Tödlich ist das kalte. Das heiße ist das gute der Abwehr und Kraft im kranken Leib.»
«Sie sollen sich setzen!» Die Stimme des Professors überschlägt sich. «Wollen Sie mich belehren, was ich zu tun habe?»
Michel setzt sich wieder. Aber dann steht er noch einmal auf. «Ich will doch nur den natürlichen Heilungsprozeß, den Gott in seiner wunderbaren Fügung dem Körper aus eigener Kraft zuteil werden läßt, unterstützen.»
«Monsieur de Nostradame, es steht Ihnen frei, Sie können jederzeit die Klasse verlassen. Aber dann brauchen Sie auch nie wieder zu kommen. Ich habe keine Zeit, mit Studenten wie Ihnen meine Zeit zu vergeuden. Ich habe hier anderes und Wichtiges …»
Weiter kommt er nicht. Er hustet, schnappt nach Luft und greift sich an den Hals. Er sieht sich um, als würde er einen Halt suchen, streckt die Hand aus, das Messer fällt auf den Boden, er bricht über der Leiche der Frau zusammen.
Niemand rührt sich. Alle sehen erschrocken hinunter auf den Tisch. Der Professor liegt reglos auf der toten aufgeschnittenen Frau. Michel geht schnell nach unten, zieht den Professor von der Leiche. Zwei Studenten helfen ihm, legen den Professor vorsichtig auf den Boden. Michel öffnet ihm das Hemd. Und da sieht man auf der Brust und unter den Armen lauter rote, dunkelrote, ins Schwarz schimmernde, geschwollene, feuchte, schon aufgeplatzte Beulen, die an den Rändern eitern. Die beiden Studenten schrecken zurück. Einer schreit: «Er hat die Pest!»
Die Studenten laufen in Panik aus dem Saal. Nur Michel bleibt bei dem Professor.
«Sie sind sehr krank.»
«Ich weiß», flüstert der Professor. «Ich werde sterben.»
«Sie hätten nicht in die Universität kommen dürfen. Sie werden alle angesteckt haben.»
Der Professor lacht einmal schrill auf. «Das ist die Strafe Gottes. Alle nehme ich euch mit in den Tod, ihr Narren!» Er lacht noch einmal, bäumt sich auf, packt Michel am Arm, seine Hand krallt sich fest ins Fleisch, schwarzer Schaum quillt aus seinem Mund. Mit großen Augen sieht er Michel an. Dann fällt er zurück auf den Boden und stirbt.





























