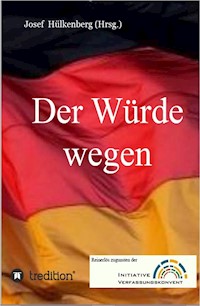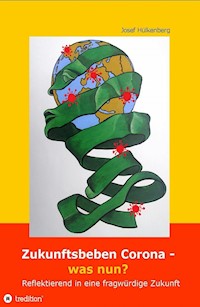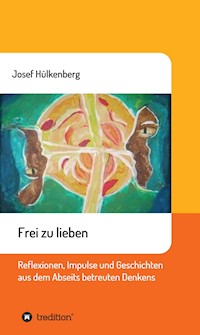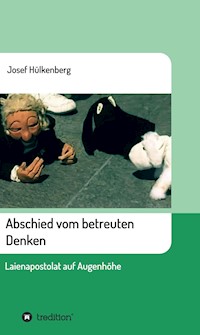8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sind die als „Wurzeln der Demokratie“ berühmten historischen Ereignisse etwa gar keine Wurzeln, sondern Früchte einer zeitübergreifenden menschlichen Sehnsucht? Wenn die in Richtung Demokratie deutenden Ereignisse historische Früchte sind, was ist dann der eigentliche Wurzelgrund, der solche Früchte immer wieder hervorbringt? Welche Urkraft bricht sich Bahn, wenn sich Menschen massenhaft für Volksabstimmungen, Bürgerbeteiligungen und partizipative Demokratie engagieren? Wenn sich diese Menschen wehren gegen staatliche Bevormundung, zu denen sich sogar Regierungen immer wieder hinreißen lassen, die nach als demokratisch definierten Verfahren ins Amt kamen? Ob in Arabien, Osteuropa, Afrika oder Asien, überall auf der Welt suchen Menschen für die Entwicklung ihrer Gesellschaft und ihres Staates nach demokratischen Lösungswegen. Einer Demokratie neuzeitlich-westlicher Tradition stehen sie aus guten Gründen skeptisch gegenüber. Denn diese Konstruktion von „Demokratie“ läuft bereits aus dem Ruder. Sie nimmt die Kompetenzfülle ihrer Bürger nicht wahr, reduziert deren Mittun auf einen rituellen und regelmäßigen Urnengang. So wird zum Prüfstein von Demokratie-Konzepten, ob jeder Bürger aus eigenen Lebenserfahrungen, Kompetenzen und Einsichten ohne Expertenwissen aufgrund eigenen gesunden Hausverstandes solche Politikstrukturen bejahen, mittragen und umsetzen kann. Es ist eine Herausforderung an jede Demokratiereform, die Selbstregulation der Gesellschaft freier Menschen sowie den dazu förderlichen Aufbau des Staates in diesen Kompetenzen der Bürger und der dadurch ausgelösten gesellschaftlichen Dynamik zu verankern. Mit leichter, oft humorvoller Sprache führt der Autor die Leser in die abenteuerliche Welt der Demokratiereform.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 399
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
Dieses Buch widme ich all jenen couragierten Bürgern, die sich ihre Verantwortung für die eigene und gesellschaftliche Freiheit von niemandem abnehmen oder abkaufen lassen.
Jenen Bürgern, die die Courage haben, Bestehendes zu hinterfragen, Missstände zu benennen und kreativ nach Lösungen zu suchen.
Die sich Visionen erlauben und sich nicht entmutigen lassen, nachzuschauen, wohin wir kommen könnten.
Wo kämen wir hin, wenn jeder sagte:
„Wo kämen wir hin, …!“,
und niemand ginge, um zu sehen,
wohin wir kämen, wenn wir gingen?
(Kurt Marti, schweizer Pfarrer und Schriftsteller, *1921)
Josef Hülkenberg
Nur mal angenommen …
… Demokratie ginge anders
Auf der Spur einer Sehnsucht und den Bedingungen ihrer Realisierung
Überarbeitete und erweiterte Neuauflage
www.tredition.de
© 2016 Josef Hülkenberg
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7345-3269-6
Hardcover:
978-3-7345-3270-2
e-Book:
978-3-7345-3271-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Seit 2008 ziert das Mindmap der Titelseite die Heckseite der denk!BAR®mobil, mit der Josef Hülkenberg durch die zentraleuropäischen Regionen tourt. Dabei erfüllt das Mindmap immer wieder seinen Zweck: es führt zu Gesprächen unterschiedlicher Bürger mit dem Autor.
© 2015 Josef Hülkenberg
Umschlag, Illustration: Josef Hülkenberg
VORWORT
Die Überlegungen in diesem Buch richten sich an jene Mitbürger, die den Traum von Demokratie nicht den politischen Realitäten opfern wollen. Die hoffentlich in absehbarer Zeit aufgefordert sind, durch ihre Stimme für eine Verfassung ein demokratisches Staatswesen zu legitimieren.
Vorrangig sind es die deutschen Wähler, denen seit 1949 aufgetragen ist, sich in Freiheit eine deutsche Verfassung zu geben. Artikel 146 des Grundgesetzes begrenzt die Geltung des seinerzeitigen Provisoriums auf dieses damals nicht mögliche Referendum. In Österreich drängen Bürger zum Jubiläumsjahr, ihre 1915 beschlossene Verfassung modernen demokratischen Erkenntnissen anzupassen. Auch im erweiterten Spektrum Europas und Amerikas steht es entgegen aller Beschwörungen der Staatslenker keineswegs gut um die Demokratie. Eher wird sie von eben diesen Staatslenkern kritisch betrachtet und systematisch abgebaut.
Diese Wähler, die von der politischen Klasse so gern umsorgten „Bürger draußen im Lande“ sind in ihrer Mehrheit nicht sozialphilosophisch oder politologisch geschult. Trotzdem haben sie in ihrer Verantwortung als Souverän über staatstheoretische Konstruktionen zu entscheiden. Diese legen dauerhaft die Rahmenbedingungen für ihr Leben, ihre Freiheit und ökonomischen Grundlagen als auch ihre personale Selbstverfügung im je eigenen Lebensraum fest. Haben die Bürger auch selten ein staatstheoretisches Expertenwissen, so sind sie doch kompetent in ihren beruflichen Belangen vor allem aber auch in der Gestaltung ihrer individuellen und sozialen Lebensbezüge. Das schließt auch die vielfältigen Lebenskrisen in beruflicher oder privater Sphäre ein.
Ob in Arabien, Osteuropa, Afrika oder Asien, überall auf der Welt suchen Menschen für die Entwicklung ihrer Gesellschaft und ihres Staates nach demokratischen Lösungswegen. Einer Demokratie neuzeitlich-westlicher Tradition stehen sie aus guten Gründen skeptisch gegenüber. Denn diese Konstruktion von „Demokratie“ läuft bereits aus dem Ruder. Sie nimmt die Kompetenzfülle ihrer Bürger nicht wahr, reduziert deren Mittun auf einen rituellen und regelmäßigen Urnengang. So wird zum Prüfstein von Demokratie-Konzepten, ob jeder Bürger aus eigenen Lebenserfahrungen, Kompetenzen und Einsichten ohne Expertenwissen aufgrund eigenen gesunden Hausverstandes solche Politikstrukturen bejahen, mittragen und umsetzen kann. Darum ist es eine Herausforderung an jeden Demokratiereformer, die Selbstregulation der Gesellschaft freier Menschen sowie den dazu förderlichen Aufbau des Staates in diesen Kompetenzen der Bürger und der dadurch ausgelösten gesellschaftlichen Dynamik zu verankern.
Mein persönlicher Blick auf die Fragen und Herausforderungen unserer Zeit ist der Blick eines durch das II. Vatikanische Konzil geprägten Christen. Ein modernes Kirchenlied wurde mir zum Leitwort: „Gehet nicht auf in den Sorgen dieser Welt […], ihr seid das Licht in der Dunkelheit der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Denen, die suchen, macht hell den schweren Weg.“ Mit großer Freude kann ich immer wieder erfahren, wie sehr Menschen anderer Religionen und Weltanschauungen als Salz der Erde wirken und mir den Weg erhellen.
Der theoretische Diskurs über Fragen der Demokratie wäre mir zu wenig. Mein Anliegen ist es
Mut machen zur Entwicklung moderner Demokratie,
Wege zu zeigen, wie diese Entwicklung angegangen werden kann
und wohin sie führen könnte.
Dieses Buch setzt nicht an beim wohlfeilen geisteswissenschaftlichen Rückgriff. Mein Ansatzpunkt ist die jedem Menschen gegebene Fähigkeit, über sich und seine Lebensumstände nachzudenken. Dabei gilt es, allgemein zugängliche Informationen offen in die Überlegungen einzubeziehen. Dieser Arbeitsansatz führt zu spiralförmigen, gelegentlich bruchstückhaften Darlegungen. Doch auch das Fragment-hafte ist Teil unseres Lebens und somit auch Teil jedes demokratischen Entscheidungsprozesses.
Wem das zu wenig ist, wer die klassische geisteswissenschaftliche Bearbeitung fordert, den verweise ich gerne auf die Bibliografie am Ende dieses Buches.
Sie, als Leser dieses Buches, bitte ich, die vorgelegten Überlegungen im Spiegel eigener Erfahrungen zu betrachten und zu bewerten. Vielleicht kommen wir auf diesem Weg doch irgendwann zu einer Demokratie, die ihren Namen verdient.
Zum Sprachgebrauch
Sofern ich mich in den Texten nicht ausdrücklich auf männliche oder weibliche Bezugspersonen beziehe, hängt die Verwendung der Personalpronomen allein vom Subjekt meiner Überlegungen ab.
Mal ist es „die Person“, mal „der Mensch“. Zeit meines Lebens habe ich erfahren, dass mir die Konkretisierung dieser theoretischen Begriffe sowohl als Frau wie als Mann in Erscheinung tritt. Leider gilt das auch für die Negation dieser Begriffe in „Unmensch“ oder „Unperson“. Gern würde ich noch erleben, dass die Zuordnung beruflicher, sozialer oder gesellschaftlicher Kompetenzen und Funktionen bis hin zur Zulassung religiösen Ausdruckshandelns sich nicht mehr an der Chromosomenstruktur orientiert.
Eine Spurensuche
Wie komme ich nach Kleinkleckersdorf, wenn doch alle Wege nach Rom führen?
Da war sie wieder, die Phrase von der Wurzel der Demokratie. Ein Feuilletonist hatte diese scheinbare Ehrbezeugung auf die nun 800 Jahre alte Magna Charta angewandt, jenen Vertrag zwischen den englischen Baronen und ihrem König John aus dem Jahre 1215. Als „Wurzel der Demokratie“ wurde schon Vieles benannt. Mal sei es das antike Athen, mal die englische (1642-1649), amerikanische (1763-1773) oder französische Revolution (1789). Je nach Jubiläumsdatum trifft diese Phrase auch schon mal den Tübinger Brief (1514), den Ulmer Schwörbrief (1397) oder die eine oder andere Gerichtslinde bzw. germanische Thingplätze. Im Lauf der Jahre hatte ich mir abgewöhnt, Plattitüden wie die „Wurzel der Demokratie“ näher zu beachten.
Diesmal waren meine persönlichen Rahmenbedingungen anders. Eine dumme Sturzverletzung hatte mich ins Krankenhaus gebracht, Schmerzmittel lösten die latente Hemmung konzentrierten Verstandes auf und gaben dem anarchischen Geist der Zufallseinsicht (Experten sprechen von Serendipity) neuen Freiraum. In Tagträumen dösend sah ich meinen einstigen Biologielehrer Haare raufend beim Versuch, uns Schülern klarzumachen: „Pfifferlinge sind keine Pilze! Weder Champignons noch Steinpilze, Morcheln oder Fliegenpilze sind Pilze, selbst wenn wir sie so nennen.“ Fruchtkörper seien sie, Fruchtkörper von Pilzen. Die Pilze selbst seien eine eigenständige Lebensart – irgendwo zwischen Tier und Pflanze –, die unter bestimmten Rahmenbedingungen ihre essbaren oder auch giftigen Fruchtkörper ans Tageslicht bringe.
Sind also die als „Wurzeln der Demokratie“ berühmten historischen Ereignisse gar keine Wurzeln, sondern Früchte einer zeitübergreifenden menschlichen Sehnsucht? Wenn die in Richtung Demokratie deutenden Ereignisse historische Früchte sind, was ist dann der eigentliche Wurzelgrund, der solche Früchte immer wieder hervorbringt? Welche Urkraft bricht sich Bahn, wenn sich heute Menschen massenhaft für Volksabstimmungen, Bürgerbeteiligungen und partizipative Demokratie engagieren? Wenn sich diese Menschen wehren gegen staatliche Bevormundung, zu denen sich sogar Regierungen immer wieder hinreißen lassen, die nach als demokratisch definierten Verfahren ins Amt kamen?
Systematisch begann ich die Suche nach dem gemeinsamen Nenner der vielfachen Bestrebungen um politische Teilhabe, Mitbestimmung und gesellschaftlicher Partizipation. Die Suche nach dieser Urkraft anhand ihrer historischen Fruchtkörper führte mich zu frühen Stammeskulturen mit rituellen Palaverplätzen unter heiligen Bäumen, zu Freiheitskämpfen in antiken Hochkulturen bis hin zu heutigen Widerstandsbewegungen gegen nationale Diktaturen und internationale Beherrschungsstrukturen wie Freihandelsverträge, Bankensysteme oder Ausbeutungsindustrien.
Seit Jahren war mir klar, dass es grundlegende Reformen unserer in Europa erfahrbaren Demokratie braucht, damit sie nicht in der EU-Demokratur untergeht und dem globalen Moneytheismus geopfert wird. Die Überzeugung, dass Strukturreformen und eine neue Politik-Architektur nur unzureichende Lösungen bringen, führte mich auf die Demokratie-Pilgerwege. Den „Karren der Demokratie“ vom Hambacher Schloss zum Brandenburger Tor ziehend (2007) bzw. vom „Westfälischen Frieden zur europäischen Einheit“ (Osnabrück – Straßburg 2009), suchte und fand ich das Gespräch mit vielen Bürgern über ihre Vorstellung von Demokratie und demokratischer Mitwirkung. Diese Erfahrungen als auch die historische Recherche brachten mir eine neue Betrachtung des Phänomens „Demokratie“.
Den Mächten ausgesetzt?
Spuren suchen gelingt nur im Rückblick. Ein erster Blick in die Geschichte lässt da wenig Gutes erkennen. Die Menschheitsgeschichte ist überlagert von Zeugnissen jeder Art, wie Menschen Mitmenschen unter ihre Macht zwängen, sie beherrschen und zum eigenen Vorteil benutzen oder ausnutzen. Menschliche Hab- und Machtgier fand und findet immer wieder Wege, die für jede soziale Struktur nötigen Entscheidungs- und Partizipationsformen zu korrumpieren. Die Unterjochungsformen ändern sich, das Joch bleibt, hieße es Sklaverei, Leibeigenschaft, Knechtschaft, Proletariat oder Prekariat. Die Versorgungslage vieler Beherrschter verbesserte sich, ohne die Beherrschung zu mindern.
Sklaven, Leibeigene und Arbeiter hatten ihr Dach überm Kopf, ihre Pächterkate oder Mietwohnung. Sie erhielten Nahrung und Entlohnung, um ihre Kräfte zu erhalten. Die „guten Herren“ kümmerten sich um Vieh, Haustiere und Gesinde. Als sie ihrer patriarchischen Verantwortung überdrüssig wurden und die Sicherung der Lebensgrundlagen auf die Betroffenen selbst auslagerten, mussten Lohn- und Tarifsysteme zum Schutz der „abhängigen Erwerbstätigen“ entwickelt werden. Wurde so das Joch erleichtert durch Sozialversicherungen, Tarifverträge oder Wohnungsbauförderung, bleibt die Abhängigkeit doch das Joch der Beherrschten. Es sei kein gutes Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein, meinte der indische Philosoph Jiddu Krishnamurti (1895-1986).
Es waren nur wenige Jahrzehnte generöser Verteilung des in Arbeits-Gemeinschaft Erwirtschafteten nach dem Zweiten Weltkrieg. Als verführerische „Sozialpartnerschaft“ verstellte sie vielen den Blick und ließ sie im eigenen Häuschen, bei Fernsehunterhaltung oder samstägliche Kfz-Pflege das Joch existentieller Abhängigkeit vergessen. Hab- und Machtgier lassen aber keine Ruhe. Mögen auch Produktivität und Volkseigentum wachsen, dass es für alle reiche, so reicht es doch nie für die Gier der Nimmersatten. Immer wieder finden die, die schon viel haben, Vasallen, die ihnen zu Willen und Diensten sind. Engagiert bereiten sie ihren Herren den Weg zum Mehr, sofern sie nur selbst ihren (goldenen) Schnitt dabei machen. „Der Sklave will nicht frei sein, er will Aufseher werden“ erkannte der polnische Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) als Ursache solchen Vasallentums.
Nach dem Wegfall der Mauer in Deutschland und des Eisernen Vorhangs in Europa hatte das sozialistische Gegenmodell zum westlichen Kapitalismus seine Kraft verloren. Der neu erstarkte Kapitalismus konnte seine Maske fallen lassen und die gelobte Sozialpartnerschaft demaskieren als friedliche Koexistenz von Schwein und Huhn zur Herstellung eines Strammen Max. Gedeckt und unterstützt von den intelligenten Vasallen betreiben die Gierigen der Reichen eine ihnen nützliche Umkehr der Werte. Nicht nur auf Orwells „Farm der Tiere“ erzählen sie den Unterjochten von der betörenden Freiheit der Unfreiheit.
Aus Kolonialismus früherer Tage wurde „Entwicklungszusammenarbeit“, daraus entstand globale neue Ökonomie - die klassische Doppelwende brachte neuen Schwung auf die alten Ziele. Der Juliusturm, einst die hohe Kante des vollen Staatshaushaltes wurde als moderner Turm von Babel zur Zentrale einer imperialen Finanzindustrie - hochgezogenen mit faulen Kreditvergaben, bei spekulativer Statik aus Derivaten und Subprimestrategien. In internationalen Vereinbarungen wie Basel I bis III ermächtigten sich die internationalen Finanzinstitute ohne Umweg über nationale Parlamente zu Gesetzgebern im Finanzmarkt. Sozialpolitische Reformen à la Hartz oder Agenda 2010 wurden zum Befreiungsschlag von der sozialen Last der Vermögensaneignung.
Mal stützten sich die Herrschenden auf Lanzen, Bajonette oder Raketen, mal auf eine gewaltbetonte antike Eigentumsideologie, mal auf Konglomerate von spirituellen Angstszenarien über Gottgnadentum bis hin zum Vorsehungsanspruch. Knechtschaft der Verschuldeten wird heute durch Knechtschaft durch Kreditvergabe beschleunigt. Zumeist ist es ein Gemenge all dieser Sphären, welches ihnen die Beherrschung und Bewirtschaftung der Menschenmassen sichert.
Seit die Menschen sesshaft wurden in der neolithischen (R)Evolution vor ca. 10. 000 Jahren hat solches Ideologiegemenge die Welt-Anschauungen geprägt.
Eine Grundsehnsucht bricht sich Bahn
Ein tieferer Blick in die Geschichte zeigt aber auch Ereignisse, in denen um das gekämpft wurde, was wir heute demokratische Partizipation oder Teilhabe nennen. So wurde immer wieder ein Widerstand von Bürgern gegen die Bevormundung durch ihre politische Führung erkennbar. Solcher Bevormundung setzten sie ihre Ansprüche auf Selbstverfügung in der politischen Gemeinschaft und Mitentscheidung über die gemeinsamen Belange entgegen.
Der Gemeinschaft unterworfen?
Die Jäger und Sammler waren sesshaft geworden. In Sippen, Stämmen oder Clans bemächtigten sie sich Teile eines Landes und siedelten sich in kleinen Ortschaften an. Zu den sehr früh erkennbaren Sehnsüchten und Bestrebungen der Menschen zählt das Leben in einem befriedeten, konfliktarmen Umfeld. Ein Lebensraum, in dem man in guten Nachbarschaften seine Felder bestellen oder seinen Handwerken nachgehen konnte und der vor allem den Familien Lebens- und Entfaltungsmöglichkeiten bot. Zu solchem befriedeten Umfeld zählten Risikominderung gegen Naturgewalten, Schutz vor wilden Tieren und die Verteidigung gegen aggressive Mitmenschen und kriegerische Übergriffe.
Es entwickelten sich arbeitsteilige Strukturen zur Förderung und Sicherung eines derartigen Umfeldes bis hin zu selbstständigen, von der Gemeinschaft getragenen Wächter- und Ordnungsdiensten. Zu den typischen Erfahrungen zählt, dass Schutz-, Wächter- und Ordnungsdienste eng verknüpft sind mit den Fragen der Regelung und Führung einer Gemeinschaft und häufig eben diese Führung beanspruchen. Führungseliten wie Häuptlinge oder Könige schälten sich heraus und fanden ihre Akzeptanz vor allem darin, wie sie der Befriedung des Lebensraums dienten. Dabei ging es vor allem um die Befriedung des je eigenen Lebensraumes. Der konnte schon mal eng werden und an die Grenzen anderer befriedeter Lebensräume stoßen. Dann war der Frieden schnell dahin.
Reflexionen über den Menschen und seinen Umgang mit den Mitmenschen kreisten lange um die Frage, ob der Mensch grundlegend ein Gemeinschaftswesen oder ein individualistisches Einzelwesen sei. Über weite Strecken der Geschichte war die Auffassung vorherrschend, der Mensch sei vor allem Teil der ihn umgebenden Gemeinschaft, seiner Familie, seines Stammes, seines Volkes. Individuelle Avancen oder gar Egozentrikansprüche seien jederzeit der Gruppe und dem Dienst am Gemeinsamen unterzuordnen. Individuelle Lebenswünsche konnten nur von denen ausgelebt werden, die einen Machtstatus in der Gemeinschaft innehatten. Dieser Status konnte durch eigene Leistungen – vor allem im Dienst von Gruppe/Familie/Volk errungen oder aus übergeordneten Sphären abgeleitet und anerkannt werden. Besonders Adel und Priesterschaft leiteten ihre Sonderstellung und die damit verbundenen Individualrechte (als Beherrschungsrechte über die Mitmenschen) aus Götterwelten und Geburtsvorrechten ab. Individualrechte waren somit Privilegien der Mächtigen.
Nicht über unsere Köpfe hinweg
„Wenn wir schon für unser Land kämpfen, dann wollen wir auch die Geschicke des Landes mitbestimmen“, forderten die Bürger der antiken Athener Polis. Einst hatten die freien Männer der Stämme sich auf offenen, gut erreichbaren Plätzen zwischen den Dörfern getroffen, um ihre Kulte zu feiern und die gemeinsamen Belange zu regeln. Viele Bauern, Handwerker oder Kaufleute lebten inzwischen als freie Bürger in ihrem von einem König gelenkten Stadtstaat. Um die Freiheit dieser Polis zu schützen und bewahren, mussten sie aber gelegentlich ihre Kampfstiefel anziehen und unter Führung ihres Königs in einen Krieg ziehen. Bereits in der noch überschaubaren Polis wollten die Herrschenden und Mächtigen sich nur ungern vom Volk in ihre Geschäfte hineinreden lassen. Ein Zurück zum Palaver auf den Marktplätzen verweigerten sie. So dauerte es knapp 200 Jahre, bis die Bürger ihren Anspruch durchsetzten und die Geschicke der Polis auf dem Marktplatz, der Agora, entschieden wurden. Wollte die Regierung Geld für ein bestimmtes Vorhaben, zum Beispiel einen Krieg, so legte sie einen Finanzplan vor und die Bürger entschieden, ob und wie sie die Mittel aufbringen wollten.
Wagen wir uns einmal vorzustellen, die europäischen Regierungen wären 2008 vor ihre Völker getreten und hätten erklärt: „Die führenden Großbanken der Welt haben sich auf kriminelle Weise verzockt und die Guthaben von Sparern und Anlegern verspekuliert. Das ist bedauerlich, doch wir müssen diese Banken retten, weil wir sie brauchen und selbst hohe Kredite bei ihnen haben. Darum bitten wir die Bürger, uns den Zugriff auf ihre Vermögen, ihre Sozial- und Alterssicherung sowie ihre Erwerbseinkünfte in noch unbekannter Höhe zu erlauben. Auch hätten wir gern Kreditvollmachten im Namen der zukünftigen Generationen.“
Wir können darüber spekulieren, ob die Bürger ihre Regenten gesteinigt, aufgeknüpft oder nur aus dem Mandat verlacht hätten. Doch wohl keine Regierung hätte die Zustimmung ihres Volkes für solche Bankenrettung erhalten. Aus „gutem Grund“ scheuen die Bankenretter und ihre Vasallen die Demokratie wie der Teufel das Weihwasser, auch wenn sie ihr Agieren hinter einer Dunstwolke scheinheiliger Schwafelei zu verbergen suchen.
Solche Volksbeschwafler bezeichnen wir heute als Demagogen. In der antiken Polis waren Demagogen noch ehrbare Leute. Sie erklärten und erläuterten den auf der Agora versammelten Bürgern die zur Entscheidung anstehenden Anliegen und Beschlussvorlagen. Erst als diese Volks-Erklärer immer häufiger ihre „Erklärungen“ an eigenen verdeckten Interessen ausrichteten, beschädigten sie ihren Ruf bis hin zur heutigen abwertenden Deutung.
Das System polisbezogener Entscheidungen auf der Agora gründete auf zwei Qualitäten, die heute eher in der politischen Literatur oder in Festreden als in der praktischen Politik Anklang finden: dem gesunden Menschenverstand sowie dem gesunden Volksempfinden. Sogar die Rechtsprechung griff auf diese Qualitäten zurück. Auf der Agora anwesende Bürger wurden mittels einer eigens entwickelten Losmaschine zum Richter für anstehende Streitfälle bestimmt. Die Ausgelosten gingen direkt vom Marktplatz zum Gericht, um das ihnen bestimmte Amt auszuüben. Nach dem Richterspruch gingen sie wieder in ihren Alltag als Handwerker, Kaufleute oder Bauern zurück. Die Polis Athen wuchs über die Stadtmauern hinaus und wurde mit Umland und Siedlerkolonien zum Staat Attika. Unter den Reformpolitikern Solon (etwa 640-560 v. Chr.) und Kleisthenes (um 570-507 v. Chr.) wurden die Dörfer (griech. Demen, Demos in der Einzahl) die unterste Verwaltungseinheit Attikas. Diese Demen als Organisationsbasis des Landes prägten den Begriff der Demokratie und haben Bestand bis ins heutige Griechenland, heißen neugriechisch allerdings Dimen/Dimos.
Vom Demos zum Dimen! Ausgerechnet am Fall Griechenland(s) erleben wir die Zerstörung der Demokratie in diktatorischer Dimension.
Mach dein Ding
„Ruft sie zusammen, wir müssen über die Dinge reden und entscheiden!“ Sie, das waren die freien Männer des Stammes. Die freien Männer wussten, wenn es um „die Dinge“ ging, dann hatten sie dort zu sein, wo das Ding stattfand. Denn das „Ding“ war die Volks- und Gerichtsversammlung des Stammes. Frauen, Kinder, Fremde oder Sklaven waren hier nicht zugelassen.
Es ist kein Zufall, sondern begründet in gemeinsamen indogermanischen Stammeskulturen, dass die Variante des nordeuropäischen Things den Beratungen auf der griechischen Agora ähnelt. Ausgrabungen an der 1996 entdeckten ostanatolischen Tempelanlage Göbekli Tepe belegen diese Stammestraditionen bereits für die Zeit um 12.000 v. Chr., lange bevor die Jäger- und Sammlerstämme in der neolithischen Revolution sesshaft wurden.
Diese als Thing bekannten altgermanischen Treffen waren Versammlungen zum Zwecke der politischen Meinungsbildung, ebenso der Rechtsprechung und dienten auch kultischen Zwecken. Das Geltungsgebiet eines Things deckte sich üblicherweise mit dem Stammesgebiet. War der Stamm zu groß, wurde das Gebiet unterteilt und jeder Teil bekam sein eigenes Ding/Thing. Ein stammesweites Thing gab es nur noch für Entscheidungen, die den gesamten Stamm angingen, zum Beispiel Entscheidungen über Krieg oder Frieden.
Der römische Geschichtsschreiber Tacitus beschreibt in seiner „Germania“, wie so ein Thing ablief. Am ersten Tag der Zusammenkunft wurden unter starkem Alkoholkonsum wichtige politische, rechtliche oder auch militärische Fragen besprochen. Beschlüsse aber wurden erst am nächsten Tag im nüchternen Zustand gefasst. Laut Tacitus hat diese Vorgehensweise den Vorteil, dass die Teilnehmer am ersten Tag leichter mit „freier Zunge“ redeten.
Demokratisch kann man diese Stammestreffen wohl nicht nennen. Einflussreiche Männer erschienen mit größtmöglichem Gefolge, um das Stimmengewicht in der Versammlung zu eigenen Gunsten zu beeinflussen. Wohl aber sind sie ein Zeugnis des Freiheitswillens und des Anspruchs auf Mitsprache und Selbstverfügung der Stammesmitglieder. Die Veranstaltungen fanden immer tagsüber, also am Tag statt. Während die Bezeichnung Thing in den nordischen Ländern in den Bezeichnungen der Parlamente und Gerichte erhalten blieb (Folketing, Storting oder Landsting) setzte sich der „Tag“ in Deutschland durch: Reichstag, Landtag, Städtetag oder Bundestag.
Die späteren römischen Machthaber waren keine Freunde der germanischen Selbstbestimmung und Selbstverfügung. Ihnen war die Gefahr zu groß, die von Versammlungen bewaffneter Männer mit einheitlich politischem Handlungswillen ausging.
Auch den Dingen gaben sie einen anderen, lateinischen Namen. „Sache des Volkes“ – res publica wurden sie bei den Römern genannt. Die Beratungen und Entscheidungen über die Sachen des Volkes nahmen allerdings die Tribunen und Senatoren wahr.
Machtbegrenzung durch Parlament - die Magna Charta
Wer Freiheit, Selbstbestimmung und Selbstverfügung nicht kennt und nicht erlebt hat, fügt sich in sein Schicksal – vielleicht murrend, doch ergeben. In der Zeit der skandinavischen Besiedlung Britanniens allerdings hatte es Freiheiten, Selbstbestimmung und Selbstverfügung gegeben. Natürlich nicht für alle, Frauen, Kinder und Sklaven waren davon ausgeschlossen. Aber es gab viele freie Bauern mit eigenem Grundbesitz und ganze Ortschaften, die keinem Herrn unterworfen waren.
Unter angelsächsischer, vor allem unter späterer normannischer Herrschaft wurden diese Rechte und Freiheiten genommen. Die freien Bauern wurden Hörige der adligen Großgrundbesitzer. Selbst diesen Baronen wurde nach und nach der Grundbesitz genommen und nur noch als Lehen vom König vergeben. Zur Sicherung und Ausweitung ihrer Besitztümer in Frankreich führten die englischen Könige immer wieder Feldzüge auf dem Kontinent, die sie sich durch ein „Schildgeld“ der Barone finanzieren ließen. Den Baronen blieb nur die Wahl, entweder direkt Geld zu zahlen oder Soldaten für die königliche Armee zu stellen. Unter König Johann, dem Bruder des Richard Löwenherz, wurde die königliche Feudalherrschaft endgültig zur Tyrannei. Immer mehr Baronen platzte der Kragen. Sie besannen sich auf alte Rechte und Privilegien und revoltierten gegen ihren König. Diese Revolte der Barone weitete sich im Frühjahr 1215 zum Bürgerkrieg aus. König Johann erkannte, dass er Zugeständnisse machen müsse, wollte er seine Macht behalten. Nach langen Verhandlungen erklärte er sich bereit, die von den rebellierenden Baronen erstellte Liste der Forderungen zu unterzeichnen. Mit dem Datum 15. Juni 1215 wurde diese 63 Forderungen umfassende Charta besiegelt.
Zum Frieden kam es dennoch nicht. Schon damals hatten Vertragsunterzeichner selten den Wunsch, den Vertrag einzuhalten. Wie heutzutage ging es wesentlich darum, „Druck aus dem Kessel zu nehmen“, um Raum für die weitere Verfolgung der eigenen Interessen zu gewinnen. Zu einer Entschärfung des Konfliktes kam es erst nach dem Tod König Johanns 1216. Dessen minderjähriger Sohn Heinrich wurde zum König gekrönt. Einer der führenden Barone, William Marshall, wurde Regent des Königreiches. Dieser erkannte die Charta grundsätzlich an. Die dort beschriebenen Regelungen zu den königlichen Forsten wurden in eine eigene Forst-Charta ausgegliedert. Zur Unterscheidung von dieser Forst- Charta erhielt das Abkommen von 1215 den Namen „Magna Charta“.
Die Barone durften nun im Großen Rat an wichtigen Entscheidungen der Regenten teilhaben. Dieser Große Rat schuf einen Präzedenzfall, als er 1225 die vom inzwischen volljährigen König Heinrich III. geforderte Steuer erst nach dessen Anerkennung der Magna Charta bewilligte. Weitere 40 Jahre dauerte es, dass die Machtkämpfe zwischen dem König und den Baronen 1264 zur Bildung des ersten direkt gewählten Parlaments führten.
Von der Magna Charta zu den Menschenrechten
Verlor die Magna Charta ab dem 14. Jahrhundert auch an Bedeutung, so hatte sie doch erhebliche Spätfolgen. Im 17. Jahrhundert huldigten die Stuart-Könige neuem Absolutismus. Das führte zu drastischen Auseinandersetzungen zwischen Krone und Parlament. Der Anwalt Sir Edward Coke (1719-1753) griff auf die Magna Charta zurück, um die Gegner des Königs nicht als Revolutionäre, sondern als Bewahrer der Traditionen darzustellen. Er deutete die Charta als Dokument englischer Freiheitsrechte um. Vor allem begründete er mit dem Artikel 39 die Begrenzung der Macht des Königs. In diesem Artikel stand: „Kein freier Mann soll verhaftet, gefangen gesetzt, seiner Güter beraubt, geächtet, verbannt oder sonst angegriffen werden; noch werden wir ihm anders etwas zufügen, oder ihn ins Gefängnis werfen lassen, als durch das gesetzliche Urteil von Seinesgleichen, oder durch das Landesgesetz.“ So wurde die Magna Charta zur Basis der Petition of Right, die Karl I. auf Druck des Parlamentes unterzeichnete.
Derselbe Anwalt Coke verfasste auch die Charta der Virginia Company, die den amerikanischen Kolonisten ihre Rechte gegenüber der englischen Krone garantierte. Nachdem William Penn (1644-1718), Gründer der Kolonie Pennsylvania (heute US-Bundesstaat) die Magna Charta erstmals in Amerika veröffentlichte, wurde sie zur Basis der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung. Im Siegel Massachusetts trägt ein Siedler in einer Hand ein Schwert, in der anderen die Magna Charta.
Weitere Spätwirkung zeigt die Magna Charta von 1215 in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948. Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) von 1950 lässt sich ebenfalls in wesentlichen Teilen auf diese Charta zurückführen.
Umbrüche in Deutschland
Der große Kaiser war tot, gestorben 814 und begraben in seiner Aachener Pfalz. Die Nachfolger taten sich schwer, das große Reich des Kaisers Karl zusammenzuhalten. Seine Enkel Lothar I., Karl II. der Kahle und Ludwig II. der Deutsche, beendeten im Jahr 843 ihren Kampf um die Macht und teilten sich die Herrschaft. Lothar erhielt den mittleren, Karl den westlichen und Ludwig den östlichen Teil des karolingischen Reiches.
Auf der Basis gemeinsamer Sprache, ähnlicher Stammesgeschichte und Kultur schälten sich nach dem Zerfall des Frankenreiches gemeinsame Interessen der verschiedenen Stämme im ostfränkischen Reich heraus. Nach dem Tod des letzten ostfränkischen Karolingers war im Jahre 911 die Wahl Konrads zum König ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem eigenständigen Reich. Diese Entwicklung fand 962 mit der Kaiserkrönung Ottos I. ihren Abschluss. Sie wird heute als Beginn des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation angesehen.
Vorbei war damit die Zeit der Stämme, der Mitsprache und Mitwirkung freier Männer an den politischen Entscheidungen. Kaiser, Könige, Bischöfe und Adel hatten die politische Macht an sich genommen. In diesem Reich stritt man sich höchstens, ob Kaiser oder Papst das letzte entscheidende Wort zu sagen hatte.
Mitsprache der Bürger
Die Bevölkerung wuchs und der wachsende Wohlstand schuf neue Bevölkerungsgruppen, die selbstbewusst auf Mitwirkung drängten. In den großen Städten fanden sich die wohlhabenden Handwerker und Kaufleute zusammen, um ihre Interessen gegenüber den herrschenden Patriziern zu vertreten. In Zünften und Gaffeln organisierten sie die innere Ordnung der jeweiligen Berufsgruppen. Ihrer gewachsenen Bedeutung entsprechend forderten sie alsbald Mitsprache und Mitentscheidungsrechte, wenn es um politische Entscheidungen der Stadt ging. Ansprüche, von denen die Patrizier jedoch nichts hielten - wer will schon seine traditionell erworbene Macht mit Aufkömmlingen teilen? Das war damals nicht anders als heute.
In der Freien Reichsstadt Ulm führten die Auseinandersetzungen zwischen Zünften und dem städtischen Patriziat zu bürgerkriegsähnlichen Unruhen, die die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts prägten. 1345 kam es zu einer ersten vorläufigen Befriedung, als durch den Kleinen Schwörbrief den Zünften erstmals entscheidende Mitspracherechte eingeräumt wurden. So richtig befriedigend war dieser Kompromiss aber wohl nicht. 1397 kam es darum zum Großen Schwörbrief, der heute als Ulmer Verfassung betrachtet wird. Nun hatten die Zünfte 30 Sitze im Rat, die Patrizier nur zehn. Den Patriziern wurde das aktive Wahlrecht verweigert. Auch die Aufgaben des Bürgermeisters wurden geregelt. Über die Erfüllung der Aufgaben musste der Bürgermeister jeweils am vorletzten Montag im Juli öffentlich vor den Einwohnern Rechenschaft ablegen. Dieser Schwörmontag mit dem Rechenschaftsbericht des Stadtoberhauptes hat sich über die Jahrhunderte bis heute erhalten. Heute ist der Schwörmontag ein Ulmer Feiertag mit Volksfestcharakter.
Weit weniger erfolgreich waren die Bürger der württembergischen Landstädte, die sich 1514 in einem Bündnis des „Gemeinen Mannes“ unter dem Aktionsnamen „Armer Konrad“ zusammenschlossen. Unterstützt von einigen Geistlichen wollten sie die vom Landesherrn Herzog Ulrich und den einflussreichen Patriziern betriebene Politik fortschreitender Entrechtung und systematischer Verarmung der kleinen Leute beenden. Mehrere Missernten und politische Umbrüche verschärften die wirtschaftliche Notlage der Unterschicht. Mit der Einführung des römischen Rechts wurden bislang tradierte, allerdings ungeschriebene Rechtsansprüche Einzelner wie der Gemeinden ausgehebelt. Die neue Rechtslage nutzten die als „Ehrbarkeit“ bezeichneten Patrizier zur Privatisierung der bisherigen Allmende, der traditionellen Gemeingüter. Endgültig platzte dem „Armen Konrad“ der Kragen, als der Herzog für seine Misswirtschaft und weiteren Kriegslüste durch einen Salto in der Steuerpolitik seine Kasse füllen wollte. Eine die Patrizier belastende Vermögenssteuer wandelte er kurzerhand in eine Verbrauchssteuer auf Fleisch, Wein und Getreide um. Die aber musste vor allem die ohnehin Not leidende städtische Unterschicht treffen.
Der landesweite Widerstand zwang den Herzog zu Zugeständnissen. Mit leeren Kassen konnte er nicht genügend Söldner zur Niederschlagung des Aufstandes mobilisieren. Also spielte er auf Zeit und lud zu Beratungen und Verhandlungen nach Tübingen ein. Auf diesem außerordentlichen Landtag kam es am 8. Juli 1514 zum Tübinger Vertrag, in dem sich Patrizier und Herzog zum jeweils eigenen Vorteil einigten und die Forderungen des „Armen Konrad“ weitgehend ignorierten. Die Landstände bekamen Mitspracherechte bei der Regierung und durften über die Staatsausgaben mitentscheiden. Allen Untertanen wurde das Grundrecht auf Freizügigkeit (freie Wahl von Wohn-und Aufenthaltsort) und ordentliche Gerichtsverhandlungen zugesichert. Dafür verpflichteten sich die Landstände, den Hauptteil der herzoglichen Schulden zu übernehmen und akzeptierten einen neuen Straftatbestand: Landfriedensbruch galt nun als Hochverrat und war mit der Todesstrafe bewehrt.
So ermöglichten die Abgeordneten dem Herzog die Niederschlagung des Aufstands. Neu bezahlbare herzogliche Truppen gingen gegen die Widerstandsgruppen vor. Über 1.700 Aufständische sollen gefangen genommen worden sein, gefoltert und drakonisch bestraft. Sie verloren ihre Ehrenrechte und wurden großteils gebrandmarkt. Gefangengenommene Rädelsführer ließ der Herzog auf dem Schorndorfer Wasen und den Marktplätzen von Stuttgart und Tübingen öffentlich und publikumswirksam köpfen.
Im Tübinger Vertrag heißt es:
„Ob sich begebe fürohin, das jemands, wer der were, ainich uflöff und embörung machen oder fürnemen würde wider die herschafft, irer fürstlichen gnaden rät, amptleut, diener, prelaten, gaistlichait, burgermaister, gericht, rat oder sunst wider die erberkait, die niderzudrücken, desglychen wölicher in ainem feldleger oder in besatzungen den houptleuten ainich frevelich ungehorsami erzögten, onch ob yemands ain geboten oder glopten friden frevelich brechen würden, an wölichem deren jetweder übeltat erfunden und usgefürt oder solichs offenlich am tag lege, der soll sein lyb und leben verwirckt haben und ime daruf sein verschulte straf ufgelegt und an ihm vollstreckt werden, es sy mit viertaylen, radbrechen, ertrencken, enthoupten, mit dem strick richten, die hend abhowen und derglychen, wie sich das alles nach grössen und gelegenhait der übeltat zu thund gebürt.“
(zitiert nach dem Original im Ständischen Archiv zu Stuttgart)
Der nun über 500 Jahre alte Tübinger Vertrag ist also keineswegs ein Dokument demokratischer Entwicklung in Deutschland, wohl aber des Anspruchs württembergischer Bürger auf Selbstverfügung.
Vom Eigensinn zum Parlament
Der erstarkte Feudalismus des europäischen Adels ließ wenig Raum für politischen Eigensinn und Selbstverfügung der Untertanen. Absoluter Vorrang der Gemeinschaftsverpflichtung galt für die abendländischen Kulturkreise bis ins hohe Mittelalter. Das gesellschaftliche Leben und die Stellung des Menschen innerhalb der Gesellschaft waren klar durchorganisiert und streng geregelt. Klar unterschiedene Stände, Zünfte, Gaffeln oder Gilden regelten bis in die Details von Kleiderordnungen hinein das gesellschaftliche Leben. Wurden Abweichungen toleriert, so waren sie doch definiert als Abweichungen von der grundsätzlich richtigen Ordnung.