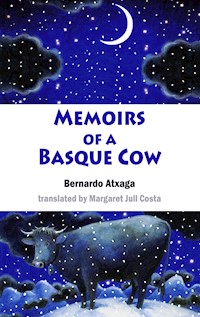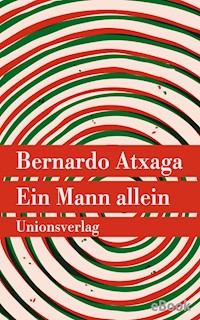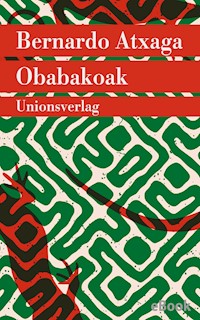
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das entlegene Dorf Obaba, irgendwo in den baskischen Bergen, folgt seinen eigenen Gesetzen. Hier leben verwirrte Herzen, tote Buchstaben und starrköpfige Hühner. Hier stapelt sich das Tomatenkonzentrat in Rosies Eckladen, kriechen Gerüchte um das Haus der Hirten und Eidechsen in unachtsame Ohren. Wer nicht aufpasst, verliert sich auf den Bergpfaden oder hinter der Tür des Nachbarn. Bernardo Atxaga zaubert ein sinnliches Labyrinth, erzählt fantastisch Reales, sucht nach dem letzten Wort und nach Geschichten ohne Ende. Mit Obabakoak erobert er dem Baskischen einen Platz in der Weltliteratur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Das Dorf Obaba in den baskischen Bergen folgt eigenen Gesetzen. Hier leben verwirrte Herzen und tote Buchstaben, kriechen Gerüchte ums Haus der Hirten und Eidechsen in unachtsame Ohren, und wer nicht aufpasst, verliert sich hinter der Tür des Nachbarn. Atxaga erobert dem Baskischen mit diesem sinnlichen Labyrinth einen Platz in der Weltliteratur.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Bernardo Atxaga (eigentlich Joseba Irazu Garmendia, *1951) studierte Wirtschaftswissenschaften. Mit Romanen, Gedichten, Liedertexten und Kinderbüchern gewann er in seiner Heimat große Popularität. Er übersetzt seine Bücher von seiner Muttersprache Baskisch selbst ins Spanische.
Zur Webseite von Bernardo Atxaga.
Giò Waeckerlin Induni, in einer italienischsprachigen Familie in Zürich aufgewachsen, war Lektorin und Übersetzerin vorwiegend aus dem Italienischen, Spanischen und Englischen.
Zur Webseite von Giò Waeckerlin Induni.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Bernardo Atxaga
Obabakoak oder Das Gänsespiel
Roman
Aus dem Spanischen von Giò Waeckerlin Induni
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die baskische Originalausgabe erschien 1988 bei Editorial Erein. Die spanische Erstausgabe erschien 1989 bei Ediciones B, S.A., Barcelona. Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 im Schönbach Verlag, Basel/Hannover.
Originaltitel: Obabakoak
© by Bernardo Atxaga 1988
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Echsen - Ivana van Keulen (Alamy Stock Foto); Labyrinth - Arsenii Samolevskyi (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-30229-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.08.2022, 10:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
OBABAKOAK ODER DAS GÄNSESPIEL
KindheitenEsteban WerfelÜber Kanonikus Lizardis BriefPost tenebras spero lucemIch ginge jeden Abend spazierenNeun Wörter zu Ehren des Dorfes VillamedianaDie erste ErinnerungDie zweite ErinnerungDie dritte ErinnerungDie vierte ErinnerungDie fünfte ErinnerungDie sechste ErinnerungDie siebte ErinnerungDie achte ErinnerungDie neunte ErinnerungDie Suche nach dem letzten WortJung und unbeschwertDer Diener des reichen Kaufmanns zu BagdadRund um das GeschichtenerzählenDayoub, der Diener des reichen Kaufmanns zu BagdadMister SmithMit ledigem Namen Laura SligoFinis coronat opusAm nächsten MorgenHans MenscherWie man in fünf Minuten eine Geschichte schreibtKlaus HahnMargarethe und Heinrich, ZwillingeIch, Jean-Baptiste HargousDie Kunst des PlagiatsIn der GletscherspalteEin kühler RheinweinSamuel Tellería UribeWei Lie Deshang Fantasia on the Marco Polo’s themeX … Y …Die FackelDie Symbolik des GänsespielsMehr über dieses Buch
Über Bernardo Atxaga
Bernardo Atxaga: Zwischen Wald und Literatur
Über Giò Waeckerlin Induni
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Bernardo Atxaga
Zum Thema Spanien
Ich möchte Joseba Urteaga, Bakartxo Arrizabalagaund Pilar Muñoa für ihre Unterstützung danken,als es darum ging, dieses Buch zu übersetzen.
BERNARDO ATXAGA
Kindheiten
Esteban Werfel
Die zum großen Teil ledergebundenen und sorgfältig in den Regalen eingeordneten Bücher von Esteban Werfel bedeckten die vier Wände des Raumes fast vollständig; es waren zehn- oder zwölftausend Bände, die zwei Leben umfassten – das seine und das seines Vaters – und überdies eine warme Einfriedung bildeten, einen schützenden Wall zwischen ihm und der Welt, wenn er sich wie an jenem Februartag zum Schreiben hinsetzte. Den Tisch, an dem er saß – ein altes Eichenmöbel, wie viele der Bücher eine Erinnerung an seinen Vater –, hatte er vor vielen Jahren, als er noch ein junger Mann war, von Obaba hierherbringen lassen.
Der Wall aus Papier, aus Seiten, aus Worten ließ jedoch eine Öffnung frei, ein Fenster, durch das Esteban Werfel den Himmel sehen konnte, während er schrieb, die Trauerweiden, die kleine Hütte für die Schwäne im Weiher des Stadtparkes. Das Fenster bahnte sich einen Weg durch die Dunkelheit der Bücher, ohne seine Einsamkeit zu stören, und milderte diese andere Dunkelheit, die oft Trugbilder weckt im Herzen der Menschen, die nicht gelernt haben, allein zu sein.
Esteban Werfel betrachtete einen Moment lang den wolkenbedeckten, weißlich grauen Februarhimmel. Dann wandte er den Blick ab, zog eine Schublade seines Schreibtisches auf und entnahm ihr ein Heft mit einem Pappumschlag, auf dem die Zahl Zwölf stand und das bis in die kleinste Einzelheit den anderen, bereits voll beschriebenen Heften mit seinen Tagebuchaufzeichnungen entsprach.
Sie waren hübsch, die Hefte mit dem Pappumschlag. Sie gefielen ihm. Oft dachte er, er missbrauche sie, dachte, die Geschichten, die Gedanken, die er ihnen anvertraute, würden das glückliche Los zunichtemachen, das einem Heft – den Heften mit Pappumschlag vor allem – beschieden war.
Vielleicht war es übertrieben, sich Gedanken über so etwas wie ein Heft zu machen. Wohl möglich. Doch es war stärker als er, und besonders dann, wenn er sich – wie an jenem Tag – anschickte, ein neues aufzuschlagen. Warum dachte er immer an Dinge, an die er eigentlich nicht denken mochte? Sein Vater hatte einmal zu ihm gesagt: Wenn du Flausen im Kopf hast, beunruhigt mich das nicht; was mich hingegen beunruhigt, ist, dass es immer die gleichen Flausen sind. Genau das war es, immer die gleichen Flausen, doch den Grund dafür hatte er nie herausbekommen.
Wie auch immer: Der Drang, der seine immer gleichen Flausen beherrschte, war unbezwingbar, und Esteban Werfel konnte der Versuchung nicht widerstehen, zum Regal hinüberzublicken, wo er die elf bereits beschriebenen Hefte aufbewahrte. Dort standen sie, halb versteckt zwischen geografischen Werken, die Seiten, die Zeugnis von seinem Leben ablegten, die die glücklichen Momente, die bedeutendsten Ereignisse seines Lebens festhielten. Doch es handelte sich keineswegs um einen Schatz. Nein, es stand nichts Ruhmvolles darin. Wenn er sie zur Hand nahm, kam es ihm vor, als blättere er in aschenbeflecktem Papier; er schämte sich und stellte fest, dass in ihm der Wunsch, zu schlafen und zu vergessen, immer stärker wurde.
»Hefte voller toter Buchstaben«, flüsterte er vor sich hin. Auch dieser Gedanke war nicht neu.
Doch er durfte sich nicht gehen lassen, durfte sich von seinen Gedanken nicht von der Aufgabe abbringen lassen, derentwegen er sich an den Tisch gesetzt hatte, durfte sich nicht – wie schon so oft – von trauriger Erinnerung zu trauriger Erinnerung immer mehr in die Tiefe ziehen lassen, bis zu dem Land, das er seit langer Zeit – seit der Zeit, als er Student in Geografie gewesen war – sein Kap der Einsamkeit nannte. Er war bereits ein reifer Mann, verstand es, gegen sich selbst anzukämpfen. Und er würde kämpfen, würde das noch unbeschriebene Heft füllen, das vor ihm auf dem Tisch lag.
Esteban Werfel nahm seine Feder – sie war aus Holz, und er benützte sie nur für seine Tagebucheintragungen – und tauchte sie ins Tintenfass.
17. Februar 1958, schrieb er. Seine Handschrift war zierlich und gestochen scharf. Draußen vor dem Fenster war der Himmel ganz grau geworden, und ein feiner Nieselregen verdüsterte das Efeu, das die Hütte der Schwäne vollständig überwucherte. Er seufzte. Er hätte sich ein anderes Wetter gewünscht. Er mochte es nicht, wenn der Park ausgestorben war. Er seufzte nochmals. Dann netzte er die Feder und neigte sich über das Heft.
Ich bin aus Hamburg zurückgekehrt – begann er seine Eintragung – mit dem Vorsatz, einen Bericht über mein Leben zu schreiben. Doch ich werde nicht in chronologischer und umfassender Art und Weise vorgehen, wie jemand es tun könnte – und vielleicht mit gutem Grund sogar –, der sich selbst als Spiegel einer Epoche oder einer Gesellschaft sieht. Das trifft für mich nicht zu, und so werde ich anders vorgehen. Ich werde mich darauf beschränken zu erzählen, was eines Nachmittags vor langer Zeit geschah – als ich vierzehn Jahre alt war, um genau zu sein –, und von den einschneidenden Folgen, die jener Nachmittag für mein Leben haben sollte. Für einen Mann, der bereits im Herbst seines Lebens steht, hat in ein paar Stunden nicht viel Platz, doch es ist das Einzige, was ich zu erzählen habe, das Einzige, was die Mühe lohnt. Und vielleicht ist es gar nicht so wenig. Letztlich bin ich ein Mann, der sich immer der Lehrtätigkeit gewidmet hat, und es ist allgemein bekannt, dass das Katheder in den Hörsälen eher der Konstipation als dem Abenteuer förderlich ist.
Er richtete sich im Stuhl auf und wartete, bis die Tinte trocken war. Der Tag war immer noch grau, doch der Regen war jetzt viel stärker als noch vor ein paar Minuten, und das dumpfe Geräusch der Tropfen auf dem Gras drang deutlich bis ins Zimmer. Auch im Weiher rührte sich etwas: Die Schwäne waren aus ihrer Hütte herausgekommen und schlugen aufgeregt mit den Flügeln. Er hatte die Schwäne noch nie in diesem Zustand gesehen. Ergötzten sie sich am Regen? Oder waren sie vergnügt, weil ihnen heute niemand zusah? Er wusste es nicht; doch mit unnützen Fragen Zeit zu verlieren, lohnte sich ebenso wenig. Er tat wohl besser daran, das soeben Geschriebene durchzulesen.
Die ersten Zeilen machten ihm immer Mühe. Die Wörter weigerten sich, getreulich das wiederzugeben, was man von ihnen verlangte – als ob sie träge wären oder ihnen die Kraft dazu fehlte. Sein Vater pflegte zu sagen: Unsere Gedanken sind Sand; wenn wir versuchen, eine Handvoll aufzulesen, rinnt uns der größte Teil der Sandkörner durch die Finger. Ja, so war es. Er hatte sich vorgenommen, einen Lebensbericht zu schreiben, wo es doch zutreffender gewesen wäre, von Betrachtungen zu sprechen, denn letztlich war es genau das, was er tun würde: von dem ausgehen, was eines Nachmittags in seiner Jugend geschehen war, und es unter allen Aspekten genau betrachten. Doch das war nicht der einzige Schritt in die falsche Richtung, es gab noch andere.
Er hätte das Geschriebene durchstreichen und von Neuem beginnen können, aber das ging gegen sein Prinzip: Er mochte es, wenn die Seiten makellos waren, sowohl die seinen als auch die der anderen, und er war stolz darauf, dass ihm seine Studenten wegen seiner Pingeligkeit den Spitznamen einer bekannten Seifenmarke gegeben hatten. Und im Übrigen – warum sich den Kopf über die ersten Zeilen zerbrechen? Er würde auch in einem zweiten Anlauf Fehler machen. Fehler waren unvermeidlich. Also konnte er ebenso gut weiterfahren, präzisieren, nach und nach den ungeschickten Anfang korrigieren.
Er blickte wieder in den Park hinaus. Der Teich lag verlassen da. Die Schwäne hatten sich in ihre Hütte geflüchtet. Nein, offensichtlich behagte der Februarregen auch ihnen nicht.
Wie auch immer – fuhr er mit Schreiben fort –, der Anspruch, die besonderen Augenblicke unseres Lebens einzufangen, kann ein großer Irrtum sein. Vielleicht lässt sich das Leben nur in seiner Gesamtheit beurteilen, in extenso, und nicht bruchstückweise, nicht dadurch, dass man einen Tag erfasst und einen anderen weglässt, nicht dadurch, dass man die Jahre auseinandernimmt wie die Teile eines Puzzles, um schließlich festzustellen, dass dieses sehr gut und jenes sehr schlecht war. Denn alles, was lebt, ist wie ein Fluss. Ohne Unterbrechungen, ohne Rast.
Obwohl das eine Tatsache ist, so lässt sich dennoch die sozusagen gegenteilige Neigung unseres Erinnerungsvermögens nicht leugnen. Wie jeder gute Zeuge neigt die Erinnerung zum Konkreten, neigt dazu zu selektionieren. Sagen wir einmal – um einen Vergleich zu nehmen –, sie geht wie ein Auge vor. Aber nie, wie es ein Buchhalter tun würde, der es gewohnt ist, in Bestandsaufnahmen zu denken.
Zum Beispiel kann ich jetzt im Park die Hütte der Schwäne sehen; sie ist vollständig mit Efeu überwuchert, der an sich schon düster ist, doch an Regentagen wie heute wirkt er noch viel düsterer. Ich sehe sie, doch streng genommen sehe ich sie überhaupt nicht. Jedes Mal, wenn ich aufschaue, gleitet mein Blick über das eintönige Grün oder Schwarz der Blätter, und er sucht, bis er den rötlichen Fleck an einer Ecke des Daches entdeckt. Ich weiß nicht einmal, was es ist. Vielleicht ist es ein Fetzen Papier … oder eine Primel, die sich zum Knospen diese Stelle ausgesucht hat, oder ein Ziegel, der zwischen dem Efeu hindurchleuchtet. Wie auch immer: Meinen Augen ist das gleichgültig. Sie fliehen die Dunkelheit, suchen immer wieder diesen Lichtfleck.
Esteban Werfel richtete den Blick auf den roten Fleck. Doch es brachte ihn nicht weiter: Es konnte sich ebenso gut um eine Primel wie um einen Fetzen Papier handeln. Letztlich war dieses Detail unwesentlich. Wesentlicher war das, was er soeben über das Erinnerungsvermögen geschrieben hatte: Dass die Erinnerung am Konkreten Gefallen findet, war unpräzise. Es war keine Frage des Geschmacks, sondern der Notwendigkeit.
Das Auge geht auf diese Weise vor – fuhr er fort – und die Erinnerung selbst – wenn meine Überlegung richtig ist – ebenso. Sie vergisst die öden Tage, sucht hingegen das Licht, sucht die denkwürdigen, die intensiv erlebten Tage; sucht, wie in meinem Fall, einen weit zurückliegenden Nachmittag in meinem Leben.
Doch genug damit. Es ist Zeit, dass ich mit dem eigentlichen Bericht beginne.
Nachdem er den Schlussstrich unter die erste Seite seines Heftes gezogen hatte, fühlte sich Esteban Werfel erleichtert. Das hätte er geschafft: Er hatte in der Einführung das umrissen, was er erzählen wollte. Er wusste selbst nicht genau, warum er so vorging, so umständlich und mit vielen Pausen, doch das war seit je ein ausgeprägter Wesenszug von ihm. Er schrieb oder sprach nie rundheraus, er wandte sich nie direkt an seine Umgebung. Nach so vielen Jahren hatte er sich mit diesem Charakterfehler abgefunden – mit seiner Schüchternheit, seiner Feigheit. Trotzdem: Die aus ebendiesem Grund verpassten Gelegenheiten schmerzten ihn. In seinem Leben war alles Schweigen, Gleichgültigkeit, Zurückgezogenheit gewesen.
Aber er schweifte schon wieder ab. Jetzt ging es nicht darum, wie er gelebt hatte, sondern um seine Art zu schreiben, und ob er abschweifte oder nicht, war nicht von Bedeutung. Niemand würde je sein Tagebuch lesen. Sosehr er auch manchmal versuchte, sich in seiner Fantasie jemanden vorzustellen, der in seinen Heften blätterte – nach seinem Tode, am gleichen Tisch –, nein, er glaubte nicht ernsthaft daran. Nein, es würde keinen Leser geben. Sich so viele Gedanken über den Stil zu machen, kam ihm ein bisschen lächerlich vor.
Während er die Feder ins Tintenfass tauchte, schaute er in den Park hinaus. Ohne die üblichen Spaziergänger wirkte die Umgebung des Weihers einsamer denn je. Der Blutweiderich, der zwischen dem Gras gesprossen war, kräuselte sich über dem Kies. Er wandte sich wieder seinem Heft zu.
Hic incipit – hier beginnt die Geschichte jenes Nachmittags, an dem man mich zum ersten Mal in meinem Leben in die Kirche mitnahm. Ich war damals vierzehn Jahre alt und lebte mit meinem Vater in einem Ort namens Obaba.
Es war ein Sonntag, und ich war mit ein paar Schulkameraden verabredet; wir wollten zusammen ins Kino gehen, das man ungefähr fünf Kilometer von Obaba entfernt in der Nähe der Eisenbahnlinie gebaut hatte. Doch meine Kameraden brachen zum ersten Mal die Regeln, die unser gegenseitiges Verhalten bestimmten; sie standen lange vor der vereinbarten Zeit vor der Tür, und kaum hatte ich ihnen aufgemacht, überfielen sie mich mit einer Frage, die ich am wenigsten hätte erwarten können.
»Bitte«, sagten sie zu mir, »begleite uns in die Kirche, komm mit uns, um die Vesper zu singen. Bitte den Herrn Ingenieur, er soll dich mit uns gehen lassen, sag ihm, dass man nicht gläubig sein muss, um die Vesper zu singen.«
Das war ein ganz ungewöhnliches Vorgehen. Ein geradezu kühnes, möchte ich sagen; das Wort kühn ist in diesem Zusammenhang durchaus angemessen, denn Leute zu Hause besuchen – insofern man darunter versteht, eine fremde Wohnung von innen zu sehen – galt in Obaba als Ungezogenheit, als ebenso unschicklich, wie wenn man sich nach einer Person umdreht, die sich auszieht. Hinzu kam, dass mein Vater Ausländer war, ein Fremder, ein Feind, und alle Welt wusste, wie sehr er die Kirche und die Religion hasste.
Aus der Rückblende besehen, hege ich keinerlei Zweifel mehr daran, dass es der Kanonikus von Obaba gewesen sein musste – ein Mann Loyolas –, der sie zu diesem Vorschlag ermutigt hatte. Von seinem Standpunkt aus war ich eine Seele in Gefahr; ein Kind, das ohne Mutter – sie war bei meiner Geburt gestorben – der Willkür eines Ketzers ausgeliefert war, eines Mannes, der nicht zögerte, seinen Sohn mit in den Abgrund zu ziehen, in dem er selbst lebte. Der Kanonikus hatte sich wohl gedacht, es gebe keine andere Möglichkeit, um mich auf seine Seite zu ziehen, als die Freundschaft zu nutzen, die mich mit meinen Schulkameraden verband.
Die Feindschaft zwischen dem Kanonikus und meinem Vater war – um es so auszudrücken – nicht ausschließlich intellektueller Art. Sie war nicht nur auf die kirchenfeindliche Haltung des Herrn Ingenieur Werfel zurückzuführen, der die Leitung der Minen von Obaba übernommen hatte. Es gab da noch etwas anderes. Und dieses »etwas anderes« war mein Vorhandensein. Um es so auszudrücken, wie ich es einst von meinem Klassenlehrer gehört hatte: Ich war nicht die legitime Frucht einer Ehe. Und ich war es aus dem ganz einfachen Grund nicht, weil meine Eltern sich aus freiem Willen und ohne den Segen der Kirche zusammengetan hatten. Etwas, was zu jener Zeit und in jenem Ort untolerierbar war. Doch das ist eine andere Geschichte. Sie gehört nicht in dieses Heft.
Der Park war nach wie vor menschenleer, und trotz des nahenden Frühlings wirkten die Bäume wie erschöpft und leblos. Auch die Schwäne ließen sich nicht blicken.
Er wandte den Blick vom Fenster ab und überlas das Geschriebene. Nein, die Geschichte seiner Eltern gehörte nicht in dieses Heft. Vielleicht ins nächste, ins dreizehnte. Es würde vor allem die Geschichte einer jungen Frau sein, die beschließt, mit einem Fremden zusammenzuleben, und deswegen verleugnet und verfemt wird. »Deine Mutter ging mit jedem ins Bett. Deine Mutter trug keine Unterwäsche. Deine Mutter musste jung an all dem Schlechten sterben, das sie getan hat.«
Die Anspielungen, die er in der Schule von Obaba während der Pause gehört hatte, schmerzten ihn immer noch. Er wusste nicht, ob er es je schreiben würde, das dreizehnte Heft; wenn ja, so würde es sehr schmerzlich sein. Wie auch immer: Das war für später. Was er jetzt festhalten musste, war die Geschichte, die er von seiner Reise nach Hamburg zurückgebracht hatte.
Esteban Werfel beugte sich über das Heft. Der unerwartete Besuch seiner Schulkameraden beschäftigte erneut seine Fantasie.
Als sie sahen, wie verblüfft ich über ihre Bitte war, redeten sie eindringlich auf mich ein, ohne den Kanonikus auch nur mit einem Wort zu erwähnen. Ihre Argumente waren ziemlich fadenscheinig: Sie meinten, es sei doch unsinnig, dass wir sonntags jeweils getrennte Wege gingen. Das führe einzig dazu, dass wir kostbare Zeit verlören, dass sie manchmal zehn, fünfzehn Minuten früher aus der Kirche kämen, wertvolle Minuten, um nicht zu spät ins Kino zu kommen, die aber schließlich nie genutzt werden könnten – meinetwegen natürlich –, weil ich ihr Freund sei und ihnen nichts anderes übrig bleibe, als auf mich zu warten.
»Wenn wir ankommen, hat der Film immer schon begonnen«, fasste einer zusammen, »und fünf Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen, um nur die Hälfte zu sehen, ist doch Unsinn. Es ist viel besser, wenn wir alle zusammen hingehen.«
Wie ich bereits gesagt habe: Das Argument war ziemlich fadenscheinig, denn normalerweise war es so, dass sich die Andacht in die Länge zog, und nicht umgekehrt. Ich widersprach ihnen natürlich nicht. Im Grunde wünschte ich mir, die Kirche zu betreten. Und nicht nur, weil es für mich ein verbotener und daher so verlockender Ort war, sondern ebenso sehr, weil ich mich danach sehnte, ein normaler Junge zu sein – ein Junge wie alle anderen. Abgesehen von meinem Vater, war ich der einzige Mensch in Obaba, der jenes Gebäude noch nie betreten hatte, und ich litt natürlich darunter – ich war damals erst vierzehn Jahre alt –, dass die Leute mit dem Finger auf mich zeigten.
Ihr Vorschlag kam mir daher sehr gelegen. Ich widersprach ihnen nicht und beschränkte mich darauf, sie zur Bibliothek zu begleiten. Dort hielt sich mein Vater auf. Ihn mussten sie um Erlaubnis fragen. Nein, ich getraute mich nicht, es war besser, wenn sie es taten. Ich glaubte keinen Moment daran, dass er einverstanden sein werde. Ich dachte, er werde sie schimpfend wegschicken, er werde – ausgerechnet an jenem Sonntag – nicht entgegen seinen Prinzipien handeln, die er sein Leben lang verfochten hatte.
»Wenn er gehen will, so soll er«, das war alles, was er meinen Kameraden antwortete. Zuerst war ich überrascht, dann erschrocken; es war, als würden plötzlich sämtliche Fensterscheiben in die Brüche gehen. Warum sagte er Ja? Ich hatte es mir nicht einmal vorzustellen gewagt.
Ein Schwan schnatterte wütend vor der Hütte; er schien über das Wetter zu schimpfen. Der Regen ließ nicht nach. Er drückte das Gras nieder, und es bildeten sich tiefe Lachen. Bald würde der Park sich in eine einzige Pfütze verwandelt haben.
Esteban Werfel verschränkte die Hände über dem Heft. Nein, mit vierzehn hatte er seinen Vater nicht verstehen können, denn zu jener Zeit sah er ihn noch nicht mit seinen eigenen Augen, sondern mit den Augen der anderen; mit den Augen jener, die – wie er später feststellte – seine Feinde waren. In Obaba hieß es, der Herr Ingenieur Werfel sei ein hochmütiger, ungeselliger Mensch. Und so dachte auch er. Es hieß – ein kleines Mädchen, das mit ihm auf dem Platz spielte, erzählte es ihm –, er sei grausam und bestrafe die Bergwerksarbeiter mit der Peitsche, und er, Esteban, hatte gelächelt und zustimmend mit dem Kopf genickt. Denn in Wirklichkeit war es so, dass er jenes Bild akzeptierte, weil ihm ein anderes fehlte, irgendeines. Wer war sein Vater? Und was war er sonst noch, sein Vater? Und darüber hinaus? Und darüber hinaus nichts. Gut, ja, ein Bergbauingenieur.
Doch jene Zeit war vorbei. Er war kein unverständiger Heranwachsender mehr, sondern ein reifer Mann. Er glaubte heute zu wissen, warum der Herr Ingenieur die Bitte seiner Kameraden nicht abgeschlagen hatte.
»Aus Müdigkeit«, seufzte er. Der Regen tat ihm plötzlich gut. Er half ihm, sich zu erinnern.
In der Tat, der Herr Ingenieur Werfel war müde, bereute es, seine Vaterstadt Hamburg verlassen zu haben, um an einen Ort zu ziehen, wo seine Vorstellungen als lächerlich empfunden wurden. In der ersten Zeit träumte er davon zurückzukehren. »Wir werden zurückkehren, Esteban, und du wirst an der Universität studieren, an der ich studiert habe.« Diesen Satz hatte er als Kind so oft gehört.
Doch schon bald lösten sich die schlechten Nachrichten ab. Einmal war es die Mine, die geschlossen wurde; ein anderes Mal die Börsenpapiere, die an Wert verloren und ihn um sein Vermögen brachten; ein anderes Mal wiederum war es der Brief von Theodor Steiner, seinem besten Freund, der ihm mitteilte, dass die Vereinigung, der sie beide angehörten – der Eichendorff-Bund –, in Deutschland verboten worden war, dass seine Ideale verfolgt wurden, in dem Land, wo er geboren worden war.
Zu jenem Zeitpunkt, als Esteban vierzehn war, hatte er bereits aufgegeben. Er würde in Obaba sterben, würde nie mehr nach Deutschland zurückkehren. Sein Sohn würde nicht an einer deutschen Universität studieren. Es war daher verständlich, dass er keine Kraft mehr hatte, für die Erziehung seines Sohnes zu kämpfen. Wenn er gehen will, so soll er gehen. Was spielte das noch für eine Rolle: Die Schlacht war verloren.
Der Schwan vor der Hütte begann wieder, aufgeregt zu schnattern, und alle andern im Innern machten es ihm nach. Das Geschrei schreckte ihn aus seinen Erinnerungen auf.
»Geben sie denn überhaupt keine Ruhe?«, rief er gereizt.
Warum war er denn so hochmütig?, fragte er sich. Er wollte den Faden nicht verlieren, der ihn mit seinem Vater verband.
Wenn er etwas demütiger gewesen wäre, der Herr Ingenieur, hätte er sich mit dem Leben in Obaba besser abgefunden. Und wäre er etwas intelligenter gewesen, ebenfalls. Letzten Endes: War nicht die Intelligenz die Fähigkeit, sich jeder Situation anzupassen? Wer lernt, sich anzupassen, steigt nie in die Höllen hinab. Im Gegenteil: Er erlangt das Glück. Was hatten seinen Eltern die Bücher, die Lektüre, die Ideale genutzt? Zu ihrem Ruin hatten sie geführt. »Nur die Feiglinge passen sich dem Leben an«, pflegte sein Vater zu sagen. Er war damit nicht einverstanden, nein. Und er war ebenso wenig mit der alten Maxime einverstanden, die Wissen mit Leiden verbindet, die besagt, dass ein Mensch desto mehr leidet, je mehr er weiß. Er hatte es seinen Studenten so oft wiederholt: Diese negative Folgerung konnte man sich nur auf der untersten Stufe des Wissens leisten. Doch je höher man klomm, desto unausweichlicher war der Zwang, über das Leiden zu triumphieren.
Die Schwäne schienen sich beruhigt zu haben. Esteban Werfel tauchte die Feder ins Tintenfass und bedeckte mit seiner gestochen scharfen Handschrift die obere Hälfte der neuen Seite. Der Moment war gekommen, seine Betrachtungen dem Heft einzuverleiben.
Sogar in den schwierigsten Situationen gibt es Momente, wo es erstrebenswert und lustvoll ist, den Kampf aufzugeben. Ein Schiffbrüchiger zum Beispiel versöhnt sich schließlich immer mit dem Meer – auch jener, der bis zur Erschöpfung versucht hat, sein Boot zu retten, der die ganze Nacht unter dem Sternenhimmel und von Fischen umgeben in totaler Einsamkeit versucht hat, den Wellen zu trotzen. Egal, was er erlebt hat und wie sehr er am Leben hängt: Das Ende ist immer sanft. Er sieht ein, dass er nicht mehr kann, dass keine Hilfe naht, dass nirgends Land in Sicht ist; und schließlich ergibt er sich, ruht sich aus, gibt sich dem Meer hin wie ein Kind, das nur noch schlafen will.
Doch mein Vater war zu hochmütig. Er hatte Schiffbruch erlitten, ja, und es blieb ihm nichts anderes übrig, als zu Kreuz zu kriechen; doch er ergab sich nicht, er sehnte sich nicht nach der letzten Wohltat des Versagens. Er antwortete schroff: »Wenn er gehen will, so soll er gehen«, und schloss sich in seiner Bibliothek ein, dem einzigen Ort in Obaba, wo er sich wohlfühlte. Als ich anklopfte, um ihn um das Geld für das Kino zu bitten, antwortete er nicht. Er beschränkte sich darauf, eine Münze unter der Tür hindurchzuschieben. Ich weiß nicht … heute schäme ich mich über die Freude, die ich in jenem Moment empfand.
Ich steckte das Geld ein, und die ganze Schar setzte sich in Bewegung; wir schubsten uns gegenseitig wie jeweils, wenn uns der Lehrer in die Pause entließ. Dann nahmen wir, das Fahrrad an der Lenkstange vor uns herschiebend, die steile Straße in Angriff, die man in Obaba die Straße der Domherren nannte.
Es war ein unfreundlicher Frühlingstag, mit ständigen Regenschauern und Windböen, und das Wasser trat über den Rand des Straßengrabens. Dort, wo es talwärts floss, bedeckten die von der Strömung mitgeschwemmten Apfelblüten die Erde wie ein weißer Teppich, den wir achtlos mit den Füßen zertraten.
Wir schritten munter voran, schoben unsere Fahrräder, die, wie Andrés, einer meiner Kameraden, bemerkte, bergaufwärts schwerer waren. Zuoberst auf dem Hügel zeichnete sich der spitze Turm der Kirche ab.
Wir waren fröhlicher Dinge, lachten über jede Kleinigkeit und verglichen scherzend den unterschiedlichen Klang unserer Fahrradklingeln. »Freust du dich, Esteban?« Und ich antwortete, ja, es sei ein Erlebnis für mich, ich sei sehr neugierig. »Und aufgeregt? Bist du nicht aufgeregt?« Und ich sagte, nein, ich sei nicht aufgeregt. Doch ob ich es war, je näher der Augenblick rückte. Bald würde ich auf der anderen Seite stehen, wie mein Vater gesagt hätte.
Kurz darauf betrat ich zum ersten Mal die Kirche.
Das Tor war sehr groß und schwer, und ich musste mich mit ganzer Kraft dagegenstemmen, um es aufzustoßen.
»Bevor du hineingehst, musst du dich bekreuzigen«, sagte Andrés zu mir. Ich schaute ihn ratlos an. So netzte er meine Finger mit den seinen und führte meine Hand.
»Wie dunkel es hier ist«, rief ich aus, kaum hatte ich die Kirche betreten.
Der Kontrast zwischen dem Licht draußen und dem Halbdunkel im Innern blendete mich. Ich erkannte nichts, nicht einmal das Mittelschiff, das sich vor mir öffnete.
»Sprich nicht so laut«, baten mich meine Kameraden, während sie vorausgingen.
Weit vorn, dort, wo das Mittelschiff aufhörte, flackerte eine große Kerze. Es war der einzige Lichtpunkt im ganzen Raum. Ich ging ein paar Schritte, blieb dann aber wieder stehen. Ich wusste nicht, in welche Richtung gehen, und meine Kameraden schienen verschwunden.
Meine Augen starrten in die Flamme am anderen Ende des Mittelschiffes, doch nach und nach sah ich etwas mehr von meiner Umgebung. Ich stellte fest, dass die Glasfenster blau waren, nahm den goldenen Widerschein wahr, der von einer Säule neben der großen Kerze ausging. Dennoch war ich wie gebannt.
»Brauchst keine Angst zu haben, Esteban. Ich bin es«, hörte ich jemanden hinter mir sagen; ich zuckte trotz der Ermahnung zusammen.
Noch bevor ich Zeit hatte, mich zu fassen, legte sich ein langer, knochiger Arm um meinen Hals. Es war der Kanonikus.
»Komm, Esteban. Brauchst keine Angst zu haben«, wiederholte er und näherte sein Gesicht dem meinen.
Der Geruch, den seine Kleider ausströmten, befremdete mich.
»Die Flamme dieser Kerze, Esteban, geht nie aus«, flüsterte er mir zu und zeigte mit der freien Hand nach vorn. »Wenn sie heruntergebrannt ist und wir eine neue anzünden müssen, so tun wir das immer mit dem Feuer der vorangehenden. Denk darüber nach, was das bedeutet, Esteban! Was meinst du, was das bedeutet?«
Ich war zu sehr erschrocken, um denken zu können, und ich fühlte mich unbehaglich, wenn der Geistliche meinen Namen aussprach. Ich blieb stumm.
»Das bedeutet«, erklärte er mir, »dass dieses Licht, das wir jetzt vor uns sehen, das gleiche ist, das unsere Großeltern gesehen haben und ebenso die Großeltern unserer Großeltern; es ist das gleiche Licht, das unseren Vorfahren leuchtete. Seit hundert Jahren verbindet dieses Haus uns alle, uns, die wir heute leben, und jene, die früher gelebt haben. Das ist die Kirche, Esteban, eine Gemeinschaft außerhalb der Zeit.«
Unnötig zu erwähnen, dass dieses Argument für mich nicht zutraf. Die Kirche verband nicht nur, sie trennte auch: Meine Anwesenheit an jenem Ort war das beste Beispiel dafür. Ich widersprach natürlich nicht. In Wirklichkeit fühlte ich mich gedemütigt, als ob mein Ausschluss aus jener Gemeinschaft ein Fehler oder ein Makel sei. Ich war mit kaltem Schweiß bedeckt.
Lächelnd bedeutete mir der Priester, die Andacht beginne erst in ein paar Minuten, ich solle die Gelegenheit nutzen und den Altar und die ganze Kirche besichtigen. Und er ließ mich stehen und entfernte sich in Richtung einer Seitentür, die zur Orgelempore hinaufführte. Ich hörte das Rascheln seiner Soutane noch, als er bereits meinem Blick entschwunden war.
Oft glauben wir, dass die Dinge an sich groß oder an sich klein sind, und wir geben uns nicht Rechenschaft darüber, dass das, was wir Größe nennen, nur das Verhältnis zwischen den Dingen meint. Doch genau darum geht es, um ein Verhältnis, daher kann ich heute behaupten, dass ich – im wahrsten Sinn des Wortes – seither nie mehr ein größeres Gebäude als die Kirche von Obaba gesehen habe. Sie war zehnmal größer als die Schule, tausendmal größer als unser Haus. Hinzu kam, dass das Dämmerlicht die Grenzen verwischte und die Wände, die Säulen, die Stuckaturen und das Kreuzgewölbe weit wegrückte. Alles schien viel größer, als es in Wirklichkeit war. In einem der bebilderten Bücher, das ich damals las, wurden die Abenteuer einer Expedition geschildert, die in einer Berghöhle eingeschlossen war. Alles um mich herum erinnerte mich an jene Höhle, aber ich spürte auch die Enge, die mich wie die Helden in jener Geschichte zu ersticken drohte. Ich ging das Mittelschiff entlang nach vorn, doch ich hatte das Gefühl zu ersticken, bevor ich die Flamme auf dem Altar erreicht haben würde. Dann sah ich, wie eine schwarz gekleidete Alte hinter dem Altar auftauchte und einen Hebel betätigte. Plötzlich war die ganze Kirche hell erleuchtet.
Dieser Übergang tat mir gut, und ich atmete freier. Es ist keine Berghöhle, dachte ich erleichtert. Es ist eher ein Theater, eines wie jene, die mein Vater in Hamburg besucht hatte, ein Gebäude, in dem Opern aufgeführt werden.
Die meisten Erinnerungen meines Vaters drehten sich um das Theater, und ich kannte die Handlungen und Szenarien aller Werke, die er in der Oper an der Buschstraße oder im Schauspielhaus gesehen hatte; er hatte mir auch viele Geschichten über Schauspieler oder Schauspielerinnen aus jener Zeit erzählt. Der Vergleich zwischen dem, was ich mir in den Gesprächen mit meinem Vater vorgestellt hatte, und dem, was ich nun sah, drängte sich auf. Ja, die Kirche war ein Theater. Mit einer großen Bühne in der Mitte, mit Bildern von bärtigen Männern, mit Stühlen und Bänken für das Publikum. Und alles war golden, alles glänzte.
Ein tiefer, vibrierender Orgelton erfüllte die Kirche, und als ich den Kopf wandte und zur Empore hinaufschaute, sah ich ungefähr zwanzig in ihren Betstühlen kniende Frauen. Sie bewegten die Lippen und starrten mich an.
Erschrocken über die auf mir ruhenden Blicke rannte ich auf die Tür zu, durch die der Kanonikus verschwunden war. Eine Sekunde später eilte ich, zwei Stufen auf einmal nehmend, die Treppe zur Empore hinauf, wo meine Kameraden waren.
Erschöpft legte Esteban Werfel die Feder auf den Tisch und schaute zum Fenster hinauf, doch ohne etwas Bestimmtes zu sehen, und auch das Geschnatter der Schwäne im Teich schien er nicht zu hören. Eine seiner Flausen war ihm soeben durch den Kopf gegangen, hatte ihn unterbrochen, hatte ihn gezwungen, sich Gedanken über den Sinn des vor ihm liegenden zwölften Heftes zu machen. Wozu die Erinnerung? War es nicht besser, die Vergangenheit ruhen zu lassen, ohne darin herumzuwühlen?
Nur die Jungen lieben die Erinnerung, dachte er. Doch wenn sie von der Vergangenheit sprechen, sprechen sie in Wirklichkeit von der Zukunft, von den Ängsten und Wünschen, die sie in Bezug auf die Zukunft hegen, von dem, was sie vom Leben erwarten. Sie tun es aber nie in der Einsamkeit. Er konnte sich seine Gier, Erinnerungen heraufzubeschwören, nicht erklären. Wer weiß, vielleicht war es ein böses Omen; ein Zeichen, dass alles endgültig vorbei war, dass ihm nichts mehr am Leben lag.
Er schüttelte den Kopf, als wolle er die Gedanken verscheuchen, und wandte seine Aufmerksamkeit dem zu, was draußen vor dem Fenster geschah. Auf der einen Seite der Hütte stand ein Mann, der offensichtlich Schutz vor dem Regen suchte, und warf Brotkrumen in den Teich; die Schwäne schwammen von einem Ende zum anderen und schnatterten wie wild. Die Spaziergänger sind heute ausgeblieben, sie haben bestimmt Hunger, dachte er; kehren wir zur Orgelempore zurück.
Kaum hatte ich die Empore betreten, erhob sich der Kanonikus von der Orgelbank und streckte mir die Arme entgegen.
»Endlich befindet sich der kleine Werfel unter uns. Freuen wir uns und danken wir dem Herrn«, sagte er mit fast zärtlicher Stimme.
Er faltete die Hände und begann, laut zu beten, und alle meine Kameraden taten es ihm nach.
»Willkommen, Esteban. Von nun an gehörst du zu unserer Gemeinde, du wirst einer der Auserwählten sein«, beteuerte er anschließend. Meine Kameraden staunten mich an, als sähen sie mich zum ersten Mal.
Andrés hatte die Aufgabe, die Gesangbücher zu verteilen. Mir reichte er ein fast neues Exemplar.
»Mach dir keine Sorgen, Esteban. Du brauchst nur ein paar Sonntage mit uns zu kommen, und du wirst es ebenso gut können wie wir. Du wirst bestimmt der Beste«, flüsterte er mir zu. Das Buch hatte einen Goldschnitt, die Seiten waren ganz dünn; ein rotes Band bezeichnete die Seite mit dem Psalm des Tages.
Als der Kanonikus mich aufforderte, mich neben ihn zu setzen, wurde der Blick meiner Gefährten noch feierlicher. Ich schwankte ein bisschen. Das war offensichtlich ein Privileg, doch ich fürchtete die körperliche Nähe des Geistlichen. Ich erinnerte mich an den unangenehmen Geruch seiner Kleider.
»Hab keine Angst, Esteban. Komm, setz dich hierhin«, sagte der Kanonikus, dann begann er zu spielen. Die Holzplanken der Empore zitterten.
Ich wunderte mich, dass die Orgel zwei Tastaturen hatte und dass man die Füße bewegen musste, um zu spielen. Die Melodie mit ihren neckischen, einmal hohen, dann wieder tiefen Tönen erfüllte den Raum, und der Domherr schien sitzend zu tanzen, wiegte sich auf der Orgelbank und stieß mich mit dem Ellbogen an. Ich hatte Mühe, den Strophen zu folgen, ich konnte mich nicht konzentrieren.
Als der dritte Psalm angestimmt wurde, hatte ich das Buch bereits zugeklappt, ich beschränkte mich darauf, still dazusitzen und das Geschehen um mich herum zu betrachten. Dort standen meine Kameraden, sie machten den Mund auf und zu; und dort unten knieten noch immer die Frauen; etwas weiter weg flackerte der orangegelbe Widerschein der Kerze.
Plötzlich stieg die Flamme höher. Zuerst schien mir, als hebe sie ab, als bewege sie sich von selbst. Dann aber, als sie bereits über der Altartreppe schwebte, sah ich, dass die Flamme sich nicht von allein bewegte, nein, dass die Hand eines blonden Mädchens sie führte. Es schwebte, schwebte sanft, ohne Flügelschlag. Sie kommt auf mich zu, dachte ich. Das Licht der Flamme blendete mich.
Das blonde Mädchen flog durch die ganze Kirche, hielt in der Luft schwebend vor mir an, ein paar Meter über der Empore. Die Orgel war verstummt.
»Weißt du, was Liebe ist, Esteban?«, fragte sie mich zärtlich.
Ich nickte als einzige Antwort, wollte aufstehen, um ihr Gesicht zu sehen. Doch das Licht der Flamme hinderte mich daran, ich konnte mich nicht rühren.
»Könntest du mich lieben?«, fragte sie weiter, und einen Moment lang sah ich ihre halb geöffneten Lippen und ihre Nase.
»Ja«, antwortete ich. Das schien mir die einzig mögliche Antwort.
»Dann suche mich, Esteban. Komm nach Hamburg. Maria Vockel, Johanneshof 2, Hamburg«, fügte sie bei.
Sagte es, wandte sich von mir ab und entfernte sich in Richtung des Altars. Ich rief ihr nach, dass ich nach Hamburg kommen werde, ja, dass ich sie suchen werde, doch sie solle nicht so schnell weggehen, sie solle noch ein bisschen bleiben.
»Es ist nichts, Esteban, es ist nichts. Bleib ganz ruhig«, hörte ich anschließend. Ich lag auf dem Boden der Empore, und der Kanonikus beugte sich über mich. Andrés fächelte mir mit einem Notenblatt Luft zu.
»Maria Vockel«, rief ich.
»Ruhig, Esteban. Es ist nichts, nur eine Unpässlichkeit.«
In der Stimme des Domherrn schwang ein liebevoller Unterton mit. Er half mir aufzustehen und bat Andrés, mich an die frische Luft zu begleiten.
»Es ist wohl besser, du gehst heute nicht ins Kino, Esteban. Schone dich etwas«, riet er mir, als wir uns verabschiedeten.
»Du gehst nicht hin, nicht wahr?«, drängte er.
Ich war noch ganz erfüllt von dem Bild des jungen Mädchens mit dem blonden Haar, ich hatte nicht genug Kraft, ihm zu antworten.
Andrés tat es für mich.
»Er wird nicht hingehen, Hochwürden, ich auch nicht. Ich werde bei ihm bleiben, für alle Fälle«, versprach er.
»Gut so«, meinte der Kanonikus und kehrte zur Orgelbank zurück. Der Gottesdienst musste weitergehen.
Kaum war ich draußen, fühlte ich mich besser, und mein Kopf wurde klarer. Schon bald verschwamm das Bild des jungen Mädchens mit dem blonden Haar. So wie die Träume verschwimmen, so wie die Staubpartikel verschwimmen, wenn der Sonnenstrahl verblasst. Doch neben mir stand Andrés, mein Schulkamerad, und sorgte durch seine Anwesenheit dafür, dass die Erscheinung auf der Orgelempore sich nicht ganz verflüchtigte. Er war zwei oder drei Jahre älter als ich, und Liebesdinge beschäftigten ihn ungemein; einen weiblichen Namen vergaß er unmöglich.
»Wer ist Maria Vockel?«, fragte er mich schließlich.
In diesem Moment, als ich ihren Namen hörte, tauchte das Bild wieder auf. Ich sah sie vor mir, wie sie in der Kirche von einem Ende zum anderen geflogen war, und ich erinnerte mich an ihre Fragen. Ruhig erzählte ich Andrés, was mir passiert war.
»Ein Jammer, dass du ihr Gesicht nicht gesehen hast«, stellte er fest. Dieses Detail, das im Porträt des Mädchens fehlte, schien ihn sehr zu beschäftigen.
»Nur die Lippen und die Nase. Doch ich glaube, sie ist hübscher als sämtliche Mädchen in Obaba.«
Davon war ich felsenfest überzeugt, und ich beharrte mit der etwas unlogischen Vehemenz meiner vierzehn Jahre darauf.
»Ich glaube nicht, dass sie hübscher ist als das Mädchen im Kaffeehaus«, wandte er nachdenklich ein.
»Entschuldige, ich wollte dich nicht verletzen«, antwortete ich.
Ich erinnerte mich an Andrés’ Starrköpfigkeit, wenn es um weibliche Schönheit ging. Von seinem Standpunkt aus – der mir damals, jung, wie ich war, etwas töricht vorkam – konnte sich keine Frau mit jener Kellnerin vergleichen, hinter der er her war. Er verwandte seine ganze Freizeit darauf, Geld aufzutreiben, damit er am Samstagnachmittag stundenlang im Kaffeehaus am äußersten Ende der Theke vor einem Glas sitzen konnte, trinkend – und leidend natürlich, denn sie unterhielt sich mit jedermann, nur nicht mit ihm. Die Frau! Die schönste Frau der Welt.
»Bist du mir böse?«, wiederholte ich. Ich wollte nicht, dass er mich allein ließ, ich brauchte jemanden, mit dem ich reden konnte.
»Schon gut«, lenkte er ein.
»Gehen wir spazieren?«, schlug ich vor. Ich wollte nicht gleich nach Hause gehen, ich benötigte Zeit, um die Empfindungen zu ordnen, die sich in meinem Kopf überstürzten.
»Mit dem Fahrrad?«
»Eigentlich lieber zu Fuß. Ich muss über vieles nachdenken.«
Wir schlugen den Weg ein, der von der Kirche aus das Tal entlangführt, wo die drei kleinen Flüsse von Obaba zusammenfließen. Es war ein schmaler Pfad und nicht eben geeignet für zwei Wanderer wie wir, die ihre Fahrräder vor sich herschoben; doch die Landschaft, die sich vor unseren Augen ausbreitete, faszinierte mich. Sie war grün und hügelig, und dazwischen verstreut die weißen Tupfer der Häuser; ein Bild, das jeder Jüngling in seinen ersten Gedichten zu beschreiben versucht.
»Wie ein Spielzeugtal«, sagte ich.
»Ja, genau«, antwortete Andrés nicht sehr überzeugt.
»Sieht aus wie die Krippen, die ihr an Weihnachten aufstellt«, fügte ich hinzu und blieb stehen. Ich fühlte mich zunehmend euphorisch. Die seltsame Erscheinung auf der Orgelempore hatte mein Herz trunken gemacht.
Es hatte endlich zu regnen aufgehört, die Schwäne nutzten die Ruhe, um am Ufer des Weihers Nahrung zu suchen. Der freundliche Spaziergänger, der sie gefüttert hatte, entfernte sich nun durch die Hauptallee des Parkes Richtung Stadt, die weiße Brottüte trug er gefaltet unter dem Arm.
Fasziniert vom sich verändernden Tageslicht, wandte sich Esteban Werfel von seinem Heft ab und trat ans Fenster. »Wie jung wir damals doch waren«, seufzte er, sich des Gesprächs erinnernd, das er mit Andrés geführt hatte.
Er war noch sehr jung damals, ja, und außerdem schmerzten ihn die Bemerkungen, die er über den Herrn Ingenieur Werfel und über seine Mutter zu hören bekam, sie schmerzten und verwirrten ihn, und er suchte in den bebilderten Büchern die Zuneigung und Geborgenheit, die er in der Schule oder in den Straßen von Obaba nicht fand. Sein Herz war ein kleines Kap der Einsamkeit – und ein guter Nährboden für Spintisierereien wie die Geschichte mit Maria Vockel. Er wollte an die Existenz jenes blonden Wesens glauben, er wollte an ihre Worte glauben. Schließlich war sie ihm nicht viel anders erschienen, als es die Heldinnen aus seinen Büchern zu tun pflegten.
Auch nach so vielen Jahren schien es Esteban Werfel richtig, Maria Vockel als seine erste Liebe zu betrachten. Als er damals vom schmalen Pfad aus träumerisch auf das Tal hinabschaute, hatte er, wie Andrés auch, Wehmut verspürt. Zum ersten Mal in seinem Leben glaubte er zu verstehen, was sein Freund für die Kellnerin im Kaffeehaus empfand.
»Du wenigstens kannst sie sehen. Ich hingegen werde sie nie sehen.«
Er lächelte bei der Erinnerung: kindische Worte, so kindisch wie das meiste, was er den Tagebüchern aus jener Zeit anvertraut hatte. Doch die Vergangenheit zu verdrängen, war töricht.
»Und warum gehst du nicht nach Hamburg? Kommt nicht dein Vater von dort?«, wandte Andrés ein. Ihn interessierten die Einzelheiten, nicht die Erscheinung an sich, nicht die Wahrscheinlichkeit. Im Gegenteil: Das Ganze kam ihm ganz vernünftig vor. Er hatte von Verliebten gehört, die auf ganz ungewöhnliche Art und Weise miteinander in Verbindung traten. Dadurch, dass sie sich in Schleiereulen verwandelten, zum Beispiel. Es gab bestimmt einen Grund, warum Maria Vockel beschlossen hatte, Esteban in dieser Gestalt zu erscheinen.
Esteban Werfel vergaß einen Moment lang seine Erinnerungen; er öffnete das Fenster und lehnte sich hinaus. Der Himmel wurde zusehends blauer; die letzten abendlichen Spaziergänger führten ihre Hunde spazieren oder fütterten die Schwäne. Auf der anderen Seite des Weihers spielte eine Schar Kinder Fußball.
Er lehnte sich an das Geländer und nahm den Faden seiner Erinnerung wieder auf: Wie auch immer, Andrés war keine Ausnahme gewesen. Die Menschen in Obaba akzeptierten jede außergewöhnliche Erscheinung mit erstaunlicher Leichtigkeit. Sein Vater machte sich oft über sie lustig.
»Ungeschliffene Leute, Esteban«, pflegte er zu sagen. Und er unterließ es nie, eine komische Anekdote einzuflechten, um seiner Meinung Nachdruck zu verleihen.
Doch er, Esteban, ärgerte sich über die Anekdoten, und es schien ihm, dass sein Vater gegenüber den Leuten von Obaba ungerecht sei, dass er unrecht daran tue, sie zu verachten.
»Doch bei alledem, ich war ein Werfel.«
Er schloss das Fenster und kehrte zum Tisch zurück. Sosehr ich an die Erscheinung glauben wollte, mein Geist sperrte sich dagegen. Es handelte sich um das Leben, nicht um einen Roman. Die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass der Vorfall Wirklichkeit gewesen sein könnte, erschien ihm lächerlich. Nein, Maria Vockel konnte ihm nicht wirklich erschienen sein; es war unmöglich, dass sie in der Johanneshofstraße im Haus Nummer 2 wohnte.
Esteban Werfel schloss die Augen und sah jenen anderen, den von Zweifeln geplagten vierzehnjährigen Esteban auf dem Nachhauseweg, der sich sagte, dass sein Kopf voller Geschichten aus Hamburg sei, voller Namen von Frauen, Sängerinnen, Schauspielerinnen, dass die Worte, die er auf der Orgelempore gehört habe, wohl aus diesen Erinnerungen aufgetaucht seien.
Bevor er mit Schreiben weiterfuhr, zählte er die unbeschriebenen Seiten. Es waren genug – genug, dass der Wunsch sich seiner bemächtigte, den letzten Teil der Geschichte niederzuschreiben. Wenn er damit bald fertig war, würde er noch Zeit haben, in den Park zu gehen und den Kindern beim Fußballspiel zuzusehen. Doch es war nur ein flüchtiger Wunsch. Er musste die Geschichte in allen Einzelheiten erzählen, so wie er es sich vorgenommen hatte, bevor er aus Hamburg zurückgekehrt war.
Er tauchte die Feder ins Tintenfass, warf einen letzten Blick aus dem Fenster und sah einen Jungen, der mit seinem Regenschirm herumfuchtelte und die Schwäne verscheuchte.
»Schon zurück?«, sagte mein Vater, kaum war ich zur Tür hereingekommen.
»Ich bin nicht ins Kino gegangen.«
»Und weshalb nicht?«
»Weil mir in der Kirche schwarz vor den Augen geworden ist«, gestand ich ihm beschämt.
Ich sah, dass er sich sorgte, und beeilte mich, ihm zu erklären, das sei nicht weiter schlimm. Die Dunkelheit in der Kirche und das Flackern einer Kerze seien daran schuld gewesen. Ich hätte nicht so in die Flamme starren müssen.
Seufzend zeigte mein Vater auf die Bibliothek.
»Die Weisheit steckt in diesen Büchern, Esteban. Nicht in der Dunkelheit der Kirche«, sagte er.
»Ich möchte dich etwas fragen«, stotterte ich nach längerem Schweigen. Ich konnte mich nicht mit ihm unterhalten und mein Geheimnis für mich behalten. Ich musste ihn nach seiner Meinung hinsichtlich des Vorfalls mit Maria Vockel fragen.
»Ich höre.«
Er setzte sich in einen Lehnstuhl, bedeutete mir, mich ebenfalls zu setzen. Ich war nervös, und es kam mir vor, als betrachte er mich nicht länger als ein Kind, sondern als einen erwachsenen Menschen, der in der Lage ist, seine Entscheidungen selbst zu treffen.
Ich schilderte ihm alles, was nach dem Betreten der Kirche vorgefallen war: das Gespräch, das ich während meines Ohnmachtsanfalles geführt, den Wunsch, den ich anschließend empfunden hatte, die Zweifel nachher. Er hörte mir aufmerksam zu, ohne mich zu unterbrechen.
Als er sah, dass ich mit meiner Geschichte fertig war, stand er auf und ging im Zimmer auf und ab. Er blieb nachdenklich am Fenster stehen. Jetzt geht er dann in die Bibliothek und holt ein Buch, in dem der Vorfall erklärt wird, dachte ich. Doch er rührte sich nicht.
»Kann so etwas tatsächlich passieren?«, fragte ich. »Ist es möglich, dass Maria Vockel tatsächlich existiert?«
»Es gibt nur einen Weg, es zu erfahren, Esteban. An jene Adresse zu schreiben«, sagte er lächelnd. Ich war sehr erleichtert, dass er so verständnisvoll war. »Ich werde dir helfen, den Brief zu schreiben«, fügte er immer noch lächelnd bei. »Ich beherrsche meine Muttersprache noch recht gut.«
Trotz des liebenswürdigen Tones senkte ich bei seinen Worten den Kopf. Mein Vater war in seinem Versuch, mir die deutsche Sprache beizubringen, nicht eben erfolgreich gewesen. Auch zu Hause zog ich es vor, so zu sprechen, wie ich es mit meinen Freunden zu tun pflegte, und wurde wütend, wenn er sich weigerte, sich mit mir in der Sprache zu unterhalten, die uns beiden geläufig war. Doch an jenem Sonntag war alles anders. Ich bereute mein Verhalten und schwor mir, ihn nicht mehr zu brüskieren, die verlorene Zeit nachzuholen.
Doch mein Vater schien ganz zufrieden, es war, als ob die Ereignisse jenes Nachmittags seine alten Erinnerungen wiederbelebt hätten. Er fasste mich am Kinn und zwang mich, den Kopf zu heben. Dann breitete er einen alten Stadtplan von Hamburg auf dem Tisch aus und begann, die Johanneshofstraße zu suchen.
»Genau, da ist sie. Im Stadtviertel St. Georg«, sagte er und zeigte mir die Stelle auf dem Plan. »Komm – wollen wir den Brief gleich jetzt schreiben?«
»Aber gern«, antwortete ich lachend.
Heute, viele Jahre später, weiß ich, dass jener Brief das Ende eines Lebensabschnittes bedeutete. Ich, der ich nie wie die anderen Kinder von Obaba gewesen war, würde mich von jenem Moment an in einen Fremden verwandeln – in einen würdigen Nachfolger des Herrn Ingenieur Werfel. Ich würde den Umgang mit meinen Schulkameraden abbrechen und nie mehr die Kirche betreten. Im Übrigen würde ich mich dem Studium zuwenden und mich auf die Universität vorbereiten.
Nachdem der Brief abgeschickt worden war, folgte eine Zeit voller Zweifel. An einem Tag war ich sicher, dass die Antwort schon bald eintreffen werde, am nächsten Tag hingegen war ich davon überzeugt, dass es lächerlich sei, an eine solche Möglichkeit zu glauben, und ärgerte mich über mich selbst, weil ich insgeheim immer noch darauf hoffte.
Die Zweifel fanden eines Freitags ein Ende, als ich lesend in meinem Zimmer saß. Mein Vater eilte die Treppe hinauf und streckte mir ein cremefarbenes Kuvert entgegen.
»Maria Vockel«, rief ich und schob den Stuhl zurück.
»Maria Vockel, Johanneshof 2, Hamburg«, las mein Vater auf der Rückseite des Briefes.
Ein Kälteschauer lief mir über den Rücken. Das war ganz einfach unmöglich. Doch der Beweis lag da, vor mir. Das cremefarbene Kuvert war echt, wie auch die beschriebenen Briefbögen, die es enthielt.
»Frag mich, wenn du etwas nicht verstehst«, sagte mein Vater, bevor er das Zimmer verließ. Ich nahm das Wörterbuch zur Hand, das er mir zu meinem Geburtstag geschenkt hatte, und begann, den Brief zu lesen.
Draußen vor dem Fenster erlosch die Sonne wie ein zartes Feuer, ohne dass sie sich gegen die Wolken hatte behaupten können, und eine dunkle Decke legte sich über den Park und hüllte alles ein: das Gras, die Bäume, den Weiher. Nur die Schwäne schienen in der Abenddämmerung leuchtender, weißer.
Esteban Werfel machte das Licht an und zog Maria Vockels Brief aus einer Schreibtischschublade. Dann begann er, ihn sorgfältig in sein Heft abzuschreiben.
Mein lieber Esteban.
Wir brauchen uns nicht den Kopf zu zerbrechen über das, was wir uns nicht erklären können, und erst recht nicht, wenn wie in unserem Fall das Unerklärliche so wunderbar ist. An jenem Sonntag, von dem du mir berichtet hast, lag ich mit leichten Halsschmerzen im Bett und langweilte mich sehr, und plötzlich bekam ich Lust, ein Buch zu lesen. Doch infolge eines Stromausfalls war es im ganzen Haus dämmrig, und so musste ich zuerst eine Kerze suchen gehen. Ich stand also auf und ging in die Küche.
Was uns zwei widerfahren ist, passierte kurze Zeit später, als ich mit der brennenden Kerze in der Hand in mein Zimmer zurückging. Zuerst hörte ich Orgelklänge, dann erblickte ich einen dunkelhaarigen Jungen neben einem älteren Herrn, der schnaubend und sich wiegend in die Tasten griff. Und dann hörte ich die gleichen Worte, die du gehört hast, und ich fühlte mich überaus glücklich, wie wenn es sich um einen Traum handelte, um einen wunderschönen Traum. Ist dir das Gleiche passiert? Warst du glücklich? Ich hoffe, ja.
Später erzählte ich den Vorfall meiner Mutter. Aber sie schenkte mir kein Gehör; sie schickte mich ins Bett und sagte, ich hätte Fieber. Doch jetzt wissen wir, was das alles bedeutet: Wir haben beide das Gleiche erlebt, und das wird wohl seinen Grund haben.
Maria Vockel erzählte ihm dann von ihrem Leben in Hamburg, das ganz anders war als in Obaba, viel interessanter. Sie lernte Sprachen, lief Schlittschuh, machte Ausflüge mit dem Segelboot. Sie ging auch ins Kino, doch nicht etwa in Stummfilme; die Stummfilme waren bereits in die Geschichte eingegangen.
Der Brief schloss mit einer Bitte: Sie möchte gerne sein Foto haben. Wäre er vielleicht so lieb und würde ihr eines schicken? Sie würde ihm dafür das ihre schicken. Ich bin viel blonder, als du dir vorstellst, versicherte sie ihm.
Esteban lächelte beim Lesen dieser Bemerkung und legte den Brief wieder in die Schublade zurück. Er musste weiterschreiben, und zwar so schnell wie möglich, denn es wurde langsam dunkel. Der Park war voller Schatten; die Schwäne schliefen in ihrer Hütte.
Maria Vockels Brief machte mir Mut, und zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich den Leuten von Obaba überlegen. Mir war etwas Außergewöhnliches widerfahren, etwas, was niemandem widerfahren war, und das machte mich zu einem echten Auserwählten. Von nun an war ich eine Persönlichkeit und würde mich nicht mehr von dieser anderen Sorte von Auserwählten einschüchtern lassen, die mit dem Finger auf mich zeigten.
Eine Zeit lang traf ich mich weiterhin mit meinen Schulkameraden. Einesteils brauchte ich ihre Gesellschaft, denn meine Beziehung zu Maria Vockel war eine zu große Neuigkeit, als dass ich sie für mich allein hätte behalten können. Und wenn wir uns trafen – jung, wie wir waren –, um Vertraulichkeiten auszutauschen, war ich jeweils der Gesprächigste von allen. Nicht einmal Andrés konnte es mit mir aufnehmen.
Doch die junge Hamburgerin gefiel ihnen nicht. Sie behaupteten, sie sei ganz bestimmt hässlich und trage wahrscheinlich eine Brille, und zudem müsse sie todlangweilig sein, denn sonst würde sie nicht ständig nur von Büchern und solchen Dingen sprechen.
»Und sie macht nie Andeutungen über … na ja, du weißt schon«, fragten sie mich grinsend und machten zweideutige Gesten.
Ihre Zoten machten mich wütend. Ich wehrte mich und zeigte ihnen ein Bild, auf dem ein blondes Mädchen mit lächelnden Augen und fein geschwungenen Lippen zu sehen war. Doch sie grinsten weiter und zweifelten an der Echtheit des Fotos.
Mit der Zeit kühlte unsere Freundschaft ab. Ich weigerte mich, ihnen die Briefe zu zeigen, die regelmäßig aus Hamburg eintrafen, und wir gingen nur noch gemeinsam ins Kino. Und als sie, Andrés’ Beispiel folgend, das Kino leid waren und sich angewöhnten, die Kaffeehäuser zu frequentieren, war der Bruch komplett. Ich zog es vor, zu Hause zu bleiben, Deutsch zu lernen und die Bücher aus der Bibliothek meines Vaters zu lesen. Ich wollte mich vorbereiten, wollte auf der Höhe von Maria Vockel sein.
Mein Vater konnte die Freude nicht verheimlichen, die ihm meine Entfremdung von allem, was mit Obaba zu tun hatte, bereitete.
»Gehst du nicht mit deinen Freunden aus?«, fragte er mich jeweils am Sonntagnachmittag, und in seiner Stimme schwang eine Spur Besorgnis mit.
»Nein, mir ist wohl zu Hause.«
Meine immer gleiche Antwort machte ihn glücklich.
Als ich siebzehn war, verließ ich Obaba und ging auf die Universität. Zu jenem Zeitpunkt belief sich die Zahl der mit Maria gewechselten Briefe auf über hundert, und es gab kein Thema, das wir nicht erörtert hätten. Alle zusammen hätten ein aufschlussreiches Buch ergeben über all das, was die Jugend bewegt.
Wir machten uns auch Gedanken über die Zukunft unserer Beziehung. Ich bat sie, auf mich zu warten, ich würde bald nach Hamburg kommen. Genau besehen, entsprach jene Bitte einem Heiratsantrag. Zweifellos war das nicht die Zukunft, die das Leben für uns bereithielt. Unsere Beziehung, die bis zu meinem Eintritt in die Universität so intensiv gewesen war, kühlte von jenem Moment an plötzlich ab. Als ich die Hörsäle betrat, war es, als habe jemand ein Zeichen gegeben. Mit anderen Worten ausgedrückt: Die Musik verstummte mit einem Schlag.
Maria Vockels Briefe trafen immer spärlicher ein, und der Ton, den sie darin anschlug, war nicht mehr überschwänglich; manchmal war er nur höflich. Maria Vockels verändertes Verhalten verwirrte mich, erfüllte mich mit Unsicherheit. Wie darauf reagieren? Sie um Erklärung bitten? Meine Versprechen wiederholen? Doch wie auch immer – die Tage vergingen, und ich konnte mich nicht dazu aufraffen, etwas zu unternehmen.
Als ich in den Weihnachtsferien nach Obaba zurückkehrte, sah ich einen cremefarbenen Brief auf dem Schreibtisch in meinem Zimmer liegen. Ich wusste sofort, dass es der Abschiedsbrief war.
»Schlechte Nachrichten?«, fragte mich mein Vater beim Essen.
»Maria hat mich verlassen«, antwortete ich niedergeschlagen. Die Nachricht, obwohl nicht unerwartet, hatte mich getroffen.
Mein Vater lächelte. »Gräme dich nicht, Esteban. Die Schmerzen der Liebe sind wie die der Backenzähne: heftig, aber nie gefährlich.«
Tatsächlich dauerte meine Niedergeschlagenheit nicht lange an. Eine Zeit lang war ich wütend, wollte ihr eine barsche Antwort schicken, doch dann, ganz allmählich, ohne dass ich mir dessen eigentlich bewusst war, vergaß ich alles. Bevor das Semester um war, kam mir die Beziehung, die ich mit ihr unterhalten hatte, weit, weit weg vor, und ich war froh, dass sie zu Ende war.
Nach meinem Studienabschluss – ich unterrichtete bereits in Geografie – heiratete ich eine Kollegin, und die cremefarbenen Briefe blieben begraben und vergessen. Mein Vater ruhte schon lange in der Erde von Obaba.
Esteban Werfel legte die Feder auf die Seite und überlas die beschriebenen Seiten. Ich bin aus Hamburg zurückgekehrt mit dem Vorsatz, einen Bericht meines Lebens zu schreiben, las er auf der ersten Seite.
Er seufzte erleichtert. Sein Lebensbericht war fast fertig. Er brauchte nur noch zu erzählen, was er anlässlich seiner Reise nach Hamburg erlebt hatte.
Er beugte sich wieder über das Heft, zögerte, das Wort Epilog zuoberst auf die neue Seite zu schreiben. Schließlich zog er es vor, einen Strich zu ziehen und dadurch den letzten Teil der Geschichte vom Rest zu trennen.
Es war ganz dunkel geworden. Das kalte, gelbe Licht der Straßenlampen beleuchtete nun den Park.
So könnte der Rückblick auf den Verlauf meines Lebens enden, das an einem Sonntagnachmittag begonnen hat – schrieb er darunter –, wenn nicht die Reise nach Hamburg gewesen wäre, von der ich kürzlich zurückgekehrt bin. Doch was ich dort entdeckt habe, zwingt mich, einen Sprung in der Zeit zu machen und mit meiner Geschichte fortzufahren.