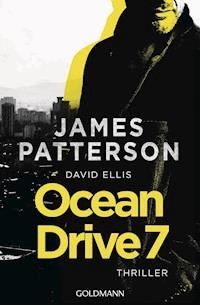
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Das Haus Nummer 7 am Ocean Drive ist eine der besten Adressen in den Hamptons, der Heimat der Reichen und Mächtigen. Doch hinter der schönen Fassade des Anwesens verbirgt sich eine schreckliche Vergangenheit – es ist der Tatort einer Serie von Morden, die nie gelöst wurden. Als auf dem Grundstück erneut ein blutiges Verbrechen begangen wird, beginnt Detective Jenna Murphy in dem Fall zu ermitteln. Doch sie muss schnell feststellen, dass die Geschichte des Hauses noch viel dunkler ist als die schlimmsten Gerüchte besagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Bridgehampton ist ein beschaulicher Küstenort, der im Sommer von reichen New Yorkern bevölkert wird. Detective Jenna Murphy verbrachte hier als Kind ihre Sommerferien. Von korrupten Kollegen bei der New Yorker Polizei vertrieben kehrt sie nach Bridgehampton zurück und arbeitet Seite an Seite mit ihrem Onkel Chief James. Der brutale Mord an einem Filmproduzenten und dessen Freundin im leerstehenden Haus am Ocean Drive 7 bringt die Idylle des Ortes und auch Jennas bisher innige Beziehung zu ihrem Onkel ins Wanken. Schnell wird Noah Walker, der Exliebhaber des Mordopfers, verhaftet. Jenna zweifelt jedoch an seiner Schuld, erst recht als eine weitere Frau auf gleiche Weise im Garten des Anwesens am Ocean Drive 7 ermordet wird …
Weitere Informationen zu James Patterson
sowie zu lieferbaren Titeln des Autors
finden Sie am Ende des Buches.
James Patterson
und David Ellis
Ocean Drive 7
Thriller
Aus dem Amerikanischen
von Peter Beyer
Für Matt, Libby und Zach Stennes
PROLOG
BRIDGEHAMPTON, 1995
Als er die Augen aufschlägt, ist es draußen noch dunkel, und durch das geöffnete Fenster strömt kühle, frische Luft herein. Normalerweise würde er erst in einer Stunde aufstehen, aber in Erwartung des heutigen Tages konnte er in der vergangenen Nacht kaum schlafen. Eigentlich ist er sich noch nicht einmal sicher, ob er überhaupt geschlafen hat.
Als er den langen, schmalen Posaunenkoffer in der Ecke seines Schlafzimmers erblickt, beschleunigt sich sein Herzschlag. All diese Proben, all diese Übungsstunden, so lange, bis ihm Hände und Schultern schmerzten, bis es in seinem Kopf hämmerte, all diese Vorbereitungen liefen auf den heutigen Tag hinaus. Endlich ist er gekommen!
Rasch putzt er sich die Zähne und zieht sein Halloween-Kostüm an. Er nimmt den Posaunenkoffer und seinen Schulrucksack und geht leise nach unten, um seine Mutter nicht aufzuwecken.
Er reißt die Zellophanfolie auf, legt zwei Pop-Tarts in den Toaster und schenkt sich ein Glas Milch ein. Er trinkt die Milch, rührt aber das Gebäck nicht an. In seinem Magen rumort es zu sehr. Essen wird er später, nach seinem Auftritt.
Es ist immer noch dunkel und ganz schön frisch, als er sich auf den Weg macht, mit dem Rucksack über der Schulter und dem Posaunenkoffer in der linken Hand. Am Ende der Straße schaut er nach rechts, wo er in achthundert Metern Entfernung in einem trüben Dunstschleier den Atlantik erahnen kann, dunkel und endlos. Unweigerlich wirft er dann einen Blick auf das Haus, das auf dem Hügel am Strand thront, das Spukhaus, das ihn sogar aus dieser Entfernung einschüchtert.
Niemand kommt je lebend raus
aus dem Ocean-Drive-7-Haus
Ein kalter Schauer überläuft ihn. Er schüttelt ihn ab und geht nach links, den Ocean Drive in nördliche Richtung. Weil der Posaunenkoffer schwer ist, trägt er ihn abwechselnd in der linken und der rechten Hand; er will nicht, dass irgendetwas seinen Auftritt heute beeinträchtigt.
Während er sich der Schule von Süden her nähert, wird er munter. Die kühle Morgenluft erwärmt sich allmählich und wirkt belebend. Die Sonne bricht durch die Wipfel der Bäume. Herbstlich gefärbte Blätter wiegen sich im Wind. Er unterdrückt den Drang, zu hüpfen wie ein ungeduldiger kleiner Junge.
Denn er ist kein kleiner Junge mehr. Er ist ja nicht mehr acht oder zehn.
Er ist der Erste, genau wie er es geplant hat, allein auf einer fast einen halben Hektar großen Grünfläche, ein freies Feld, das zum Baseballfeld und dem Schulhof im Süden des Backsteingebäudes führt. Keine Bäume, kein Gebüsch, keine Backsteinmauern, rein gar nichts über die Länge von mindestens einem halben Footballfeld.
Er wendet sich dem Wald an der östlichen Seite zu und nimmt dort seine erhöhte Position ein. Er öffnet den Posaunenkoffer und holt das Gewehr heraus, das bereits voll geladen ist.
Er hält das Gewehr in den Händen und holt tief Luft, um seine Nerven zu beruhigen. Sein Herzschlag rast, seine Kehle ist wie zugeschnürt, seine Glieder zittern.
Er schaut auf seine Star Wars-Armbanduhr, die er über seinem Halloween-Kostüm trägt. Gleich wird die Schulglocke zum ersten Mal läuten. Einige Schüler treffen immer früh ein und versammeln sich in der Nähe des Hintereingangs, wo sie sich in kleine Cliquen aufteilen oder sich einen Football oder Frisbee zuwerfen. Spielzeug für die kleineren Kinder.
Aber auf die kleineren Kinder hat er es nicht abgesehen.
Er schaut wieder auf seine Uhr, auf der ihm Darth Vader zu erkennen gibt, dass die Zeit bald gekommen ist. Er wollte sich heute eigentlich als Darth verkleiden, dem Anlass entsprechend, aber mit dem überdimensionierten, klobigen Helm war es fast unmöglich gewesen, durch das Zielfernrohr etwas zu erkennen, als er es versucht hat.
Inmitten der herumwirbelnden Blätter schweift er mit den Gedanken ab, verliert sich in seinen Fantasien, und plötzlich ist die Zeit wie im Flug vergangen. Sie kommen. Kleine Kinder, an der Hand ihrer Eltern lebhaft hüpfend. Ältere, die nebeneinandergehen. Superman und Batman und Aquaman, Vampire und Clowns, Kätzchen und Häschen, Aschenputtel, Schneewittchen und Tinker Bell, Pocahontas und Woody aus Toy Story, Ronald Reagan und Simba aus König der Löwen, Mr Spock …
… und die ältesten Schüler an der Schule, die im dritten und vierten Jahr, ein paar davon mit der obligatorischen Schminke oder dem Hauch eines Kostüms, aber in der Regel zu cool, als dass sie sich verkleiden würden wie ihre kleineren Mitschüler.
»Showtime«, sagt er. Diesen Ausdruck hat er in einem Film auf einem der Kabelkanäle gehört, einem Film, den er eigentlich nicht hätte sehen dürfen, und fand, er klinge cool. Ihm wird immer heißer unter seinem Kostüm.
»Showtime«, sagt er erneut und hebt sein Gewehr, und dieses Mal findet er die Sprache wieder, stark und zuversichtlich, und dann ändert sich alles, so als werde in ihm ein Schalter umgelegt. Ruhe erfüllt und beschwingt ihn: Schaut ihn an! Schaut ihn an, wie er besonnen aus der Deckung der Bäume hervortritt, das Gewehr im Anschlag, zielen und feuern und die nächste Patrone einklicken lassen, zielen-feuern-klicken, während er auf die erschrockene Menge zugeht. Der Knall, jedes Mal, wenn er den Abzug betätigt, verursacht die belebendste Empfindung, die er je verspürt hat.
Jimmy Trager schreit vor Schmerz und Überraschung auf, sein Rücken krümmt sich, und er taumelt zu Boden. Roger Ackerman, dieses Arschloch, umklammert seinen Arm und versucht davonzulaufen, wankt aber nur durch das Laub.
Auf der Lichtung nun deutlich sichtbar geht er auf ein Knie, um ins Gleichgewicht zu kommen. Schreie und Rufe erfüllen die Luft, und fünfzig, sechzig Kinder stieben wie aufgeschreckte Hühner in alle Richtungen und stoßen dabei aneinander, stolpern übereinander, lassen ihre Schultaschen fallen und bedecken sich den Kopf; unsicher zunächst, wohin sie rennen sollen, drehen sie den Kopf in alle Richtungen, wissen nur, dass sie weglaufen sollten, laufen, laufen …
»Zu den Bäumen!«, schreit einer der Erwachsenen.
»Zum Parkplatz!«, ruft ein anderer.
Er feuert und lädt nach, zielen-feuern-klicken, während die Gruppen von Schülern voller Panik wie vom Sturm gepeitschte Blätter hin und her jagen. Ihre schrillen Schreie sind wie Musik in seinen Ohren. Ihre panische Angst ist seine Luft zum Atmen. Er wünscht sich, dass dieser Moment nie vergeht.
Sechs Treffer, sieben, acht auf der Lichtung in seiner Nähe. Ein weiteres halbes Dutzend weiter entfernt.
Und dann hebt er in einer dramatischen Geste sein Gewehr in die Luft, nur einen Moment, um die herrliche Szene zu genießen, die Macht, die er ausübt, das Chaos, das er verursacht hat. Es ist mit nichts vergleichbar, das er je empfunden hat. Es ist mit Worten nicht auszudrücken, dieser Euphorieschub, dieser Nervenkitzel, der durch ihn strömt. Und dann verschwimmt das Bild vor seinen Augen, und es dauert einen Moment, bis er begreift, dass nicht der Wind dafür verantwortlich ist, sondern seine Tränen.
In seinem Luftgewehr sind wahrscheinlich noch ein Dutzend Kugeln, aber ihm läuft die Zeit davon. Jeden Moment wird einer der Lehrer herauskommen. Sie werden die Polizei alarmieren. Und er hat ohnehin erreicht, was er wollte. Nur ein paar oberflächliche Verletzungen durch die Schrotmunition.
Aber heißa, was hat das Spaß gemacht!
Und ich bin erst zwölf Jahre alt, denkt er. Das war noch gar nichts, Leute.
BUCH I
BRIDGEHAMPTON, 2011
1
Noah Walker klettert vorsichtig auf das Dach seines Hauses, braucht einen Moment, um das Gleichgewicht zu finden, und nimmt die Yankee-Kappe ab, um sich unter der sengenden Sonne der ersten Junitage den Schweiß von der Stirn zu wischen. Dacharbeiten hat er immer ganz gern verrichtet, aber wenn es das eigene Dach ist, von dem Gebäude, das man gemietet hat, und wenn man es nur macht, weil der Vermieter ein halbes Jahr benötigt, um es reparieren zu lassen, und man die Wasserflecken an der Decke satthat, dann ist es etwas anderes.
Er fährt sich mit den Händen durch das dichte, lockige Haar. Paige nennt es den Matthew-McConaughey-Look – was bedeutet, dass er die entsprechende Physis hat. Diesen Vergleich bekommt er schon seit Jahren zu hören und hat sich noch nie viel darauf eingebildet. Er hat sich nie viel aus dem gemacht, was irgendwer über ihn gedacht oder gesagt hat. Täte er es, würde er todsicher nicht mehr in den Hamptons leben.
Er hört das Knirschen von Autoreifen unten auf der Straße, das Summen eines leistungsstarken Motors, der gut in Schuss ist. Die unbefestigten Straßen, die vom Sag Harbor Turnpike abgehen, sind bestenfalls uneben, manchmal holprig und zuweilen regelrecht tückisch. Anders als die Uferstraßen am Ozean zu den über dreieinhalbtausend Quadratmeter großen Villen, in denen die oberen Zehntausend gern den Sommer verbringen. Nicht, dass er allzu sehr über den Jetset lästern sollte, denn er verdient von Mai bis August doppelt so viel, wenn er nach ihrer Pfeife tanzt, wie im Rest des Jahres zusammen. Er repariert, was bei ihnen repariert werden muss. Er gräbt um, was bei ihnen umgegraben werden muss. Er erträgt ihre herablassende Behandlung.
»Paige«, sagt er zu sich selbst, noch bevor ihr pechschwarzes Aston Martin Cabrio die Einfahrt heraufkommt und neben seiner neunzehn Jahre alten umgebauten Harley stehen bleibt. Besonnen ist sie nicht. Wahrscheinlich sollte sie vorsichtiger sein. Aber hier im Wald, wo er wohnt, haben die Leute nichts mit den Reichen am Hut, daher besteht nicht wirklich die Gefahr, dass die Sache Paiges Mann, John Sulzman, zu Ohren kommt. Es ist nicht so, als würden seine Nachbarn Paiges Mann bei irgendwelchen High-Society-Veranstaltungen über den Weg laufen. Leute wie er kommen einem Smoking nur nah, wenn sie sich auf Discovery Channel Pinguine anschauen. Gleiche Postleitzahl, andere Welt.
Mit der Anmut, die ihr zu eigen ist, gleitet Paige aus ihrem Cabrio. Noah verspürt das Verlangen, das bereits der erste Blick auf sie immer auslöst. Paige Sulzman ist einer der Menschen, für die Schönheit mühelos ist, ein Privileg, keine lästige Aufgabe. In ihrem gepunkteten Kleid, mit einer Hand den weißen Hut im Wind festhaltend, sieht sie ganz so aus wie die Angehörige der feinen Gesellschaft von Manhattan, zu der sie gehört, auch wenn sie ursprünglich aus dem Hinterland stammt und sich Augenmaß und Bescheidenheit bewahrt hat.
Paige. Sie hat etwas Erfrischendes an sich. Mit ihrem glänzenden blonden Haar und ihrer Figur, für die man töten würde, ihrer kleinen Stupsnase und ihren strahlenden haselnussbraunen Augen ist sie eine natürliche Schönheit. Aber es ist nicht bloß ihr Aussehen. Sie hat einen scharfen Verstand, kann über sich selbst lachen, hat die Manieren eines gut erzogenen Mädchens. Sie ist einer der aufrichtigsten und anständigsten Menschen, die er je kennengelernt hat.
Sie ist auch ziemlich gut im Bett.
Noah klettert an der Rückseite des Hauses vom Dach und empfängt sie drinnen. Sie eilt zu ihm, presst ihre Lippen auf die seinen und legt dabei die Hände auf seine nackte Brust.
»Ich dachte, du wärst in Manhattan«, flüstert er.
Sie zieht zum Schein mit ihren üppigen Lippen einen Flunsch. »Was ist das denn für eine Begrüßung, Mister. Wie wäre es mit: Paige, ich freue mich total, dich zu sehen!«
»Ich freue mich ja auch.« Das tut er wirklich. Zum ersten Mal ist er Paige vor Jahren begegnet, als er auf dem Anwesen der Sulzmans die Dachrinnen gereinigt hat. Ihr Bild hatte er danach noch lange vor Augen. Doch erst vor sechs Wochen brachte das Schicksal sie zusammen.
Die Aussicht, Paige zu sehen, war immer sowohl aufregend wie auch Furcht einflößend. Aufregend, weil er noch nie jemanden kennengelernt hat, der die Flamme in ihm so entfacht, und Furcht einflößend, weil sie mit John Sulzman verheiratet ist.
Aber all das ist nebensächlich. Es knistert zwischen ihnen, dass es fast greifbar ist. Er ertastet mit seinen großen, rauen Händen die Konturen ihres Körpers unter ihrem dünnen Kleid, umschließt ihre beeindruckenden Brüste, fährt ihr durch das seidige Haar, während sie ein leises Stöhnen ausstößt und sich an dem Reißverschluss seiner Bluejeans zu schaffen macht.
»Ich werde ihn verlassen«, haucht sie mit stockendem Atem. »Ich werde es tun.«
»Das kannst du nicht«, sagt Noah. »Er wird … dich umbringen.«
Noahs Hand gleitet in ihren Slip, und sie atmet schwer. »Ich habe es satt, Angst vor ihm zu haben. Mir ist egal, was er … was er … oh … oh, Noah …«
Er hebt sie hoch, und sie prallen gegen die Eingangstür, die daraufhin mit einem dumpfen Schlag zuknallt. Das Geräusch überschneidet sich mit einem ähnlichen, mit dem sich draußen eine andere Tür schließt.
Noah trägt Paige in das Wohnzimmer. Er legt sie auf dem Teppich ab, reißt ihr Kleid auf, sodass die Knöpfe aufspringen, und gleitet mit dem Mund über ihre Brüste, um seine Lippen dann hinunter zu ihrem Slip wandern zu lassen. Im nächsten Moment trägt sie keine Unterwäsche mehr und hat die Beine um seinen Hals geschlungen, während sie nun heftiger stöhnt und dabei seinen Namen ruft.
Er richtet sich auf und streift sich die Jeans ab, befreit sich. Dann stützt er sich über Paige ab und gleitet sanft in sie hinein, worauf sie einen Katzenbuckel macht. Sie finden ihren Rhythmus, zunächst langsam und dann drängend, und ein Kribbeln durchströmt Noah, die Intensität nimmt zu, ein Damm, der im Begriff ist zu brechen …
Dann hört er, wie sich eine weitere Tür schließt. Dann wieder eine.
Plötzlich bewegt er sich nicht mehr und hebt den Kopf.
»Da ist jemand«, sagt er.
2
Noah zieht sich die Unterwäsche wieder an und setzt sich in die Hocke, bleibt geduckt. »Bist du sicher, dass dein Mann …«
»Ich wüsste nicht, wie.«
Sie weiß nicht, wie? John Sulzman hat unbegrenzte Mittel, mehr Kapital als manche kleine Länder. Jemanden, der so arglos ist wie Paige und so etwas nie bemerken würde, könnte er mühelos beschatten lassen.
Noah holt tief Luft; sein Herzschlag verlangsamt sich, und das Blut gefriert ihm in den Adern. Er hebt seine Jeans vom Boden auf und angelt das Messer aus seiner Gesäßtasche.
»Geh nach oben und versteck dich«, befiehlt er Paige.
»Ich gehe nirgendwohin.«
Er lässt sich auf keinen Streit ein. Paige würde doch nicht auf ihn hören.
Und außerdem sind sie nicht wegen Paige hier. Sie sind wegen ihm hier.
Noah hört, dass sich draußen etwas bewegt. Es sind aber weder Stimmen noch beabsichtigte Geräusche zu vernehmen, was die Sache noch schlimmer macht – sie kündigen sich nicht an. Er bleibt in gebückter Haltung und gleitet aus dem Wohnzimmer hinaus, aber nicht, ohne zuvor durch das Fenster einen flüchtigen Blick auf sich bewegende Menschen erhascht zu haben, von denen einige um das Haus eilen, während andere auf die Eingangstür zuhalten.
Eine kleine Armee fällt über das Haus her. Und er hat nichts außer einem Dachpappenmesser.
Mittlerweile im Hausflur, steht er gegenüber der Eingangstür. Sich zu verstecken nutzt wenig. Täte er es, würden sie ihn finden, und wenn sie ihn gefunden hätten, wären sie bereit zu handeln, hätten ihre Waffen im Anschlag, wären in einer Abwehrformation ausgeschwärmt. Nein, seine einzige Chance besteht darin, sie seinerseits zu überraschen: wenn sie glauben, sie schlichen sich während eines Schäferstündchens herein, wenn sie glauben, Noah sei nicht auf sie vorbereitet. Überrasche sie, tu ihnen weh und entkomme.
Er hört, wie die Hintertür aufschlägt, während sich gleichzeitig der Türknauf an der Haustür langsam dreht. Sie kommen aus beiden Richtungen gleichzeitig. Er hat praktisch keine Chance.
Aber er hat wohl nichts zu verlieren, denkt er und verstärkt seinen Griff um das Messer.
Er macht mit einem Bein einen Ausfallschritt nach hinten, wie ein Läufer, der vor dem Rennen in den Startblock tritt, bereit, mit seinem Messer auf die Haustür zuzusprinten. Der Türknauf vollendet seine Drehung, das Herz pocht ihm bis zum Hals, die Eingangstür fliegt auf.
Er stürzt nach vorn, bereit, das Messer nach oben zu ziehen …
… eine Frau, rothaarig, in Bluejeans und mit einer Schutzweste, Revolver in der Hand, eine Dienstmarke, die an einer Kordel um ihren Hals baumelt …
Eine Dienstmarke?
Er versucht, seinen Schwung abzubremsen, fällt auf die Knie und rutscht weiter nach vorn. Die Frau wirbelt herum und holt zu einem Tritt aus, und Noah erblickt unmittelbar vor dem Aufprall das Profil ihrer Schuhsohle. Dann lässt der Tritt seinen Kopf zurückschnellen. Sein Rücken krümmt sich, und er schlägt mit dem Kopf auf den Boden, sieht an der Decke über sich Sternchen und gezackte Linien tänzeln.
»Messer weg, oder ich mache Sie kalt!«, erklingt ihre monotone Stimme. »STPD.«
Noah blinzelt heftig mit den Augen. Sein Herz hämmert nach wie vor.STPD.
Die Polizei?
»Messer fallen lassen, Noah!«, befiehlt die rothaarige Polizistin, während mehrere andere Officers hinter ihr hereindrängen.
»Mein Gott, ja doch.« Noah wirft das Messer auf den Boden. Er schmeckt Blut im Mund. Ein stechender Schmerz schießt ihm durch Nase und Augen.
»Keine Bewegung!«, schreien die anderen Officers Paige an. »Hände hoch!«
»Tun Sie ihr nichts!«, sagt Noah. »Sie hat überhaupt nichts …«
»Noah, wenn Sie sich mir noch einmal widersetzen, landen Sie im Krankenhaus.« Die Rothaarige stellt einen Fuß auf seinen Brustkorb. Trotz seiner misslichen Lage und dem Schmerz, der in seinem Kopf hämmert, und der Angst, die ihm die Brust zuschnürt, nimmt er diese Polizistin jetzt zum ersten Mal wahr, ihre auffälligen eisblauen Augen, ihr glänzendes hochgebundenes Haar, ihr Selbstvertrauen.
»Was … was geht hier vor?«, bringt er heraus. Seine anfängliche Erleichterung – niemand will ihn töten – ist von kurzer Dauer, vor allem, da nun auch durch die Hintertür immer mehr Polizisten hereindrängen. Zehn Officers, schätzt er, alle in Schutzwesten und schwer bewaffnet.
Warum?
»Sie haben kein Recht dazu, das hier zu tun!«, ruft Paige aus dem anderen Raum. Es hört sich gleichermaßen wie Protest als auch wie Belehrung an, wie etwas, das jemand sagen würde, der Geld hat, jemand, der den Cops gegenüber nicht den Schwanz einzieht, wie andere es tun würden.
So ziemlich das Einzige, das Noah verschwommen erkennen kann, ist die Polizistin, die auf ihn hinunterstarrt. Er trägt nur Unterwäsche, liegt flach auf dem Rücken, während ihr Fuß auf seiner Brust ruht und sich nach dem Tritt in seinem Gesicht ein hübsches Veilchen bildet. Aber Paiges Rufen zu hören löst etwas in ihm aus.
»Das hier ist mein Zuhause«, zischt er und ballt die Hände zu Fäusten. »Wenn Sie ein Problem mit mir haben, klopfen Sie an die Tür und sprechen Sie mit mir.«
»Wir haben ein Problem mit Ihnen, Noah«, blafft sie. »Besser so?«
Sein Blick bleibt an Detective Isaac Marks hängen, den Noah seit Jahren kennt, noch aus der Schulzeit. Abgesehen von einem leichten Zucken mit der Schulter zeigt Marks kaum eine Reaktion.
Die Rothaarige befiehlt Noah, sich umzudrehen. Sie legt ihm Handschellen an und zieht ihn mit einem Ruck auf die Füße. Der jähe Ruck, verbunden mit den Nachwirkungen des Tritts ins Gesicht, bewirkt, dass Noah auf wackeligen Beinen steht.
»Das ist doch lächerlich«, protestiert er. »Behauptet Dr. Redmond wieder, ich hätte ihm seine Rolex gestohlen? Sagen Sie ihm, er soll unter den Couchkissen nachschauen.« Es wäre nicht das erste Mal, dass einer dieser Trillionäre etwas verlegt hat und das Personal beschuldigt, es geklaut zu haben. Ein Filmproduzent ließ Noah mal wegen des Diebstahls seiner Golfschläger verhaften, nur um sich später daran zu erinnern, dass er sie im Kofferraum seines Wagens liegen gelassen hatte. »Und sind Sie auch ganz sicher, genug Bullen mitgebracht zu haben?«
»Sind Sie deshalb mit einem Messer auf mich losgegangen?«, fragt die Rothaarige. »Weil Sie dachten, ich wollte Sie wegen einer Uhr befragen?«
»Er weiß, dass es hier nicht um eine Rolex geht.« Noah erkennt die Stimme, bevor er Langdon James in das Haus stolzieren sieht. Er ist seit über fünfzehn Jahren Chief des Southampton Town Police Department. Sein Doppelkinn hängt ihm jetzt über dem Hemdkragen, der Bauch über dem Gürtel, und seine Haare sind vollkommen ergraut, aber er hat immer noch seine Baritonstimme und seine dicken Koteletten.
Was zum Teufel macht der Chief hier?
»Detective Murphy«, sagt der Chief zu der Rothaarigen, »bringen Sie ihn zur Wache. Ich kümmere mich um die Durchsuchung seines Hauses.«
»Sagt mir jetzt mal jemand, was hier vor sich geht?«, fordert Noah, nicht imstande, die Angst zu verbergen, die seine Stimme zu ersticken droht.
»Ist mir ein Vergnügen«, sagt der Chief. »Noah Walker, Sie sind verhaftet wegen der Morde an Melanie Philipps und Zachary Stern.«
3
Die Beerdigungsfeier für Melanie Philipps ist gut besucht, die Bankreihen in der Presbyterianischen Kirche sind voll besetzt, die Besucher stehen bis auf die Main Street hinaus. Sie war noch keine zwanzig Jahre alt, als sie ermordet wurde, und hat zeit ihres Lebens in Bridgehampton gewohnt. Das arme Mädchen hat nie die Welt sehen können, auch wenn für manche der Platz, an dem sie aufwachsen, die Welt bedeutet. Vielleicht war Melanie so. Vielleicht wollte sie bloß Kellnerin im Tasty’s Diner sein und Touristen und Städtern oder hier und da reichen Paaren, die mal im »lokalen Umfeld« etwas trinken wollen, Muscheln und Hummer servieren.
Aber bei ihrem Aussehen, zumindest nach dem, was ich auf Fotos gesehen habe, wollte sie wahrscheinlich höher hinaus. Eine junge Frau wie sie, mit glänzendem braunem Haar und feinen Zügen, hätte die Cover von Lifestyle-Magazinen füllen können. Zweifellos hat sie aus diesem Grund die Aufmerksamkeit von Zach Stern auf sich gezogen, dem Leiter einer Talent-Agentur, zu der Top-Prominente gehören, ein Mann, der einen eigenen Jet besaß und ab und zu gern in den Hamptons abhing.
Und zweifellos hat sie deshalb auch die Aufmerksamkeit von Noah Walker auf sich gezogen, der anscheinend eine ausgesprochene Vorliebe für die junge Melanie hegte und ihre Affäre mit Zach nicht allzu freundlich aufgenommen haben dürfte.
Erst vor vier Nächten wurden Zachary Stern und Melanie Philipps tot aufgefunden, Opfer eines brutalen Mords in einem Ferienhaus in der Nähe des Strands, das Zach für eine Woche gemietet hatte. Es war ein solches Blutbad angerichtet worden, dass der Gottesdienst zu Melanies Beerdigung mit geschlossenem Sarg abgehalten wurde.
Dass so viele hier zusammenkommen, liegt also zum Teil an Melanies Beliebtheit bei der örtlichen Bevölkerung und zum Teil am Medieninteresse angesichts Zach Sterns Ruf in Hollywood.
Zum Teil aber auch daran, wie man mir gesteckt hat, dass die Morde sich in Ocean Drive 7 ereignet haben, das die Einheimischen auch das Mordhaus nennen.
Jetzt beginnt die eigentliche Grablegung, die gleich neben der Kirche stattfindet. Dies erlaubt dem Pulk von Menschen, die keinen Platz mehr in der Kirche gefunden haben, zum südlichen Ende des Friedhofs zu gehen, auf dem Melanie Philipps ihre letzte Ruhe finden wird. Es müssen dreihundert Menschen hier sein, wenn man die Medienvertreter mitzählt, die größtenteils einen respektvollen Abstand einhalten, selbst während sie ihre Fotos schießen.
Die senkrecht einfallenden Strahlen der Mittagssonne führen dazu, dass Augen zusammengekniffen und Sonnenbrillen aufgesetzt werden, was mir beides die Aufgabe erschwert, wegen der ich gekommen bin, nämlich die Leute unter die Lupe zu nehmen, die an der Beerdigungsfeier teilnehmen, und zu sehen, ob bei irgendwem mein Radar anschlägt. Manchmal kommen die Dreckskerle nämlich gern vorbei und schauen sich das Leid an, das sie verursacht haben, daher ist es eine Standardprozedur, an Tatorten und Begräbnissen einen Blick über die Menge schweifen zu lassen.
»Erkläre mir doch noch mal, warum wir hier sind, Detective Murphy«, will mein Partner, Isaac Marks, wissen.
»Ich erweise die letzte Ehre.«
»Du kanntest Melanie doch gar nicht«, versetzt er.
Wohl wahr. Ich kenne hier in der Gegend überhaupt niemanden. Vor langer, langer Zeit fuhr meine Familie jeden Sommer hierher, eine gut dreiwöchige Spanne von Juni bis Juli, um bei Onkel Langdon und Tante Chloe zu wohnen. Meine Erinnerungen an diese Sommer – Strände und Bootsfahrten und Angeln im Hafenbecken – enden im Alter von acht.
Aus irgendeinem Grund, den ich nie in Erfahrung gebracht habe, fuhr meine Familie danach nicht mehr hierher. Bis vor neun Monaten, als ich hier in den Polizeidienst eintrat, hatte ich achtzehn Jahre lang keinen Fuß mehr in die Hamptons gesetzt.
»Ich tue etwas für meine Bräune«, sage ich.
»Gar nicht davon zu sprechen, dass wir unseren Bösewicht schon in Gewahrsam haben«, mault Isaac, ohne weiter auf meine Bemerkung einzugehen.
Auch wahr. Gestern haben wir Noah Walker festgenommen. Morgen ist seine Kautionsanhörung, aber bei einem Doppelmord wird der Richter ihn auf keinen Fall auf Kaution rauslassen.
»Und wenn ich hinzufügen darf«, wendet Isaac ein, »ist das hier nicht einmal dein Fall.«
Wieder wahr. Ich hatte mich freiwillig gemeldet, das Team zu leiten, das Noah festnimmt, aber den Fall hat man mir nicht gegeben. Tatsächlich nimmt sich der Chief – mein besagter Onkel Langdon – dieser Angelegenheit persönlich an. In der Stadt haben sich fast alle ins Hemd gemacht, vor allem die eingebildeten Millionäre der Strandpromenade, als der Promi-Agent Zach Stern in ihrer malerischen kleinen Ortschaft brutal ermordet wurde. Das ist so ein Fall, der den Chief den Job kosten könnte, wenn er nicht auf der Hut ist. Angeblich liegt ihm der Bürgermeister stündlich in den Ohren, um auf den neusten Stand gebracht zu werden.
Warum also bin ich hier, bei der Beerdigung von jemandem, den ich nicht kenne, in einem Fall, der nicht der meine ist? Weil ich mich langweile. Weil ich, seit ich weg bin vom NYPD, nichts mehr erlebt habe. Und weil ich mich in meinen acht Jahren im Dienst mit mehr Tötungsdelikten beschäftigt habe als all diese Cops in Bridgehampton zusammen. Übersetzung: Ich wollte den Fall und war ein wenig ungehalten, als ich ihn nicht bekam.
»Wer ist das?«, frage ich und deute dabei über den Weg auf einen seltsam aussehenden Mann mit einer grünen Kappe, langem strähnigem Haar und verlotterten Klamotten. Er hat tiefliegende, gruselige Augen, die umherzuschweifen scheinen. Er verlagert sein Gewicht ständig von einem Bein auf das andere, nicht imstande, still stehen zu bleiben.
Isaac schiebt seine Sonnenbrille nach unten, um besser sehen zu können. »Ach, das ist Aiden Willis«, sagt er. »Er arbeitet für die Kirche. Hat wahrscheinlich Melanies Grab ausgehoben.«
»Sieht so aus, als habe er vorher darin geschlafen.«
Das gefällt Isaac. »Ernsthaft, Murphy. Du suchst nach Verdächtigen? Bei allem, was du über diesen Fall weißt, also so gut wie gar nichts, passt dir Noah Walker als Mörder nicht?«
»Das habe ich nicht gesagt«, erwidere ich.
»Du streitest es aber auch nicht ab.«
Darüber denke ich nach. Er hat natürlich recht. Was zur Hölle weiß ich schon über Noah Walker oder die Beweise gegen ihn? Er ist mir vielleicht nicht als jemand aufgefallen, der gerade einen brutalen Doppelmord begangen hat. Aber wann stimmt schon das äußere Erscheinungsbild mit dem überein, was jemand verbrochen hat? Einmal habe ich einen Lehrer von Zweitklässlern eingebuchtet, der an der Highschool mit Heroin dealte. Und einen jugendlichen Ehrenamtler, der im Keller eines Krankenhauses Leichen poppte. Man kann in die Köpfe der Menschen nicht reinschauen. Und ich hatte Noah Walker gerade mal eine halbe Stunde lang gesehen.
»Geh nach Hause«, schlägt Isaac vor. »Trainiere …«
Heute Morgen schon getan.
»… oder schau dir das Meer an …«
Schon angeschaut. Ist ein echt großes Gewässer.
»… oder trink dir einen.«
Klar, ein Gläschen Wein könnte nicht schaden. Aber vorher mache ich noch schnell einen kleinen Umweg. Einen Umweg, der mir eine Menge Ärger bescheren könnte.
4
Langdon James schließt für einen kleinen Moment die Augen und hebt das Gesicht zur Sonne, die auf die Gäste der Cocktailparty im Garten hinter dem Haus herabscheint. In diesen Momenten, leicht beschwipst vom Gin und dem Jetset von Southampton um ihn herum, tut er gern so, als wäre er einer der ihren, einer aus der Schickeria, einer der Megareichen, der Treuhandfonds-Schnuckis, der Anwälte für Personenschäden, der Songschreiber und Tennisprofis, der TV-Produzenten und Börsenspekulanten. Ist er natürlich nicht. Er ist nicht mit einem Silberlöffel im Mund geboren worden, und er war immer schon eher der bauernschlaue Typ, nicht der gebildete. Aber er hat einen anderen Weg zur Macht beschritten, den über eine Dienstmarke, und meistens reicht das auch.
In dem weitläufigen Garten hinter dem Haus befinden sich mindestens hundert Leute, die meisten von ihnen sind Angehörige der feinen Gesellschaft, alle sind hier versammelt, um Bürgermeisterin Dawn McKittredge und ihre Kandidaten bei ihrer Wiederwahl zu unterstützen, in Wirklichkeit aber eher, um gesehen zu werden, von Kellnern in weißen Kitteln servierte Horsd’oeuvre zu verspeisen und über ihre neueste Anschaffung oder Eroberung zu tratschen. Sie leben nicht das ganze Jahr über hier, und die einzige Bedeutung, die die staatlichen Autoritäten des Städtchens hier für sie haben, besteht in den gelegentlich aufkommenden Fragen zu Bebauungsplänen – Wasserrechte, Flächennutzung und dergleichen – oder im Fall von Chief James in gelegentlichen Drogenrazzien, dem Fahren unter Einfluss psychoaktiver Substanzen oder Tändeleien mit Prostituierten aus Sag Harbor.
»Guten Tag, Chief.«
Langdon dreht sich um und erblickt John Sulzman. Der besitzt seit über einem Jahrzehnt ein Haus am Meer in Bridgehampton, einer winzigen Ortschaft, die zu Southampton gehört. Sulzman hat sein Vermögen mit Hedgefonds gemacht und verbringt nun die Hälfte seiner Zeit in D. C. und Albany mit Lobbyarbeit für den Gesetzgeber und dem Aushandeln entsprechender Deals. Einem Artikel in der New York Post zufolge, den Langdon letztes Jahr gelesen hat, beläuft sich sein Vermögen auf mehr als eine halbe Milliarde. Sulzman ist in dritter Ehe verheiratet – mit der hübschen Paige – und nach seinen gelallten Worten zu urteilen derzeit mit seinem dritten oder vierten Scotch beschäftigt. Er trägt ein Button-down-Hemd mit offenem Kragen und eine weiße Freizeithose. Er hat Übergewicht, ein rundes, wettergegerbtes Gesicht und dichtes Haar, wenn man das Toupet mitzählt. Eines der besseren, aber trotzdem – begreifen diese Kerle denn nicht, dass es jeder sehen kann?
»John«, sagt der Chief.
»Wie ich höre, befindet sich Noah Walker in Untersuchungshaft«, sagt Sulzman, als spräche er über das Wetter. »Wie ich höre, waren Sie persönlich dabei.«
»War ich.« Der Chief nippt an seinem Gin. Keine Limette, kein Tonic, kein Rührlöffel. Dem Augenschein nach könnte er auch Eiswasser trinken, und das ist der Sinn der Sache.
»Ich habe den Polizeibericht gelesen«, sagt Sulzman. »Was drinsteht und was nicht.«
Er meint seine Frau. Der Chief hat Paige in dem Polizeibericht nicht erwähnt und so ihre Anwesenheit vor der Klatschpresse geheim gehalten. Wahrscheinlich glaubt John Sulzman, er habe es getan, um sich anzubiedern, aber das hat er nicht. Es war nicht notwendig, sie ins Spiel zu bringen. Sie hatte absolut nichts mit der Verhaftung zu tun, war bloß eine unbeteiligte Zuschauerin.
Aber Sulzman betrachtet es als Gefälligkeit. Tja, da gäbe es Schlimmeres.
»Es ist kein großes Geheimnis, dass Sie ein Auge auf den Posten des Sheriffs geworfen haben, Chief.«
Langdon schweigt. Aber Sulzman hat recht. Der Sheriff von Suffolk County geht in Ruhestand, und es wäre eine nette Krönung für Langdons Karriere im Staatsdienst.
Sulzman hebt anerkennend sein Glas. »Ehrgeiz regiert die Welt. Er treibt Männer dazu, sich in ihrem Job zu profilieren.«
»Ich versuche immer, mein Bestes zu geben«, sagt der Chief.
»Und ich versuche, die zu belohnen, die es tun.« Sulzman nimmt einen großen Schluck und stößt dann befriedigt den Atem aus. »Wenn Noah Walker verurteilt wird, haben Sie sich in meinen Augen in Ihrem Job profiliert. Und ich werde nur zu gerne Ihr nächstes Unterfangen unterstützen. Sind Sie mit meinen Bemühungen zur Mittelbeschaffung vertraut, Chief?«
Zufälligerweise ist der Chief das. Aber er bestätigt es nicht.
»Ich kann Millionen für Sie organisieren. Ich könnte aber auch Millionen für Ihren Gegenkandidaten zur Verfügung stellen.«
»Und wer würde mein Gegenkandidat sein?« Der Chief schaut Sulzman an.
Sulzman zuckt mit den Schultern und wirft den Kopf zurück.
»Wer immer ich will.« Er tippt dem Chief auf den Arm. »Und wissen Sie, wer auch mit meinen Bemühungen zur Mittelbeschaffung vertraut ist? Unsere Bürgermeisterin. Ihr Boss.«
Chief James nimmt noch einen Schluck von seinem Gin. »Soll das eine Drohung sein?«
»Eine Drohung? Nein, Chief. Ein Versprechen. Falls Noah Walker freikommt, dann wird es Leute in dieser Kommune geben – und ich werde vielleicht einer von ihnen sein –, die Ihren Kopf fordern.«
John Sulzman ist nicht für sein subtiles Vorgehen bekannt. Wenn man fünfhundert Millionen Dollar schwer ist, braucht man das wohl auch nicht. Wenn Noah also für schuldig befunden wird, steht fest, dass der Chief der nächste Sheriff wird. Kommt Noah raus, kann der Chief sich von seinem gegenwärtigen Job und von jedweder Zukunft im Staatsdienst verabschieden.
»Noah Walker wird verurteilt werden«, bekräftigt der Chief, »weil er schuldig ist.«
»Natürlich ist er das.« Sulzman nickt. »Natürlich.«
Diese Unterhaltung sollte vorbei sein. Sie hätte nie stattfinden sollen, aber jetzt sollte sie definitiv zu Ende sein. Ein Kerl wie Sulzman ist schlau genug, um das zu wissen.
Trotzdem geht Sulzman nicht. Er hat noch etwas anderes in petto.
»Da ist … ein neuer Officer an dem Fall dran?«, fragt er. »Eine Frau?«
Der Chief dreht Sulzman den Kopf zu.
»Ihre Nichte«, sagt Sulzman, sichtlich zufrieden, dass ihm jemand diese Information gesteckt hat, und mehr als zufrieden damit, sie dem Chief unter die Nase reiben zu können. »Jenna Murphy.«
»Jenna arbeitet nicht an dem Fall«, stellt der Chief richtig. »Sie hat nur die Verhaftung geleitet, das ist alles.«
»Ich erwähne es nur, weil ich gehört habe, dass sie Probleme beim New York Police Department gehabt hat«, erklärt Sulzman.
»Das einzige ›Problem‹, das sie hatte, ist die Tatsache, dass sie ein ehrlicher Cop ist«, blafft Langdon. »Fest steht, sie war vom ersten Tag an unser bester Cop in der Truppe. Sie ist klug wie nur was, und sie ist taff und ehrlich und hat die Korruption, auf die sie in Manhattan gestoßen ist, nicht geduldet. Sie hat sich nicht auf schmutzige Bullen eingelassen, und sie hat nicht weggeschaut.«
Sulzman nickt und schürzt die Lippen.
»Es ist nicht ihr Fall, John«, sagt der Chief.
Sulzman taxiert den Chief, mustert ihn von Kopf bis Fuß und schaut ihm dann direkt in die Augen. »Mir ist nur das Ergebnis wichtig«, sagt er. »Sorgen Sie dafür. Sorgen Sie dafür, dass Noah Walker in ein sehr tiefes Loch einfährt. Sonst wird es … Konsequenzen haben.«
»Noah Walker wird in ein Loch einfahren, weil …«
»Weil er schuldig ist«, schneidet ihm Sulzman das Wort ab. »Ja, ich weiß. Ich weiß, Lang. Nur … vergessen Sie diese Unterhaltung nicht. Sie wollen mich doch zum Freund haben, nicht zum Feind.«
Mit diesen Worten tritt John Sulzman ab und gesellt sich zu einer Reihe von Bekannten, die im Schatten des Zelts stehen. Chief Langdon James sieht ihm hinterher und beschließt dann, dass er genug von dieser Party hat.
5
Nach der Trauerfeier für Melanie Philipps verabschiede ich mich von meinem Partner, Detective Isaac Marks, ohne ihm zu sagen, wohin ich gehe. Ich weiß nicht, ob er diese Information für sich behalten würde. Ich bin mir nicht sicher, wem seine Loyalität gehört, und ich werde nicht den gleichen Fehler begehen, den ich beim NYPD gemacht habe.
Ich beschließe, zu Fuß zu gehen, und steuere vom Friedhof aus in südliche Richtung auf den Atlantik zu. Die Entfernung zum Meer unterschätze ich immer wieder, aber es ist ein schöner Tag für einen Spaziergang, auch wenn es ein wenig drückend ist. Ich genieße die Aussicht auf die Häuser gleich südlich der Main Street entlang dieser Straße, die weiß verzierten Cape Cod Cottages mit ihren Zedernholzschindeln, deren Farben mit dem Alter satter geworden sind von all der salzigen Meeresluft, die die Nähe zum Ozean mit sich bringt. Manche der Häuser sind größer, manche neuer, aber im Grunde genommen sehen sie alle gleich aus, was ich beruhigend und zugleich ein wenig unheimlich finde.
Je näher ich dem Meer komme, desto größer sind die Grundstücke, desto prächtiger die Häuser und desto höher die sie umgebenden Hecken zum Schutz der Privatsphäre. Als ich ein Gebüsch erreiche, das gut drei Meter hoch ist, bleibe ich stehen. Ich weiß, dass ich das Haus gefunden habe, zu dem ich will, weil die stattlichen schmiedeeisernen Tore am Ende der Auffahrt, die ein wenig aufstehen, mit schwarzgelbem Absperrband markiert sind, auf dem TATORT – NICHT BETRETEN steht.
Ich gleite zwischen den Torflügeln hindurch, ohne das Siegel aufzubrechen. Ich gehe ein Stück die Auffahrt hinauf, doch sie beschreibt einen Bogen und führt zu einer Art Wirtschaftsgebäude auf einer Anhöhe. Daher nehme ich die Steinstufen, die mich schließlich zur Haustür bringen.
In der Mitte des weitläufigen Rasens, direkt bevor die Grünfläche steil ansteigt, befindet sich ein kleiner Steinbrunnen mit einem Denkmal, auf dem ein Wappen und eine Inschrift erkennbar sind. Ich beuge mich über den Brunnen, um die kleine Steintafel genauer zu inspizieren. In der Mitte prangt ein Vogel mit einem hakenförmigen Schnabel und einer langen Schwanzfeder, umringt von kleinen Symbolen, scheinbar allesamt der Buchstabe X. Bei näherer Betrachtung jedoch entpuppen sie sich als eine Abfolge gekreuzter Dolche.
Und dann macht es bei mir wumm.
Der Gefühlsausbruch überwältigt mich, der zentnerschwere Druck auf der Brust, der Würgegriff um meine Kehle, sodass ich keine Luft mehr bekomme und nichts sehen kann, das Gefühl der Schwerelosigkeit in mir. Hilfe, so hilf mir doch bitte jemand …
Ich taumele zurück, verliere dabei beinahe das Gleichgewicht und ziehe den Atem ein, tief und köstlich.
»Wow«, sage ich in die warme Brise hinein. Sachte, Mädchen. Immer mit der Ruhe. Ich wische mir schmierigen Schweiß von der Stirn und atme noch ein paarmal ein und aus, um meinen Puls zu beruhigen.
Unter dem Wappen auf dem Denkmal steht in dicker gotischer Schrift in den Stein gemeißelt:
Cecilia, oh Cecilia
Der Tod kam als Leben daher
Okay, das ist jetzt zugegebenermaßen ziemlich gruselig. Ich mache mit meinem Smartphone ein Foto von dem Denkmal. Da ich jetzt direkt vor dem Haus stehe, schaue ich es mir zum ersten Mal genauer an.
Die Villa, die vom Gipfel des Hügels auf mich herabzublicken scheint, ist ein neogotisches Bauwerk, erbaut aus verblasstem mehrfarbigem Kalkstein. Mit seinen vielen Dachflächen, allesamt mit steilen Schrägen, seinen schicken Türmchen und seinen Schornsteinen an jedem Ende wirkt es viktorianisch. Teile der Fassade sind im mittelalterlichen Stil gehalten. Die Enden der Dachfirste schließen mit Dachreitern ab, die ihrerseits in scharfe Spitzen auslaufen wie auf die Götter gerichtete Speere. Mal sind die Fenster lang und schmal, mal kleeblattförmig und mit Buntglas. Das Haus wirkt, als würde es gebieterisch und finster blicken.
Ich habe ein paar Dinge über dieses Gebäude gehört, ein paar Dinge gelesen, bin sogar häufig daran vorbeigeschlendert. Aber es von so Nahem zu sehen jagt mir einen Schauer über den Rücken.
Es wirkt halb wie eine Kathedrale, halb wie ein Schloss. Es ist ein düster dreinschauendes, bedrohlich wirkendes, imposantes Gebäude, majestätisch und zugleich tief ergreifend, fast romantisch in seiner Düsterheit.
Fehlen nur noch eine Zugbrücke und ein Festungsgraben, in dem es vor Krokodilen wimmelt.
Das also ist Ocean Drive 7. Das ist das Haus, das die Leute das Mörderhaus nennen.
Das ist nicht dein Fall, rufe ich mir in Erinnerung. Das ist nicht dein Problem.
Das könnte dich deine Dienstmarke kosten, Mädchen.
Ich gehe die Anhöhe hinauf in Richtung der Haustür.
6
Ich fühle mich in die Vergangenheit zurückversetzt, in eine Zeit, als man noch auf Pferden ritt oder mit Kutschen fuhr, im Licht von Kerzen und Fackeln hauste und Infektionen mit Blutegeln behandelte.
Als ich die Eingangstür des Hauses Ocean Drive 7 schließe, hallt das Geräusch bis zur unglaublich hohen Gewölbedecke hinauf, die mit einem verschnörkelten Fresko geflügelter Engel, nackter Frauen und bärtiger Männer in wallenden Gewändern dekoriert ist, die allesamt nach etwas zu greifen scheinen, vielleicht auch nach einander.
Das zweite Vorzimmer ist genauso bedrückend und altmodisch wie das erste. Der Fußboden ist mit gemusterten Fliesen ausgelegt, und auch hier wirkt die Malerei des Deckengewölbes alttestamentarisch, auch hier stehen antike Möbel, hängen goldgerahmte Wandporträts von Männern in Rüschenhemden und langen Mänteln, die Perücken aus langem, gewelltem weißem Haar und spitzwinklige Hüte tragen – formelle Kleidung, circa 1700.
Der Mann, der dieses Haus erbauen ließ, der Familienpatriarch, ein Mann namens Winston Dahlquist, hatte anscheinend keinen Sinn für Humor.
Als ich in die luftige, sich über drei Stockwerke erstreckende Eingangshalle trete, hallt das Klackern meiner Absätze auf dem Hartholzboden wider. Bei jedem Schritt, den ich mache, scheint das Haus zu stöhnen und zu ächzen.
»Hallo«, sage ich, wie es ein Kind tun würde, und das Echo meiner Stimme kehrt leise zu mir zurück.
Eine bogenförmig verlaufende Treppe führt hinauf zum ersten Obergeschoss, und wie vorherzusehen knarren die Stufen. Das Haus gibt weiterhin Laute von sich, ruft von unsichtbaren Stellen, stöhnt und quietscht und keucht wie eine Jahrhunderte alte Kreatur, die tief und schwer atmet.
Als ich den Absatz erreiche, packt es mich erneut, raubt mir die Luft aus der Lunge, presst meine Brust zusammen, macht mich blind. Nein, bitte! Bitte, bitte, hör auf …
… schrille, kindliche Schreie, unkontrolliertes Gelächter …
Bitte nicht, tu mir das nicht an.
Ich kralle mich am Geländer fest, damit ich nicht rücklings die Stufen hinabfalle. Ich mache die Augen auf und hebe das Gesicht, nach Luft japsend, bis mein Herzschlag sich endlich wieder beruhigt.
»Nimm dich zusammen, Murphy.« Ich schreite durch verschnörkelte Flügeltüren in den Flur des ersten Obergeschosses, wo mir sofort der kupferne Geruch von geronnenem Blut entgegenschlägt, der penetrante faulige Gestank von Verwesung. Ich gehe über einen dicken roten Teppich, die Wände sind rot und golden tapeziert, und ich nähere mich dem Schlafzimmer, in dem Zack Stern und Melanie Philipps ihre letzten Atemzüge taten.
Ich gehe über den dunklen Hartholzboden und schaue mich im golden tapezierten Zimmer um. An einer Wand steht ein überbreites Himmelbett mit schweren violetten Vorhängen und soliden Bettpfosten. Das Bett ist mit einer violetten Überdecke bezogen, und es liegen noch einige Samtkissen mit Rüschen darauf, weitere befinden sich auf dem Fußboden. Auf einer dunklen Holzkommode liegen zwei Zinnfigürchen, die wahrscheinlich als Buchstützen für die dicken Erzählbände fungierten, die ebenfalls auf dem Boden liegen. Die Figürchen und ein gleichfalls umgeworfener antiker Messingwecker befinden sich am Rand der Kommode.
Gegenüber dem Bett, aus ähnlichem Holz geschreinert wie die Kommode, steht ein riesiger Kleiderschrank. Und hinten in der Ecke des Raums, zwischen dem Kleiderschrank und der Kommode, befindet sich der Eingang zum Badezimmer.
Ich ziehe die Tatortfotos aus der Akte, die ich zuvor fotokopiert hatte. Zachary Stern wurde mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden aufgefunden, den Kopf rechts zur Tür hin gewandt, die Füße Richtung Bett. Bedingt durch die grässliche Stichwunde in seiner Bauchgegend lag er in einer Blutlache und weiteren Körperausscheidungen. Zudem wurden mehrere seiner Finger zerquetscht. Melanie Philipps wurde in der Nähe des Kleiderschranks gegenüber dem Bett aufgefunden, ihr rechter Handrücken berührte den Standfuß des Schranks; sie lag wie Zach auf dem Bauch, der Kopf nach links gewandt, die Augen offen, der Mund zu einem winzigen O erstarrt. Auf sie wurde mehr als ein Dutzend Mal eingestochen, in die Brüste, den Oberkörper und dann in Gesicht, Hals, Rücken, Arme und Beine.
Zurück wieder zum Tatort. Die Überdecke wurde auf der linken Seite zurückgeschlagen, wo nun ein großer Blutfleck zu sehen ist, dort, wo zum ersten Mal auf Zach eingestochen wurde, als er noch im Bett lag. Die Wand hinter dem Bett ist mit Blutspritzern besprenkelt, und eine riesige Blutlache breitet sich dort auf den Bodendielen aus, wo er starb. Blutspritzer auf dem Kleiderschrank und überall daneben auf dem Boden, wo Melanie zum Zeitpunkt ihres Todes lag.
Zwei weitere Fakten: Nach dem Sperma zu urteilen, das man in Melanies und auf Zachs Genitalien gefunden hat, scheint klar, dass die beiden nicht lange vor ihrer Ermordung Geschlechtsverkehr hatten. Und nach heutigem Stand, vorbehaltlich der DNA-Proben, die noch untersucht werden, gibt es keinen objektiven Beweis dafür, dass Noah Walker in diesem Haus war – keine Fingerabdrücke, keine Teppichfasern, keine Abdrücke von Schuhen oder Stiefeln.
Das Southampton Town Police Department und der Staatsanwalt haben den Tathergang folgendermaßen rekonstruiert: Noah war besessen von Melanie. Irgendwie bekam er Wind von ihrer Affäre mit Zach und folgte ihr hierher. Wie er reinkam, weiß man nicht. Die Haustür hätte verschlossen sein müssen, und sie wurde nicht beschädigt. Auf jeden Fall legte er sich so lange auf die Lauer, bis sie ihren Geschlechtsverkehr vollzogen hatten und sich entspannten, arglos waren, um dann ins Zimmer zu stürzen.
Noah überraschte Zach im Bett, stieß ihm das Messer in die Brust und führte die Klinge dann nach unten, wodurch ein vertikaler Schnitt von etwa zwölf, dreizehn Zentimetern entstand, der Speiseröhre und Magen zerfetzte. Zu diesem Zeitpunkt trat Melanie, die sich im Badezimmer aufgehalten hatte, um sich zu waschen, aus diesem heraus. Noah überwältigte sie an der Kommode, wobei die Buchstützen und der Wecker umkippten, und stach ihr mehrfach in die Brüste und den Oberkörper, bevor er sie in der Nähe des Kleiderschranks zu Boden warf, wo Noah erneut von hinten auf sie einstach, ihr dabei Wange, Ohr und Hals und dann Rücken, Arme und Beine verletzte. Dann wandte er sich wieder Zach zu, zerrte ihn aus dem Bett und warf ihn auf den Boden, stampfte in blinder Wut auf ihn ein und zerquetschte dabei einige seiner Finger.
Ich trete in die Ecke, hinter die Stelle, an der Zachs Leiche gefunden wurde, und gehe in die Hocke, bemüht, den richtigen Blickwinkel zu finden, wobei ich die Fotos dazu nutze, um mich zu vergewissern, dass ich richtig liege. Wo Zach auf dem Boden gelegen haben muss, mit dem Kopf nach rechts, verlief seine Blickrichtung an der Kante des Bettes entlang zum Kleiderschrank. Ich wiederhole den Vorgang aus Melanies Blickwinkel und bekomme die gleiche Blickrichtung von der gegenüberliegenden Seite.
Ich hole einen Spiegel aus meiner Handtasche und hocke mich neben den Standfuß des Kleiderschranks, den Melanies rechte Hand berührte. Ich quetsche den Spiegel unter den Schrank, sodass ich die Rückseite des Fußes sehen kann. Wie ich es mir schon dachte, ist das Holz abgerieben – abgekratzt und eingekerbt.
Zehn Minuten später gehe ich den Ocean Drive Richtung Main Street entlang und spreche auf dem Handy mit Onkel Lang. »Melanie Phillips wurde mit Handschellen an den Standfuß des Kleiderschranks gefesselt«, sage ich. »Er hat sie alles mit anschauen lassen. Das war kein Akt blinder Wut, Chief. Das war ein kalkulierter, gut ausgeführter sadistischer Mord.«
7
Ich gehe zurück zu meinem Auto und fahre den Chief besuchen, der heute Nachmittag nicht im Büro ist (man darf ihm nie sagen, dass er seinen freien Tag hat, denn dann verbringt er die Hälfte des Tages damit zu erklären, dass er als Polizeichef nie freihat.) Mein Onkel bewohnt ein Drei-Zimmer-Cottage an der North Sea Road, etwas zurückgesetzt von der Straße und umgeben von einer gut gepflegten Hecke, die mich immer an so etwas wie eine militärische Formation erinnert.
Die Haustür ist entriegelt und geöffnet. Es riecht hier, wie es immer riecht, ein muffiger Männergeruch nach schmutzigen Socken und Schweiß, vermischt mit dem Aroma des letzten Fastfood-Essens vom Schnellimbiss, das er sich geholt hat. Eine typische Junggesellenbude, seit Tante Chloe ihn vor zwei Jahren verlassen hat.
Auf dem Weg zur hinteren Veranda mache ich einen Abstecher in die Küche, öffne den Kühlschrank und werfe einen prüfenden Blick hinein. Schachteln mit Take-away-Essen vom Chinesen, ein halbes Subway-Sandwich noch in seiner Verpackung, ein Zwölferpack Budweiser, in dem noch drei Dosen übrig sind, ein langes Stück Dauerwurst, eine nach hinten geschobene Pizzaschachtel. Ach ja, und dann noch ein hoher Kunststoffbehälter mit geschnittenem Obst, der bis zum Rand gefüllt ist, und eine Portion vegetarische Lasagne, nach wie vor in der mit Folie abgedeckten Auflaufform, und nur ein Viereck ist herausgeschnitten.
Hinter dem Haus stoße ich auf Onkel Lang; er sitzt auf einem Stuhl mit Blick über den Rasen, auf dem eine Berieselungsanlage ihren Dienst versieht, sodass die Luft dampfig ist wie in einer Sauna. Er trägt ein Button-down-Hemd, Slacks und schicke Halbschuhe. Ich hatte vergessen, dass er heute auf dieser Benefizveranstaltung war.
»Hallöchen, kleines Fräulein«, begrüßt er mich. Seine Augen sind klein und gerötet. Das Glas Gin in seiner Hand ist nicht sein erstes heute. Wahrscheinlich hat er bei den Spendensammlern Gin getrunken und so getan, als wäre es Eiswasser.
Ich drücke ihm einen Kuss auf die Stirn und nehme auf dem Stuhl auf der anderen Seite des kleinen Glastischs Platz, wo die Flasche Beefeater steht.
»Du hast das Obst gar nicht angerührt, das ich für dich geschnitten habe«, sage ich. »Und was ist mit der vegetarischen Lasagne? Was soll das werden? Hebst du sie für die Nachwelt auf?«
Er nippt an seinem Gin. »Ich mag keinen Spinat. Das hatte ich dir gesagt.«
»Ach ja?« Ich wende mich ihm zu. »Und welche Ausrede hast du für das Obst?«
Er macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ich weiß nicht, es ist … matschig.«
»Das sind Ananas, Wassermelone und Cantaloupe. Das magst du.«
»Tja, es ist matschig.«
»Das liegt daran, dass du es eine Woche lang stehen gelassen hast. Ich habe es vor einer Woche geschnitten, und du hast es nicht angerührt. Kein einziges Stück.« Ich schlage ihm mit dem Handrücken gegen die Schulter.
»Aua. Schlag mich nicht.«
»Ich schlage dich, wann immer ich dich schlagen will. Du bist wie ein Kind. Du bist wie ein störrisches Kind. Diese Spinatlasagne ist köstlich.«
»Dann iss du sie.«
»Hoffnungslos«, sage ich. »Es ist hoffnungslos mit dir. Du weißt, dass du nächste Woche deinen Arzttermin hast. Glaubst du, Dr. Childress wird zu dir sagen: ›Glückwunsch, Chief, einen Monat lang Buletten-Sandwichs und Brathähnchen und Pommes zu essen hat es voll gebracht – Ihre Cholesterinwerte sind im Keller‹?«
Lang schiebt ein leeres zweites Glas zu mir herüber und bedenkt mich mit einem Blick von der Seite. »Glaub ja nicht, ich wüsste nicht, was du hier tust, kleines Fräulein.«
»Ich gebe auf die Gesundheit meines einzigen noch lebenden Familienmitglieds acht.«
»Nein, du lenkst ab. Du rufst mich an und erzählst mir, dass du am Tatort warst, was du, wie du weißt, nicht tun solltest, da es nicht dein Fall ist. Und deshalb versuchst du, mich in Bezug auf meine Essgewohnheiten in die Defensive zu drängen.«
Ich schenke mir ein Glas Gin ein. Eins wird mich nicht umbringen. »Jede Wette, dass die Abschürfungen an dem Kleiderschrank von einer Handschelle stammen. Er hat die beiden dazu gezwungen, einander beim Sterben zuzuschauen«, erkläre ich. »Er hat Zach bewegungsunfähig gemacht und Melanie mit Handschellen an den Schrank gefesselt. Er hat die beiden gezwungen zuzusehen, wie der jeweils andere verblutet.«
»Jenna …«
»Dieser Kerl wusste, was er tat«, schneide ich ihm das Wort ab. »Er hat Zach bewusst so verletzt, dass er nicht sofort gestorben ist. Ich meine, er hätte ihm das Messer ins Herz rammen können oder ihm die Kehle aufschlitzen. Stattdessen hat er ihn an Stellen verletzt, die ihm unglaubliche Schmerzen und einen langsamen Tod bescheren würden. Als Zach mit letzter Kraft versuchte, sich aufzurappeln, stampfte er ihm auf die Hände. Das Gleiche hat er auch mit Melanie getan. Jedes Mal, wenn sie versucht hat sich zu bewegen, hat er auf sie eingestochen. Sie hat um sich getreten, und er hat sie in die Wade gestochen. Sie hat ihren freien Arm gehoben, und er hat sie in den Trizeps gestochen …«
»Jenna …«
»Das waren sadistische, brutale Foltermorde«, fahre ich unbeirrt fort, »keine Verbrechen aus Leidenschaft, die ein eifersüchtiger Liebhaber begangen hat.«
»Verbrechen aus Leidenschaft können sadistisch sein, Jen…«
»Glaubst du wirklich, wenn Noah in Melanie verliebt war, hätte er erst einmal brav zugeschaut, wie Zach mit ihr schläft? Warum nicht reinstürmen, während sie mitten dabei sind?«
»Hey!«, ruft der Chief. »Komme ich hier vielleicht auch mal zu Wort? Ich habe genug gehört. Es gibt ein Protokoll, und es gibt eine Befehlskette, und dagegen verstößt hier in Southampton niemand. Wenn du glaubst, bloß weil du meine Nichte bist …«
»Natürlich tue ich das nicht. Ich versuche doch bloß zu helfen …«
»Was du tust, ist nicht hilfreich. Ganz und gar nicht hilfreich!« Der Chief hustet in die Faust und läuft rot an. Er muss besser auf sich achten. Ich kann alle gesundheitsfördernden Gerichte zubereiten, die die kulinarische Welt zu bieten hat, aber ich kann ihn nicht dazu zwingen, sie zu essen. Ich kann ihm sagen, er soll ein paarmal in der Woche ein paar Kilometer zu Fuß gehen, aber ich kann sie nicht für ihn gehen.
Er ignoriert jeden Rat, den ich ihm gebe. Er widersetzt sich mir offen, und das jeden Tag. Warum also liebe ich diesen miesepetrigen Kerl so sehr?
»Wieso ist es nicht hilfreich?«, hake ich nach.
Lang macht sein Glas Gin nieder und beruhigt sich wieder. »Weil Noah Walker gestanden hat.«
Ich fahre zurück. »Er … hat gestanden?«
»Oh, das Ass vom NYPD weiß nicht auf alles eine Antwort, nicht wahr?« Lang schenkt sich eine weitere Portion Gin ein. »Er hat heute Morgen gestanden. Also komm mir jetzt nicht und schreibe einen Bericht, den ich einem Verteidiger zeigen muss. Nicht, wenn diese Sache in trockenen Tüchern ist.«
»Noah hat gestanden«, murmele ich und führe das Glas zum Mund. »Ich glaub, mich laust der Affe.«
»Noah Walker ist schuldig, und Noah Walker hat gestanden«, bekräftigt er. »Also tu mir einen Gefallen und komm drüber hinweg.«
8
Die Dive Bar trägt ihren Namen zu Recht. Sie ist in jeder Hinsicht düster, angefangen bei der schummrigen Beleuchtung bis hin zur Eichenvertäfelung. Auf dem Großbildschirm wird ein Spiel der Yankees übertragen, hinter der Bar hängen von diversen Brauereien gesponserte Spiegel, und auf der Speisekarte werden nur ein paar frittierte Appetithappen angeboten für diejenigen, die den Mut aufbringen, in dieser Kneipe etwas zu essen. Aber die Leute hier sind freundlich und locker. Es ist eine Absteige, in der man unerkannt bleiben kann, und unerkannt bleiben klingt in meinen Ohren momentan gut. Mit einem Gläschen Wein fing es an, dann wurden drei Gläser daraus, und mittlerweile sind es, glaube ich, fünf. Als ich erst einmal begonnen hatte, fiel mir kein guter Grund dafür ein, wieder aufzuhören.
Diese Spelunke ist den Einheimischen vorbehalten – Handwerker, Hilfsarbeiter und hier und da ein Cop. Ist mir auch lieber so, denn in den Hamptons ist Hochsaison, und die ganzen Reichen sind in der Stadt. Nicht, dass ich es nicht genießen würde, Männer mit um die Schultern gelegten Strickjacken zu sehen und Frauen, die so harte Arbeit an ihrem Gesicht geleistet haben, dass sie allmählich schon aussehen wie die Comicfigur Joker. Aber nicht an meinem freien Tag. Und schon gar nicht am Abend des Tages, an dem ich mich vor meinem Onkel zum Volltrottel gemacht habe, dem Mann, der mir eine zweite Chance gab.
Ich sollte das Trinken sein lassen. Meine Gedanken verschwimmen, und meine Stimmung verfinstert sich. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe, als ich in die Hamptons zog. Ich hätte einen anderen Job in Manhattan finden oder in eine andere große Stadt ziehen können, um dort neu anzufangen, auch wenn das erst einmal die unterste Stufe im Streifendienst bedeutet hätte. Aber mein Onkel, der Chief, machte mir ein Angebot, und außer ihm rannte mir niemand die Tür ein.
»Scheiße«, sage ich. Das Wort kommt mir schwerfällig über die Lippen. Ich schaue auf meine Uhr, es ist später Nachmittag, fast sechs. Seit dem Frühstück habe ich nichts mehr gegessen, und ich habe mir den Magen verkorkst. (Verkorkst gilt wohl mehr oder weniger auch für mein ganzes Leben.)
»Lass mich in Ruhe, Mann. Lass mich in Ruhe! Du weißt doch, dass ich kreditwürdig bin! Wie lange komme ich schon hierher?«
Der kleine Wutausbruch stammt von dem Kerl am Ende der Bar, den ich irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt habe, seit ich hier bin. Vielleicht ist er aber auch gerade erst gekommen. Mein Gehirn läuft derzeit nicht auf allen Zylindern.
Er trägt das Gleiche, was er heute auch bei der Beerdigung von Melanie Philipps getragen hat. Ein dunkles T-Shirt, mit dem ich meinen Küchentresen wischen würde, eine grüne Baseballkappe, die er sich verkehrt herum aufgesetzt hat und die die Ohren bedeckt, sodass sein langes, strohiges Haar auf beiden Seiten herausragt.
»Jerry«, sage ich zum Barkeeper. Guter Name für einen Barkeeper, Jerry. »Schreib sein Bier auf meinen Deckel.«
Jerry, ein stämmiger Kerl mit einem großen, runden Kopf und einer grünen Schürze, schaut mich von der Seite an. Ich nicke, und er zuckt mit den Schultern und betätigt den Zapfhahn, um Aiden Willis den Krug Budweiser zu zapfen, den dieser sich nicht mehr leisten konnte.
Aidens tief in den Höhlen liegende Augen bewegen sich in meine Richtung. Er sagt nichts. Ein flüchtiges Glitzern könnte bedeuten, dass er mich wiedererkennt, falls er mich auf der Beerdigung registriert hat. Mein größter Makel als Cop ist mein knallrotes Haar. Als ich anderthalb Jahre verdeckt ermittelte und unauffällig bleiben wollte, färbte ich es schwarz.
Ich richte meine Aufmerksamkeit wieder auf meinen Pinot und versuche, mich daran zu erinnern, dass ich nicht im Dienst bin. Zugleich frage ich mich aber, ob Aiden, der Friedhofswärter, wohl zu mir herüberkommen wird. Als ich ein paar Minuten später wieder einen kurzen Blick in seine Richtung werfe, fixiert mich Aiden nach wie vor. Sein Bier hat er nicht angerührt. Er macht keinerlei Geste mir gegenüber, starrt mich nur mit seinen Waschbäraugen an. Aber selbst sein starrer Blick ist nicht wirklich ein Starren. Seine Augen bewegen sich hin und her, wandern ziellos umher, kehren immer wieder zu mir zurück, verweilen aber nie auf mir.
Mein Handy summt, eine Textnachricht ist eingegangen. Noch zehn Minuten. Bist du zu Hause?, lautet die Nachricht. Dass ich zögere zu antworten, überrascht mich, doch ich kann es nicht leugnen. Vertraue immer deinem Bauchgefühl, sagte mein Vater. Manchmal ist es das Einzige, das du hast.
Tja, Papa, ich hatte ein Bauchgefühl in Bezug auf Noah Walker, und nun schau dir an, was mir das eingebrockt hat.
Ich gebe die Adresse der Bar ein und drücke auf Senden. Dann schaue ich wieder zu der Ecke des Tresens, an der Aidens gefüllter Bierkrug steht. Doch Aiden selbst ist verschwunden.
Ich beschäftige mich mit meinem nächsten Glas. Damit sind es jetzt etwa fünf zu viel, falls irgendwer mitzählt. Dann fliegt die Tür auf, und die Leute in der Kneipe recken den Hals. Ich brauche mich nicht einmal umzudrehen, um zu wissen, dass es Matty ist, denn in einer Bar wie dieser fällt er auf wie ein bunter Hund. Im nächsten Moment legt sich ein Arm spielerisch auf meine Schulter und um meinen Nacken. Ich nehme sein Aftershave wahr, bevor dann sein Gesicht meines berührt. Das ist jetzt der Punkt, an dem ich wohl vor ungebremster Begeisterung in Ohnmacht fallen sollte.
»Hallo, Schöne. Was hat es mit dieser deprimierenden Bar-Nummer auf sich?«
Matty Queenan ist ein Wall-Street-Broker, dessen Job ich nicht wirklich beschreiben kann, weil ich diesen finanziellen Hokuspokus nie ganz verstanden habe, den diese Kerle abziehen. Ich verstehe daran nur, dass es sich um ein Spiel ohne Regeln handelt: Du tippst für deine Kunden auf einen Sieger, dann wettest du hinter ihrem Rücken darauf, dass sie verlieren, und wenn dann alles in den Arsch geht, ist der kleine Mann gelinkt, dir selbst aber hilft die Regierung aus der Patsche.
»Willst du einen Drink?«, frage ich Matty.
»Hier? Nein. Gehen wir irgendwohin, wo es nett ist.«





























