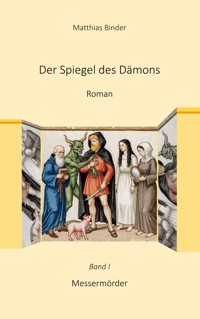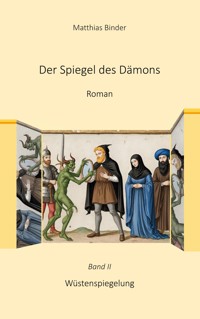Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Ist nicht Abraham der Vater des Glaubens? Warum sichert er sich dann ein Leben lang ab mit Vertragsschlüssen und Manipulation? Wird er das Vertrauen noch lernen? Und wussten Sie, warum er und seine Sara als das erste Prophetenpaar des einen Gottes angesehen werden? Lockere und tiefgehendere Erzählungen werden in "Ohrenschmaus" mit Tischgemeinschaft und Kulinarik verbunden. Man kann für sich allein in ihnen schmökern, aber man kann hier auch als Gruppe das Leben zentraler biblischer Figuren miterleben. Endlich wieder einmal im Zusammenhang, ohne Zensur der pikanten Passagen. Ohne Umgehung moderner Kritik, aber auf der Suche nach Sinn. Man liest in je einem Kapitel - oder hört an je einem Abend - von Sara und Abraham, Jakob oder Joseph, ebenso Elia, Jeremia oder Daniel, Tobit, Maria oder Paulus. Auf diesem Weg rückt die biblische Geschichte wieder in die Nähe ihrer Ursprünge - die Lagerfeuer und Märkte des Orients. Das Buch ist sowohl Erwachsenenbildung als auch narrative und inkulturisierende Theologie. Somit knüpft es nicht zuletzt an die These Walter Hollenwegers an, dass das Erzählen zur Methode der Theologie gehöre. Die sofort verwendbaren Erzählungen sind ergänzt mit Ideen zur Gestaltung von kulinarischen Erzählabenden. Denn die Gaumenfreude macht das Hören erst recht zum Ohrenschmaus.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Aperitif
Ohrenschmaus und Gaumenfreude
sowie Kochanweisung
Sara und Abraham
Jakob
Josef
Elia
Jeremia
Daniel und die Makkabäer
Tobit
Paulus
Maria
Digestif
Nachwort und Nachweise
Aperitif
Ohrenschmaus und Gaumenfreude
Biblische Geschichten zu hören ist etwas Lustvolles. Sie sind spannend, haben etwas Sinnliches. Und sie gehören dahin, wo die Geschichten entstanden und ihren ursprünglichen Platz haben: Treffpunkte und Märkte, Freizeitorte und Essplätze. Und in der Welt erwachsener Menschen. Das ist die Idee dieses Buches.
Daher sind seine Erzählungen fürs Wirtshaus entstanden. Eingeladen wurde zum morgenländisch-kulinarischbiblischen Abend, und es wurde je eine biblische Figur neu erzählt im Wechsel mit einem Vier-Gänge-Menü. Welches natürlich eine orientalische Note hatte. Klar, dass bei Jakob eine Linsensuppe vorkam und bei Tobit ein Fischgericht. Und dass Elia auch einmal mit einem Fladen Brot auskommen konnte, mit Kräutertunke, wogegen das Versöhnungsmahl Josefs mit seinen Brüdern üppiger ausfiel. Ging die Reise mit Tobias nach Persien, dann war der Reis safrangefärbt, und wir fanden Berberitze daruntergemischt. Waren wir mit Paulus in Griechenland und in Rom, konnten auch Souvlaki und Pizza Napolitana auf dem Tisch stehen.
Liebe geht mitunter durch den Magen, auch die Liebe zur Bibel. Die biblischen Gestalten sind ganz normale Menschen, die Gefühle haben und sogar gern essen. Die etwas Neues – und sei es der Glaube – erst ausprobieren müssen. Mit ihnen identifiziert man sich gern. Die Erzählabende dauerten nicht unter drei Stunden und wurden den Gästen – einmal im Jahr – nicht langweilig.
Geformt wurde die Bibel natürlich im Schreibhaus. Aber es ist unmöglich, dass ihre Erzählungen hier geboren wurden. Dafür sind sie zu lebendig, zu phantasie- und humorvoll. Wer selbst gern erzählt, merkt bei mancher biblischer Formulierung, wie sie beim Erzählen spontan entstand, weil der Erzähler merkte: das Detail brauche ich jetzt noch, sonst bleibt es unlogisch oder unverständlich. Fürs Verlesen in Gottesdiensten in liturgischer Sprache entstanden die Geschichten jedenfalls nicht, auch nicht zur Meditation in Bibelstunden (obwohl auch das mit Lustgewinn verbunden sein kann). Sie sind auch nicht in erster Linie für den Kindergottesdienst und den Religionsunterricht der Grundschule gemacht. Seltsamer Weise gehören sie, die doch wirklich nicht sehr jugendfrei sind, heute zum pädagogischen Standardprogramm für Kinder, dagegen fast gar nicht zum Gemeindegottesdienst und zur Arbeit unter Erwachsenen. Wir gewöhnen uns an, all das wegzulassen, was für Kinder als zu harte Kost erscheint, noch bevor wir überlegen, was die Erzählung an sich sagt.
Die Neuerzählung biblischer Gestalten in einem Band führt auch dazu, dass größere Linien sichtbar werden, selbst wenn die ganz Großen wie Mose, David und Jesus hier kein Kapitel haben. Josefs ambivalente Beziehung zu Ägypten ist bei Abraham im Kleinen vorgeprägt; mit neu erwachten Ägypten-Hoffnungen setzt sich Jeremia kritisch auseinander. Die Assyrer sind bei Elia noch fern, zu Tobits Zeit sind sie an der Macht, Jeremia kennt sie nur noch im Rückblick. Elias Feind Baal taucht bei Daniel als Bel wieder auf; und Daniels visionäre Schreckensfrist der 3½ Jahre wieder in der Vision der himmlischen Maria. Paulus versucht Juden mit den Griechen zu versöhnen, welche ihnen in der Makkabäerzeit ein Gräuel waren. Und die Erwartung des gerechten Königs zieht sich von Jeremia über die Makkabäer bis zu Jesus.
Aber das sind nur einige interessante Details. Die Geschichten biblischer Personen sind identitätsstiftend und glaubensfördernd. Wie gut, wenn man sie einfach erleben kann mit seinen Sinnen und inmitten einer plaudernden Gesellschaft.
Lese- und Kochanweisung
Die neun Geschichten von Sara und Abraham, Jakob, Josef, Elia, Jeremia, Daniel, Tobit, Paulus, Maria sind natürlich auch in anderen Zusammenhängen lesens- und hörenswert. Wer das möchte, gehe gleich zu den Kapiteln über, oder suche die bereits vorhandenen Hörfassungen bei YouTube auf. Doch zugeschnitten sind sie so, dass sie an einem Abend erzählt werden können. Hier variieren Dramatik und Plauderton, humorvolle und hintergründige Passagen. Sie sind immer in drei Blöcke aufgeteilt, oft mit wechselnden Erzählerperspektiven. Wer sie vorträgt, sollte durch Auswahl Schwerpunkte setzen. Etwa 20 min. pro Erzählteil sind angemessen, einmal dürfen es auch 30 werden. Den Passagen, die gekürzt werden können, ohne dass der Zusammenhang gestört wird, geht in diesem Buch ein *Sternchen voraus; ein Kreis° schließt sie ab. Aufgepasst, manche Erzählungen sind leichter verdaulich – Jakob, Josef oder Tobit –, manche brauchen vielleicht einen geübten Magen – die Gerichtspredigt des Jeremia oder die komplexe Doppel-Erzählung von Daniel und den Makkabäern zum Beispiel.
Wechselnde Erzählperspektiven lassen sich durch wechselnde Kostüme oder Accessoires bei den Vortragenden kennzeichnen, oder durch Einsatz mehrerer Mitwirkender. Ein ärmel- und knöchellanges Herrenkleid, Turban, Fez oder „Pali“, ein Frauenschleier, Gehänge am Ohr oder Handgelenk oder etwas Henna passen natürlich, wenn nicht eine Decke oder Strickjacke es tun sollen.
Es finden sich durchaus interessierte Wirtsfamilien, deren Köche und Köchinnen sich über die Möglichkeit freuen, einmal Rezepte mit orientalischer Note zusammenzustellen und zu kochen. Zur Unterstützung gibt es biblische Kochbücher und den Suchbegriff orientalische Küche. Vielleicht möchte auch jemand mitkochen, der selbst aus den Ländern des Orients herstammt.
Sehr appetit- und gesprächsanregend für die ankommenden Gäste ist es, wenn sie die Vorspeisen – Mezze natürlich – schon vorfinden, bevor es richtig losgeht. Dazu kann Fladenbrot gehören zum Eintunken in Olivenöl und dann in Dukka oder Za’tar – herzhaft herbe orientalische Kräutermischungen. Oliven, gefülltes oder geschmortes oder mariniertes Gemüse, Taboule, Zwiebeln in Tamarinde, überbackener Schafskäse, Teigtäschchen, Hummus, Zaziki und andere Dips zum Brot… Mezze sind eine Welt für sich. Den ganzen Abend gab es dazu unbegrenzt Wasser aus Krügen, vielleicht auch Minztee aus Kannen.
Es folgen vielleicht zweitens Suppe und drittens Fleischgericht, oder Fisch und dann Fleisch, vielleicht Fischsuppe und dann Geflügel – je nach Aufwand, den man treiben will. Lamm passt fast immer, mag aber nicht jeder. Mitunter haben wir zumindest Lamm und Kalb gemischt. Die Bällchenform und die Suppenform sind bei Fisch wie Fleisch eine gute Möglichkeit, größere Portionenzahlen zu bewältigen. Man darf vermuten, dass es im Orient bei der Bewirtung von Gästen normalerweise Fleisch gab, aber vegetarische Varianten werden vom heutigen Publikum bekanntlich gewürdigt: mit Feta oder Falafel, reisgefüllten Weinblättern oder Auberginen – Dolmas eben. Schwein, Hase und Krabben dürfen natürlich nicht sein! Abgesehen von der Pauluserzählung vielleicht.
Orientalisch wirken die Hauptgerichte durch Beilagen wie Couscous, Reis, Hirse, Linsen, Kichererbsen, weiße Bohnen. Zutaten wie Sesam, Pinienkerne, Mandeln, Pistazien, Rosinen, Aprikosen, Granatapfelkerne. Gemüse wie grüne Bohnen, Auberginen, Okra, Stangensellerie, Paprika. Kräuter und Gewürze wie Korianderblätter und -samen, Kardamom, Minze, Zimt, Knoblauch, Schwarzkümmel, außerdem alles, was rot färbt und scharf schmeckt. Und dann ist es immer gut, wenn noch einiges dabei ist, das uns Westeuropäern nicht fremd ist.
Und die Nachspeisen erst – Baklava oder Halva tischt man vielleicht beim ersten Mal auf. Aber dann entdeckt man, dass es auch noch Zimteis und Sternfrucht und Granatapfel gibt, oder Datteln mit Ziegenkäseparfait und Walnüssen, oder Pistazien-Gebäck mit Mandelmilch oder Nusspudding, oder Knabbernüsse zu süßem Schwarztee oder Kardamomplätzchen mit türkischem Kaffee…
Orientalische Musik haben wir nur einmal eingesetzt während des Essens, und festgestellt: es besteht so viel Redebedarf, dass kaum jemand sie hört. Anders die Deko, die wird wahrgenommen. Abrahams Sternenhimmel oder Josefs ägyptischer Wüstensand auf den Tischen, Elias Ginsterzweige oder die persönliche Gewürzsaatmischung der Saras: alles, was Sinne und Phantasie anregt, tat gut beim Ankommen und zwischendrin. Nur wenn alles da ist im Sinne von „alles“ – dann wird es zu viel.
Manchmal hatten wir das Lokal für uns allein, manchmal das Nebenzimmer. Auch ein Gemeindehaus geht natürlich, wenn man alles selbst machen will oder einen Caterer hat – aber es nimmt den Charme eines öffentlich frequentierten Orts. Der Preis kann günstig gehalten werden, weil nur eine Speisenfolge vorzubereiten ist und wenn 30 bis 50 Personen kommen. Wasser und Pfefferminztee gehen inklusive, andere Getränke werden extra kassiert – ein guter Kompromiss zwischen Küche und Kundschaft. Ein bisschen was kosten darf es das Publikum übrigens schon – es ist das Geld wert. Oder man verschenkt hie und da einen Essensgutschein.
Dass jede und jeder die Gestaltung und das Erzählen letztlich nach eigenem Geschmack und eigener Meinung verändern möge, braucht fast nicht gesagt zu werden.
Und nun zur kulinarischen Lektüre – Guten Appetit dabei, oder auch: gesegnete Mahlzeit!
Sara und Abraham
Vorspeise
Sara erzählt
Erster Gang
Abraham erzählt I
Zweiter Gang
Abraham erzählt II
Dessert
Sara erzählt
Sarai, meine Herrin! Höre ich, hingehaucht. Ach Abraham, du schmeichelst ja nur! Gebe ich zurück.
Doch, du bist die Herrin, gebiete, und ich gehorche! Säuselt er.
Wenn’s dich glücklich macht. Sage ich.
Er: He, weißt du, was Sarai bedeutet?
Ich weiß es. Es bedeutet „meine Herrin“. Nun denn, mein Knecht: Geh und kehr die Scherben aus dem Laden!
Abrahams Miene ändert sich schlagartig: Aber das doch nicht! Das ist nicht romantisch! Du verdirbst es schon wieder.
Ich herrsche ihn an: Ich nehme dich beim Wort, dann folge du auch meinem Wort!
Er: Da ist sie, Sarai, die Streitsüchtige.
Gerade noch bedeutete Sarai „meine Herrin“. Aber wenn die Herrscherin wirklich herrscht, heißt es „die Streitsüchtige“. Leider gaben mir meine Eltern einen Namen mit zwei möglichen Bedeutungen.
Liebe Gäste, so, wie ich gerade erzähle, kann es zugehen in einer Ehe. So muss es auch zwischen mir und meinem Mann gewesen sein. Aber das ist lange her. Dann hat Gott Klarheit geschaffen und mich umbenannt in Sara, das bedeutet Herrin. Eindeutig. Das war an dem Tag, als Gott mir sagte, ich würde einen Sohn kriegen. Und seit das Kind dann wirklich da war, nennen mich alle Sara. Ich habe inzwischen aber gelernt, dass man es nicht alleine dem Ehemann und den Leuten überlassen soll, wer man ist – mal Herrin, mal Streitsüchtige. Sondern dass man das lieber mit sich selbst ausmacht, oder höchstens vielleicht auch mit Gott zusammen, aber niemand sonst.
Bis heute ist mir übrigens mein Name manchmal ein Rätsel. Herrin! Was kann man denn je in seinem Leben selbst bestimmen? Freie Wahl des Aufenthaltsorts? Nein. Ich wäre gern in unserem schönen Zuhause in Haran geblieben – aber ich konnte nicht wählen. Das hat Abraham übernommen. Und er hat gesagt: wir gehen fort, in die Fremde. Abraham sagt wiederum: das habe Gott so bestimmt und auch er habe nur gehorcht. Und in der Tat, anders als Gott es bestimmt, geschieht gar nichts im Leben. Da bist du keineswegs die Herrin.
Tja, und nun – auch wann das Ende kommt, kannst du nicht selbst bestimmen. Jetzt verbringe ich also die Tage und vor allem die Nächte hier in Hebron und kann kaum etwas tun. Tags lasse ich mir im Zelt einen Brei geben und nachts schaue ich unter freiem Himmel die Sterne an. Was gibt es noch anderes für eine 127 Jahre alte Frau? Abraham ist liebevoll zu mir, aber er ist noch älter und auch er hat keine Zähne mehr, und sieht so schlecht, dass er mir die Sternbilder nicht mehr zeigen kann. Ich fühle mein Ende kommen, und er wird noch ein paar Jahre haben.
Dabei hat mit den Sternen alles angefangen. Das wussten Sie vielleicht nicht. Das erzählen sich eher die Juden und die Moslems, und nicht so sehr die Christen, dass es mit den Sternen anfing. Abraham, der aufstrebende Philosoph aus der Stadt Ur ganz weit am unteren Euphrat, wo man die Sternenkunde studiert. Abraham, der dann zu uns nach Haran kam, in die Stadt seiner Väter. Und mich heiratete. Und die Sterne weiter beobachtete. Und zu dem Schluss kam, sie können einfach keine Götter sein, die Sterne. Denn sie unterliegen selbst einer Ordnung. Abraham, der trotzdem für seinen Vater Terach Sternengötterfiguren aus Ton verkaufen musste. Bis eines Tages mein Schwiegervater in seinen Laden kam und erschrak: Da lagen alle Tonfiguren zerschlagen und zerstreut. Bis auf eine: das war die, die einen Stab in der Hand hielt. Daneben ein interessiert schauender Abraham.
Was soll das? Hat Terach erschüttert geschrien. Der große Gott da hat die anderen Götter mit seinem Stab zerschlagen. Antwortete Abraham.
Das kann er nicht, das sind alles bloß Tonfiguren! Hat Terach geschrien.
Stimmt, es sind Tonfiguren und keine Götter. Es gibt sie nämlich nicht. Hat Abraham geantwortet.
Und da bin ich ein wenig stolz auf ihn. Da fällt sein Ruhm auch ein wenig auf seine Frau ab. Mein Mann – der, der erkannte, dass es nur einen Gott gibt. Ich unterstütze ihn darin, und man hat mich dafür eine Prophetin genannt. Abraham hat gemeint, dass man sich unter Gott etwas ganz anderes vorstellen muss als Figuren oder Sterne, nämlich jemand, der über allem steht. Und weil nur einer über allem stehen kann, kann es Gott auch nur einmal geben.
Wie gesagt, das sind so die Geschichten, die manche erzählen. Ich war ja nicht dabei im Laden, als es die Scherben und den Streit gab, aber ich erzähle es auch gerne. Weit realer als diese Geschichten war für mich, dass ich wegen dieses unsichtbaren einen Gottes meine Heimat aufgegeben habe und nun in Kanaan zuhause bin. Man ist also selten Herrin über sein eigenes Leben. Wahrscheinlich geht es Ihnen auch nicht viel anders. Was nicht heißt, dass wir unzufrieden sein müssen.
Seither ist unser Leben ein Nomadenleben. Mit Schafen und Ziegen und vielen Hüte-Knechten. Mit Milch und Käse und Milch-Mägden. Mit Zelten und Vorratsbeuteln und mit ein paar Trage-Eseln. Ein Leben immer auf der Suche nach neuen Weideplätzen und mit Streit um die neuen Weideplätze. Streit gibt es nicht nur mit den Sesshaften, den Städtern, denen wir als Gesindel gelten. Sie können nicht sehen, dass wir eine eigene großartige Kultur und eine ziemliche wirkungsvolle Familien-Organisation haben. Abraham ist ja kein unbedeutender Mann, sondern Patriarch eines großen Menschenverbundes. Aber trotzdem, das wollte ich sagen – Streit gab es trotzdem nicht nur mit den Städtern, sondern auch unter uns selbst.
Und zwar war Lot mitgekommen aus Haran. Lot, das ist Abrahams Neffe. Doch irgendwann war er und waren auch seine Hirten gar nicht mehr zufrieden. Die Herden wuchsen, es wurde zu eng, die Konflikte häuften sich. Am Ende blieb nur die Trennung und eine grundsätzliche Aufteilung der Weidegebiete. Wer geht in welche Himmelsrichtung? Wir hätten das Los entscheiden lassen können. Abraham ließ Lot entscheiden, ganz der bescheidene Philosoph. Lot wählte die Gegend um die Stadt Sodom. Damit hatte er das saftigere Weideland. Aber das war von kurzer Dauer. Dann wollte er es nicht einmal mehr haben. Bald gab er seinen Beruf auf und wurde wieder Städter. In Sodom und Gomorrha gibt es nämlich Pech, und das war für die Leute ein Glück und machte sie reich. Das klingt paradox für Sie. Mit Pech meine ich das, was man aus dieser pichend-zähen schwarzen Flüssigkeit im Boden gewinnt. Das Zeug ist brennbar wie Öl. Aber Öl ist es ja nicht, Öl ist etwas pflanzliches, man macht es aus Oliven. Für die schwarze Flüssigkeit sollte man vielleicht das Wort Steinöl oder Erdöl erfinden. Einstweilen nennen wir es Pech.
Lot suchte also in Sodom das Glück, aber er hatte zuerst mal kein Glück. Feinde kamen und eroberten die Stadt und nahmen die Bewohner einschließlich Lot gefangen. Sein Glück war dann sein Patriarchen-Onkel. Abraham hat ihn und die Stadt gerettet, aber das soll er ihnen einmal selbst erzählen, ich mag die Kriegsgeschichten nicht so.
Dann konnte Lot in der Stadt Fuß fassen. Er hat dort geheiratet und zwei Töchter bekommen. Und hat am Ende noch viel Schrecklicheres erlebt als den Krieg: nämlich den totalen Untergang. Die Stadt Sodom gibt es heute nicht mehr. Und Lots Frau lebt nicht mehr. Sie steht jetzt als Salzsäule zwischen all den anderen Salzsteinformationen beim Südufer des Toten Meeres, wo Sodom gestanden hatte. Aber alles der Reihe nach. Obwohl wir Lot nie mehr sahen, hat sich doch einiges herumgesprochen.
Man erzählt, dass Lot in seinem Sodomer Haus eines Tages Besuch bekommen hatte, zwei hübsche junge Männer. Er hat sie natürlich gastfreundlich aufgenommen. Du bist ja ganz schön gastfreundlich! Haben sie gesagt, und haben geheimnisvoll dazu gesagt: also gibt es doch noch einen Gerechten in Sodom. Aber nicht genug Gerechte. Die Stadt wird deshalb untergehen, sagten sie zu Lot, also packt alle Sachen zusammen. Ihr müsst heute noch fliehen.
So sagten sie. Dieser Zusammenhang zwischen dem Untergang der Stadt und der Meinung, dass zu wenige Gerechte in der Stadt lebten, das beschäftigt mich. Das beschäftigt auch Abraham, das merke ich, wenn ich ihn darauf anspreche. Er macht dann nur ein nachdenkliches M-Hm wie einer, der nicht mehr sagen will.
Ach, und wenn ihr flieht, so sagten dann die zwei Männer zu Lot, wenn ihr flieht, dürft ihr auch nicht zurückschauen, das würde euch versteinern. So wie die Menschen dieser Stadt versteinert und verhärtet sind. Findet ihr? Hat Lot gefragt. Findet ihr Sodom so schlimm?
Wie zur Antwort hörte man laute Schläge an der Tür. Lot schaute hinaus und fand einen Mob von Leuten. Sie hatten von den zwei hübschen Gästen gehört, und nun wollten sie – da steigt mir die Schamesröte ins Gesicht – sie wollten die zwei jungen Gäste zum Sex haben. Lot konnte das natürlich nicht zulassen, man kann seine Gäste nicht den Leuten als Sexspielzeug ausleihen. Das wäre die Schande jedes Gastgebers. Was den Leuten so einfällt, da fällt einem nichts mehr ein. Wenn es da immer so zuging, dann war Sodom wirklich schlimm. Aber nun war der Mob schon fast dabei, das Haus zu stürmen. Sie wollten sich die zwei Männer selbst holen. Da fiel Lot in seiner Not nichts anderes ein, als dem Mob stattdessen seine eigenen zwei Töchter anzubieten.
Schauen Sie, da kann man jetzt fragen, warum erzählt Sara Ihnen die Geschichte von Lot? Was hat Lot mit mir zu tun? Aber das kann ich Ihnen erklären: hier sehen Sie bereits den Stellenwert von Frauen bei uns. Das hohe Gut der Gastfreundschaft steht zum Beispiel höher als die eigenen Töchter. Sagen Sie bitte nicht, dass sei bei Ihnen besser geregelt. Jede Kultur ist, wie sie ist, das hat alles Gründe. Aber dass ich als Frau bei dieser Geschichte so meine eigenen Gefühle habe, können Sie sich denken. Kultur hin oder her. Sie werden nachher sehen: in Wahrheit ist das auch meine eigene Geschichte. Aber schlimme Sachen erzählt man lieber von anderen als von sich.
Aber für Lots Töchter war es auch eine Rettungsgeschichte. Die zwei Gäste in Sodom haben sich nämlich als zwei wahre Wundermänner entpuppt. Bevor den Mädchen etwas geschah. Von diesen Wundermännern ging eine ungeheure Gewalt aus, wie, sagen wir, vom Erzengel Michael. Ihre Kraft wirkte, der Mob wich, die Steine wichen, die Stadt bebte, die Pechfelder rissen auf, Feuer griff um sich, das viele Pech war jetzt wirklich ein Pech, unterirdische Höhlen voll von Brennstoff unter der Stadt. Jeder rannte orientierungslos herum, versank in Boden und Feuer. Die zwei Männer führten Lot und seine Familie sicher hinaus. Sie schauten nicht zurück, sondern, wie man es in der Not machen soll, vorwärts. Nur Lots Frau drehte sich dann doch einmal um nach ihrer Heimat. Und das war der Moment, in dem sie zum Salzstein wurde, so wie auch diese Stadt nur noch ein Steinhaufen ist, verhärtet, versteinert, wie die Engel gemeint hatten.
Ich habe mit meiner, sagen wir, steinernen Schwägerin teils Mitgefühl, teils auch nicht. Ich hatte genauso an meiner Heimatstadt Haran gehangen, ich hatte mich damals auch umgedreht, als ich sie verlassen musste. Ich habe aber gelernt, in der Fremde hat man andere Möglichkeiten, in einem gewissen Sinn bleibt man beweglicher. Immer zurückschauen kann wirklich hart machen.
Jetzt bin ich gerade einmal in Hebron, und lange bleiben werde ich hier auch nicht mehr. Aber nicht weil wir bald aufbrechen. Ich bin alt. Meine letzte Reise steht bevor. Bald werden sie mich in die Erde legen. Oder vielleicht in eine Höhle. Abraham redet zurzeit öfter von so einer Idee, dass er die Höhle von Machpelá als Grabhöhle kaufen will. Wenn er das tut, dann werde ich darin liegen wie in einem Mutterleib. Fast als wäre ich wieder in dem Mutterleib, aus dem ich kam.
Mein eigener Mutterleib blieb lange, lange leer. Es war sehr schwer, das auszuhalten. Doppelt schwer: Denn als Gott in Haran meinen Abraham aufgefordert hatte in die Fremde zu gehen, hat er ihm ja Land verheißen und Nachkommen. Aber ich wartete und wartete, und es gab keine Nachkommen. Ich überlegte, ob dieses Versprechen Gottes falsch war, und ob es dann überhaupt auch falsch war, nach Kanaan zu gehen.
Doch Nomaden waren wir jetzt nun mal. Immer wieder woanders. Einmal sogar in Ägypten. Da war nun auch Abraham wirklich nicht mehr Herr seiner selbst, da war nur die blanke Not. In Kanaan herrschte Hungersnot. Ägypten ist schon immer der Kornspeicher unserer orientalischen Welt, da treten Wasser und Schlamm des Nils jährlich über die Ufer und das Land wird fruchtbar und feucht. Also gingen wir nach Ägypten.
Tja, und da bin ich an dem Punkt: Manches scheint bei uns über dem Wert einer Frau zu stehen. Ich wollte es Ihnen nicht erzählen, die Erinnerung macht mich einerseits ganz hilflos, andererseits beschämt sie mich sehr. Aber bevor ich sterbe, muss es doch einmal gesagt sein.
Diesmal war ich die Frau, die einem Fremden zur... Verfügung gestellt wurde. Der Fremde war in diesem Fall der Herrscher Ägyptens, der Pharao. Mein Abraham, mein Philosoph, mein Verfechter eines höchsten Gottes, mein Familienpatriarch – bot mich dem Pharao an, aus Angst um sein Leben. In seiner philosophisch-ethischen Abwägung kam er offenbar zu dem Schluss, dass der mögliche Tod schlimmer wiegt als die Schande und die Verletzung einer hergegebenen Ehefrau. Ich weiß nur, dass es so schlimm war für mich, dass ich es anschließend nur vergessen wollte – und vergessen musste, wenn ich viele weitere Jahrzehnte mit Abraham als meinem Ehemann verbringen wollte.
Also, es kam so: Abraham und ich hatten Hunger, und wir mussten um Getreide beim Pharao vorsprechen. Weil ich jung und hübsch war, bestand die Gefahr, dass der Pharao mich nehmen würde, und vorher meinen Ehemann umbringen würde, damit er ihm nicht im Weg stand. Um das zu vermeiden, behauptete Abraham, ich sei seine Schwester. Dann konnte der Pharao, wenn er wollte, mich nehmen ohne zu morden, und Abraham würde sogar noch zum vermeintlichen Schwager werden und reich beschenkt werden.
Der Pharao wollte.
Mein Mann hat mich also verleugnet, damit er überlebt und damit die Familie – welche Familie? - wieder eine wirtschaftliche Grundlage hat. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, diese Verleugnung, oder danach die Vergewaltigung durch den Pharao, die aus seiner Sicht natürlich keine Vergewaltigung war, aus seiner wohlgemerkt, oder dass ich dem Pharao dann eigentlich auch egal war inmitten seines großen Harems, oder dass ich am Ende wieder zurückgegeben wurde wie ein Fehleinkauf.
Hier, beim Erzählen, merke ich gerade etwas: Nicht nur weil es schlimm war habe ich nie darüber geredet. Sondern ich fürchtete mich auch davor, dass jemand sagt: „Siehst du, du hast es überstanden, dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Es gibt Schlimmeres“. Solche Kommentare möchte ich mir sparen. Falls zum Beispiel Sie solche Gedanken gehabt haben sollten.
Geholfen hat mir nur einer, und das war der eine Gott. Der besitzt offenbar ein Rechtsgefühl. Denn man weiß ja am Ende selbst nicht mehr, was richtig und falsch ist. Man denkt sich dann: Es geht vielen Frauen so, es gibt viele Harems, vielleicht muss es einfach so sein. Aber nach dem, wie Gott es gelenkt hat, konnte jeder sehen: es sollte eben nicht so sein. Gott hat es schlau eingerichtet, und zwar so: Seit ich Pharaos Frau war, eine von seinen Frauen, hat es den Pharao überall gezwickt und gezwackt. Gesundheitlich, finanziell, politisch... da hat er angefangen nachzudenken, seit wann es ihn so zwickt. Und das war, seit ich beim ihm war. Ein Pharao hat ja auch seine Methoden und seine Erfahrung. Er hat also herausgefunden, dass mit mir etwas nicht stimmen kann und hat mein Umfeld überprüft, und hat in Erfahrung gebracht: der Fehler war der, dass ich in Wahrheit schon mit einem anderen verheiratet war. Und der Pharao hat Abraham zur Rede gestellt wegen des Betrugs. Er hat mich aber auch Abraham zurückgegeben und hat uns fortgeschickt, weil er – wie er sagte – mit den Göttern keinen Ärger mehr haben wollte wegen mir. Für ihn waren es die Götter gewesen, die das Recht wieder herstellen wollten, für mich war es der eine Gott. Dem werde ich das nie vergessen. Den Pharao und mich hat etwas verbunden: Wir haben beide gemerkt, dass es ganz schön daneben gehen kann, wenn man sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, wenn man Gott spielt, so wie Abraham es getan hatte.
So. Jetzt ist es heraus, was mit mir als Frau geschehen ist. Und was war dann? Tja, das darf ich dann auch nicht verschweigen.
Dann war mir nämlich alles egal, dann habe ich das auch einmal ausprobiert, Gott zu spielen. In der Not, sagte ich mir, sind alle Mittel recht. Wir hatten immer noch keine Kinder. So sagte ich mir: wenn das mit Abraham und mir nichts wird, dann sorgen wir auf andere Art dafür. Wir besorgen eine Leihmutter. Eine Magd namens Hagar suchte ich mir dafür aus und schickte sie zu Abraham aufs Nachtlager. Der schickte sie wieder fort. Nun wurde ich zur Herrin und wurde streitsüchtig zugleich und bedrängte Abraham so lange, bis er nachgab und mit Hagar ein Kind zeugte. In Hagars Mutterleib wuchs ein kleiner Ismael heran. Der sollte unser aller Kind werden.
Um es kurz zu machen: es ging daneben. Es gab einen Gefühlsmix: Mein Triumph, mein Glück über einen gelungenen Coup. Mein Neid auf die werdende Mutter, meine Beschämung, weil sie mich auslachte, ihr Triumph, und meine Wut. Es gab dauernd Streit, und am Ende brachte ich Abraham dazu, dass ich machen durfte mit Hagar was ich wollte. Ich wollte sie in die Wüste schicken, ich wollte das Geschehene wieder auslöschen. Allerdings war das noch ein größerer Fehler als der erste. Eine Schwangere in die Wüste zu schicken, das ist quasi ein Gottesurteil, selbst wenn man ihr Wasser und Brot mitgibt. Wenn eine das überlebt, dann nur mit Gottes Hilfe. Es mischte sich noch das schlechte Gewissen zu meinen Gefühlen. War ich vielleicht auch noch an ihrem Tod schuld?
Hagar fand mit Gottes Hilfe zurück, wir waren gezwungen, sie aufzunehmen, der kleine Ismael wurde geboren. Erneut eine Niederlage, auch Gott gegenüber. Das Gottesurteil stand gegen mich. Aber als ich kapierte, dass Ismael einmal Erbe werden würde, hielt ich es trotzdem nicht mehr aus. Wir schickten diesmal alle beide, Mutter und Sohn, in die Wüste.
Keine Sorge, zwischenzeitlich haben wir erfahren, dass beide noch am Leben sind. Gott hat ihnen offenbar noch einmal beigestanden. Ich war insgeheim froh, es zu hören. Aber mein Gewissen ist seither noch schlechter. Wenn Gott Hagar beigestanden hat, heißt das wohl, ich war im Unrecht. Ich muss mir eingestehen, dass meine Lösung keine Lösung war. Meinem ersehnten Kind brachte mich das keinen Schritt näher. Wann immer ich Abraham Vorwürfe mache, wie er die Frauen behandelt, muss ich mir nun genau denselben Vorwurf gefallen lassen. Und ich kann nur hoffen, dass die Welt einmal besser klar kommt mit der Rollenverteilung von Männern und Frauen.
Und trotzdem hat dann ein guter Stern über meinem Leben gestanden.
Sie merken, wie ich mich ausdrücke; der alte Glaube an die Sterne steckt noch tief in mir drin. Lassen Sie mich also lieber sagen: Gott hat gütig auf uns gesehen. Ich bin mit 90 Jahren noch Mutter geworden. Erst hat Gott es mir vorhergesagt, in Mamre, und dann ist es wahr geworden. Heute ist mein Sohn Isaak längst erwachsen. Und ich heiße, wie gesagt, eine Herrin, das nehme ich in der Bedeutung, dass ich noch irgendwie zu einem Recht und zu einer Ehre gekommen bin. Obwohl ich dann auch noch ganz alt geworden bin und keine Zähne mehr habe.
Für eine Suppe reicht es aber noch aus. Vielleicht wollen Sie ja eine mitessen. Dann setzen Sie sich doch her, ich teile gerne!
Abraham erzählt I
Hebron, Freundchen. Ich glaube, diesmal bleiben wir hier. Irgendwann kommt vielleicht auch das Leben eines Nomaden ans Ziel. Warum nicht in Hebron. Hebron heißt Freundchen. Manche sagen, das hätte etwas damit zu tun, dass Abraham, der gern in Hebron ist, ein Freundchen Gottes ist. Wenn dem so ist, dann bleibe ich erst recht hier. Zuletzt waren wir in Beerscheba. Von dort führt ein Weg hierher. Hier in Hebron heißt der Weg natürlich Beerschebastraße, doch dort in Beerscheba heißt der Weg natürlich Hebronstraße. Dort in Beerscheba an der Hebronstraße ist unser Brunnen. Sie können einmal hinziehen und ihn anschauen, wenn Sie mit ihren Herden dort unterwegs sein sollten.
Doch zuerst werden Sie sicher mich anschauen. Schau, hier ist er: Abraham, der seiner Frau Sara so Unschönes in Ägypten zugefügt hat. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten, auf diese Steilvorlage meiner Frau einzusteigen. Ich könnte alles dementieren. Oder ich könnte mich verteidigen. Ich könnte von mir ablenken und das, was Sara mit Hagar gemacht hat, noch etwas genauer erzählen.
Ich werde versuchen mich nicht zu schonen, und alles bestätigen. Und ich will außerdem bekennen, dass ich den Trick von Ägypten sogar nochmal wiederholt habe. Aber auch hier: alles der Reihe nach.
Nach etlichen Jahren hatten wir beschlossen, an den Rand des Negev zu gehen. Das ist ein Wüstenland im Süden, an der Sinaihalbinsel, man muss schon ein guter Hirte sein, um da mit den Herden klarzukommen. Aber unsere Hüte-Knechte sind auch gute Brunnengräber, mit ihnen kommt man zurecht. Nun, und prompt erging es uns dort, wie es Fremden eben gehen kann. Kaum hatten wir uns einen Brunnen gegraben – so gerade an dem Weg von Hebron her, am Straßenrand, wie gesagt – da kam eine Rotte von bewaffneten Kerlen, sie vertrieben uns und behielten den Brunnen für sich. Man wehrt sich natürlich, aber man muss auch vorsichtig sein und dann gibt man lieber nach. Was tun? Wir versuchten herauszufinden, wer diese Leute waren. Ein Händler half uns weiter. Wir erfuhren: die Bewaffneten waren von der Stadt Gerar gekommen. Die ganze Gegend wurde von Gerar aus kontrolliert. Der Händler beschrieb uns den Weg dahin, so ungefähr mitten in den Gazastreifen hinein. In der Stadt Gerar herrschte der König Abimelech, und Kriegsknechte Abimelechs waren die Leute, die uns unseren neuen Brunnen genommen hatten. Wir sollten uns an König Abimelech wenden, wenn wir etwas wollten. Also gingen wir nach Gerar.
Ich traf meine Vorsorgemaßnahmen wie schon einmal, als ich irgendwo fremd hinkam und nicht genau wusste, ob man mir wohlgesonnen ist. Ich gab also meine Frau Sara als erstes wieder als meine Schwester aus. Und in der Tat, Abimelech erblickte Sara, und wer weiß, was er mir angetan hätte, um sie zu kriegen. Wenn Sie nur einen Blick auf sie werfen könnten, würden Sie verstehen, dass jeder sie haben will. Eine jetzt alte, aber ehrwürdige Frau, wie sie ist, vor allem eine Frau von Stand; ich bin stolz auf Sara. Abimelech würde natürlich nie einem Ehemann seine Ehefrau wegnehmen, bei Ehebruch riskiert in Kanaan sogar ein König göttliche Strafe. Abimelech und mir war jedenfalls klar: Ehebruch würde er nie begehen, aber eine Witwe konnte er ohne weiteres zu sich nehmen. Und ich wollte verhindern, dass sie zur Witwe gemacht wurde. So also, da Abimelech glaubte, sie sei meine Schwester, brauchte er sie nicht zur Witwe zu machen, er ließ er sie einfach in seinen Palast bringen und ließ mich und meine Leute in Frieden.
Da wird es Ihnen vielleicht im Gesäß jucken, dass Sie aufspringen wollen, und sagen wollen: Abraham, tu was für deine Frau! Liefere sie nicht aus! Aber bedenken Sie: Sie sind nicht wir, bei uns nimmt sich der König eine Frau, wenn er sie will, man muss das hinnehmen und das Beste draus machen und manchmal ein Opfer bringen.
Und es war ja nicht gesagt, dass du zum Opfer würdest, Sara, manchmal gibt es einen Ausweg. Und der Ausweg kam so – ich weiß es von Abimelech selbst: nachts, als die Sterne auch über Abimelechs Schlaf wachten, kam Gott zu ihm im Traum und sagte zu ihm: Abimelech, du bist des Todes und alles, was zu dir gehört ist des Todes. Wegen der Frau, die du genommen hast. Denn sie ist die Ehefrau eines Mannes. Und wie gesagt, so etwas darf nicht sein.
Abimelech aber antwortete Gott noch in seinem Traum, so voll Schreckens war er: Ich habe diese Frau noch nicht berührt, sagte er. Das stimmte wirklich. Und Abimelech redete im Traum um sein Leben: Herr, würdest du denn auch gerechte Menschen umbringen? Und außerdem hatte doch Abraham gesagt, sie sei seine Schwester! Ich konnte nicht wissen, was ich da tue! Ich habe doch alles mit reinem Herzen getan und mit unschuldigen Händen.
Dann wieder Gott im Traum: Ich weiß auch, dass du das mit reinem Herzen getan hast. Das hat mir auch gut gefallen, und ich habe dafür gesorgt, dass es nicht zur Tat kommt, und habe es nicht zugelassen, dass du sie berührst. Aber gib nun dem Mann seine Frau wieder, sonst bist du des Todes und alles, was dir gehört.
Als Abimelech früh am Morgen aufwachte, bewies er, dass er ein großer König ist mit einem transparenten Herrschaftsstil, völlig kommunikativ. Er rief alle seine Fürsten zusammen und legte sein nächtliches Gespräch mit Gott offen. Die Fürsten waren sehr betroffen, denn sie gehörten in gewissem Sinne auch dem König; sie waren direkt betroffen von der Todesgefahr.
Dann rief Abimelech auch mich herzu und erzählte es auch mir und stellte mich zur Rede: Warum ich ihm das angetan hätte, und ob er sich je an mir etwas zu Schulden kommen lassen habe, ich hätte ihn ja geradezu verleitet, sich an meiner Frau zu versündigen (scheinheilig war er, nicht wahr?).
Dann verteidigte ich mich: ich erklärte meine Angst, was sie mir vielleicht tun würden, um an Sarah zu kommen, ich hätte ja nicht wissen können, ob in Gerar anständige Leute leben, jetzt wüsste ich es erst, dass sie überaus anständig sind und ihr König am allermeisten (scheinheilig war auch ich, nicht wahr?).
Dann nahm Abimelech Schafe und Rinder, Knechte und Mägde und gab sie alle mir, und gab mir Sara, meine Frau, wieder, und sagte, ich dürfe weiter im Land wohnen bleiben, und gab mir noch tausend Silberstücke, um alles wieder gut zu machen. Er hat sich vor Gott gefürchtet. Ich möchte sogar sagen, der Plan ist aufgegangen. Sara ist nichts passiert, uns allen nicht, wir hatten unser Auskommen, und das alles nur durch diesen kleinen Trick, dich, Sara, als meine Schwester auszugeben.
Ich gebe zu, beim ersten Mal, in Ägypten, ging dieses Spielchen nicht auf. Und ich muss Ihnen sagen, ich weiß nicht mehr, ob ich richtig gehandelt habe. Das heißt, wenn ich mir überlege, wie ich Sara das erklären kann, dann gibt es keine Erklärung. Manche würden vielleicht sagen, ich hätte schon darauf vertraut, dass Gott es zum Guten wendet, und dass Sara nichts passiert, aber wenn ich so ein Vertrauen gehabt hätte, dann hätte ich gleich ohne Tricks arbeiten können. Stattdessen muss ich mich eher als einen Taktierer betrachten, und einen Menschen, der sich absichert.
Auch Verträge dienen der Absicherung. Abimelech und ich, wir haben alsbald einen Vertrag gemacht, einen richtigen Bund geschlossen. Nach alledem waren wir ja nun keine Fremden mehr und lebten in Frieden. Und wenn man verbündet ist, kann man auch ganz anders miteinander umgehen. Wir haben dann nämlich mit Abimelech einen Ortstermin ausgemacht bei dem Brunnen, den unsere Knechte gegraben hatten. Dort konnte ich Abimelech von Aug zu Aug fragen, warum seine Milizen uns von dort vertrieben hatten, und es war ihm sehr peinlich, er hätte gar nichts davon gewusst, sagte er, und wir durften ihn natürlich wieder haben. Wir zwei haben gleich dem Brunnen einen Namen gegeben. Beerscheba haben wir ihn genannt. Be‘er heißt ja Brunnen, und scheba‘ – na ja, scheba‘ heißt sieben und scheba‘ heißt auch schwören. Wir haben uns dort noch mal Bündnistreue geschworen, insofern heißt Beerscheba Schwurbrunnen. Und ich habe meinem neuen Freund dort noch sieben weiße Lämmer geschenkt, als Bündnisgeschenk. So heißt der Brunnen genauso auch Siebenbrunnen. Das habe ich absichtlich so gemacht, denn das kann sich jeder merken: dies ist Abrahams Siebenbrunnen, wo er dem Abimelech sieben Lämmer geschenkt hat. Der Brunnen gehört Abraham, dass das keiner mehr verwechselt. Wir, er und ich, sind seither wirklich friedlich geblieben, und Beerscheba konnte sich zu einer Stadt entwickeln.
*Auch wenn ich mich wiederhole: Wenn sie mal dahin kommen, schauen sie nach dem Brunnen Abrahams, da gibt es einen wie gesagt direkt an der Hebronstraße, Ecke Ha-Atzmautgasse, wo es heißt Abrahams Brunnen, beachtliche 26 Meter tief. – Wie, was sagst du? Moment... Ach so, warten Sie: Sara flüstert mir gerade zu, Sie sollen in Beerscheba nicht in die Hebronstraße gehen, Ecke Ha-Atzmautgasse, wo es heißt Abrahams Brunnen, beachtliche 26 Meter tief. Sondern Sie sollen zu dem Ausgrabungshügel Tell Beerscheba gehen, draußen vor der modernen Stadt, da ist dann wirklich noch ein älterer Brunnen, beachtliche 69 Meter tief. – Wie nochmal? Moment... Ach wissen Sie, Sara sagt, dass man da natürlich auch nicht wissen kann, ob das dann wirklich Abrahams Brunnen ist. Die ist manchmal skeptisch, meine Frau…°
Bünde schließen war mein Leben. Wo ich hinkam, musste ich das tun, so hatte ich auch Erfolg. Melchisedek zum Beispiel, der Priesterkönig von Jerusalem. Also kein normaler Priester, der in sonst eine Priesterhierarchie eingeordnet werden kann, sondern Priester nach einer ganz eigenen Ordnung, ein Einzelfall. Diese Einzelfall-Ordnung nennt man „Ordnung Melchisedek“. In tausend Jahren oder so wird es dann noch einmal einen geben nach der Ordnung Melchisedek, den werden sie Jesus nennen, und das ist dann schon der zweite Einzelfall. Dieser Melchisedek war durchaus mächtig. Ich habe mich auch mit ihm für eine Zeit verbündet und dafür gute Bedingungen ausgehandelt. Das ist schon sehr lange her, und kam so.
Sie wissen, glaube ich, dass ich einen Neffen habe namens Lot, der war nach Sodom gegangen und war dort ansässig geworden, warum, das kann ich ihnen mal bei einem Becher Wein erklären. Sodom war dann überfallen worden und vom Feind besetzt. Da konnte ich nicht anders als Lot herauszuhauen. Ich bin ja nicht nur sein Onkel, sondern verantwortliches Oberhaupt einer ganzen Sippe. Ich habe 350 Kämpfer zusammengebracht, um die Stadt Sodom zu befreien und damit auch Lot. Sie merken, 350, das ist keine furchtbar große Armee, aber doch nicht ganz schlecht. Als Nomade hat man nach und nach schon Beziehungen überall. Ich helfe dir, dann hilfst du mir später auch einmal, das muss man nur oft genug machen, und noch die eigenen Knechte mitbringen, dann kriegst du 350 Kämpfer zusammen. Und in der Stadt waren ja auch die Besatzer geschwächt vom Krieg. Und die Besetzten waren ja auch mit uns gegen die Besatzer. Da haben wir 350 schon gereicht. Wir haben also Lot heraus gehauen, und die Feinde vertrieben. Damals habe ich also meinen Neffen noch einmal getroffen. Und habe nebenbei seine Stadt gerettet. Das gelang mir das zweite Mal nicht, aber das ist eine andere Geschichte.
Nach unserem Sieg von Sodom kamen wir jedenfalls mit unseren Herden in die Nähe von Jerusalem, das wollte ich ja erzählen. Jerusalem, das ist noch so eine mittelgroße Stadt weiter oben in den Hügeln zwischen Juda und Ephraim, mit einem eigenen Kleinkönigtum. Der Stadtkönig war eben jener Melchisedek, von dem ich erzählen wollte, der auch Priester war. Sein Name Melchisedek bedeutet, dass er an einen Gott Melech geglaubt hat. Wir haben diesen Gott – den es, wie ich finde, gar nicht gibt – später Moloch genannt, weil das finsterer klingt als Melech. Wir fanden ihn einen finsteren Gott. Sie wissen vielleicht, dass dem Moloch noch viele Jahrhunderte lang Kinder Jerusalems geopfert wurden. Jerusalem war für mich deswegen keine sympathische Stadt, und wir waren skeptisch, als wir hinkamen. Aber andererseits, wenn wir nun schon einmal da waren, wollte ich schon schauen, ob man hier Zelte aufbauen und Tiere hüten und neue Beziehungen knüpfen kann.
Nun, mein Name war vielleicht doch durch unseren Sieg in Sodom bekannt geworden. Oder vielleicht hatte ich ja schon ein paar Boten vorausgeschickt. Jedenfalls, wir kamen zur Stadtmauer Jerusalems, oder eigentlich Dorfmauer, viel kleiner damals als Sie es kennen. Und sofort kam Melchisedek heraus höchstpersönlich. Mit Gefolge, mit Pauken und Trompeten, und – das kommt vielleicht jetzt etwas abrupt – er segnete mich. Einfach so. Naja, oder doch nicht einfach so.
Er sagte zunächst: „Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, gepriesen sei der höchste Gott, der dir den Sieg in Sodom verliehen hat“. Er segnete mich unter dem Namen des höchsten Gottes, das fand ich nicht schlecht, wo er doch an Melech glaubte.
Ich dagegen zahlte zukünftig Steuern an ihn in Höhe von zehn Prozent. Das war für ihn natürlich auch nicht schlecht. Ich erkannte ihn vorübergehend als Herrscher an, er ließ uns da wohnen. Das Leben besteht aus Tauschhandel. Gott sei Dank; dieser Handel mit Melchisedek hat uns sehr geholfen damals.
Sie werden sich jetzt fragen, das ist doch nicht der Abraham, den wir kennen. Ja, von mir erzählt man Dinge, die ich selbst nicht so genau weiß. Da gibt es einen gewissen Paulus, der sagt, Abraham sei ein großes Vorbild im Gottvertrauen. Abraham und Gott, ein Vertrauensverhältnis ohne Bedingungen sozusagen. Bestimmt hat Paulus gute Gründe, dass er darauf kam. Aber haben Sie in meiner Geschichte bis jetzt irgendetwas gehört, wo ich aus Gottvertrauen heraus gehandelt hätte?
Also gut, Sara hat Ihnen ja gesagt, dass ich aus Gehorsam von Haran weggegangen bin und Nomade hier in Kanaan geworden bin. Das schon. Aber insgesamt, nein, insgesamt handelte ich vielmehr aus Angst um mein Leben, und ich arbeitete mit Tricks und mit Bündnissen. Meine Geschichten sind nicht die des gläubigen Abraham, sondern die Geschichten eines wohlmeinenden einen Gottes.
Höchstens damals, die Nacht unter dem Sternenhimmel. Keine Sorge, das sind für mich keine Götter, die Sterne, ah, das werden Sie wissen, dass ich mich viel mit Sternenkunde befasst habe in meiner Jugend, weil ich ja in Chaldäa aufgewachsen bin. Irgendwann merkt man, dass sie ihren Platz nie verlassen, die Sterne, nicht frei sind, und so können sie nicht Götter sein. Aber davon wollte ich jetzt eigentlich gar nicht reden. Sondern als ich in Kanaan eines Nachts von Gott berührt wurde, und vor das Zelt ging und die Sterne anschaute.
Da waren so viele Sterne, alle an ihrem Platz. Und wo war mein Platz? Wir in der Fremde, eine Gruppe Nomaden. Höchstens Kometen, die unstet am Himmel irren. Vielleicht konnte ich hoffen, dass wenigstens eine Sternschnuppe herunterfällt und mir ein kleines Glück bringt. Das wäre schon viel, ansonsten war ich aufs Kämpfen eingestellt und Verhandeln.
Und dann sagte Gott: Alle Sterne bist du, nicht so eine kleine Schnuppe. Alle. Sie stehen für deine Nachkommen. Da habe ich schon gesagt: Ja, wenn du es sagst. Da will ich darauf vertrauen.
Das war schon ein Moment. Ein Moment mit Zukunft? Glauben statt Händel, wie Paulus sagt? Es ging ja in eine andere Richtung weiter. Zwei Kapitel später habe ich mit Gott einen Bund geschlossen. Ein Bund ist auch ein Vertrag. Vielleicht gibt es auch Bünde ohne Absprachen, Liebesbünde, nur bei den Liebesbünden weiß man vorher nicht, was dabei herauskommt. Wir hatten jedenfalls Absprachen. Ich habe versprochen, mich an Gottes Gebote zu halten. Sichtbarer Ausdruck dafür war das Gebot der Beschneidung – wir haben uns beschneiden lassen, alle männlichen Mitglieder unseres Nomadenhäufleins. Gott hat uns seinerseits Land versprochen, Segen, vor allem Nachkommen, nicht nur einen weiteren Sohn außer Ismael, sondern ein ganzes Volk. Und ich kann sagen, ich meinerseits habe den Bund gehalten, und wir haben bis jetzt immer das nötige Land gefunden, Gott war auch bündnistreu. Und zusätzlich haben dann nochmal die menschlichen Bünde geholfen, mit Lot, mit Melchisedek, mit Abimelech. Ist das Vertrauen, oder sind das nicht doch einfach klare Absprachen? Hält sich einer nicht dran, ist es vorbei mit dem Bund.
Behaupten Sie nicht, Sie Christen und Paulusfreunde wären frei von solchen Absprachen und Bundesschlüssen. Wären Sie in der Lage zu vertrauen ohne Bedingungen? Bünde zu schließen ist lebensnotwendig. Gegenüber Menschen und gegenüber Gott. So ist unser Leben.
Und doch, einmal, einmal, habe ich alles Taktieren sein lassen, und das war der Moment, den ich Sara nie erzählt habe. Ich habe mich bis heute nicht getraut, dir, Sara, zu sagen, warum ich Isaak nach Morija mitgenommen habe, und warum du dich von ihm verabschieden solltest. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit, es dir zu sagen, also muss ich es jetzt tun. Es war nicht nur irgendeine gefährliche Reise. Sondern ich hatte Gottes Stimme vernommen, und Gott hatte mir gesagt, er wollte Isaak wieder haben.
Irgendwie habe ich gewusst: Ich kann das jetzt nicht verhandeln. Ich habe gemerkt: Isaak gehört nicht mir, auch wenn er mein Kind ist. Isaak haben wir nicht uns zu verdanken, wahrhaftig nicht. Ich wünsche keinem Menschen, dass er je in so eine Entscheidungssituation kommt, sich zwischen seinem Kind und Gott zu entscheiden. Es war ja im Grunde auch die falsche Alternative, mein Kind oder Gott. Ich hätte es wohl wissen müssen, dass Gott so etwas nicht durchziehen wird. Sein Kind zu opfern! Wahrscheinlich habe ich nur gedacht, Gott will das wirklich, weil es manchmal für die anderen Götter so gemacht wird, für den Moloch in Jerusalem zum Beispiel. Es wohnen ja nicht wenige bei uns im ganzen Land, die denken, Gott wollte ihr ältestes Kind geopfert haben. Ich dachte zwar, lieber will ich mich selbst hingeben, aber ich habe getan, was ich tun zu müssen glaubte.
Also sind wir losgezogen. Isaak hat sich gefreut, er mochte gern mit mir etwas unternehmen. Auch Brennholz und Feuerzeug und ein scharfes Messer mitzunehmen, so etwas machen die Buben gern. Ich konnte ihn nicht anschauen. Konnte nichts sagen.
Und dann, auf dem Berg Morija, als wir ohne die Knechte alleine weiter gegangen sind, wie er mich gefragt hat: Da ist Holz, da ist ein Messer – aber wo ist das Opfer, wir wollen doch bestimmt ein Opfer bringen? Das... das kommt mir schier nicht über die Lippen. Ich habe… ich habe gesagt, Gott wird uns schon ein Opfer schicken. Und dann habe ich ihn festgehalten, und gebunden, und auf das Holz gelegt, und hatte das Messer schon in der Hand.
Und dann die Stimme – halt ein, Abraham, halt ein, ich weiß, dass du gottesfürchtig bist. Und dann der Widder, der sich im Gestrüpp verfangen hatte und scharrte und schnaubte. Und zu merken, Gott schickt wirklich ein eigenes Opfer, und ich soll nicht meinen Sohn opfern.
Also, Sara, außer dass wir unsere Heimat verließen damals – außer dem war das in Morija wirklich das eine Mal, dass ich ohne Wenn und Aber Gott vertrauen wollte, nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten. Und es war vielleicht genau das falsche Mal. Ich hätte uns den Sohn genommen, und ich habe unser Kind vielleicht für immer traumatisiert. Gott weiß, dass ich ihm treu sein wollte. Ich habe vertraut, dass es richtig ist – und das Vertrauen hat sich erfüllt, aber ganz anders als gedacht.
Du wirst mich für verrückt erklären, Sara. Ist das nicht irre – du tust das Falsche in vollem Vertrauen, und es wird am Ende trotzdem Richtiges draus? Das kommt nicht oft vor. Aber das Ergebnis war so richtig wie noch was: Die Erkenntnis, Gott wollte kein Menschenopfer. Das ist das Ergebnis. Das habe ich gelernt, und das soll es in Israel nie geben. Das kann man Isaak sagen. So gesehen war die Reise nach Morija gut. Opfern heißt bestenfalls sich selbst hingeben für etwas Gutes.
Und dann haben wir uns erstmal gestärkt. Sie werden mir glauben, dass man da eine Stärkung braucht.
Abraham erzählt II
Miteinander Mahlzeit halten, das ist doch etwas Wunderbares. Wie damals in Mamre, als ich aufgeregt zu den Rindern lief, um ein zartes, gutes Tier zu finden, und wie ich es den Köchen gab, und wie sie es in der Küche eilig zubereiteten. Wir hatten Besuch. Das war ein sehr guter Moment in meinem Leben. Aufgeregt war ich, aber danach sehr zufrieden, weil meine drei Gäste zufrieden waren.
Sara, meine Frau, warst du damals genauso zufrieden? Du hast damals das Brot gebacken, bist mit Anstand im Zelt geblieben. Aber du hast mitgehört, das weiß ich, weil du dann gelacht hast.
Es schmeckt sehr fein, sagte kauend mein Besuch.
Das freut mich, mein Herr.
In einem Jahr komme ich wieder.
Jederzeit gerne! Es wird wieder etwas Gutes geben, so Gott will.
Gott will das sicher, sagte mein Besuch. Also, ich komme wieder, und da werdet ihr bereits einen Sohn haben.
Wie meinst du das, mein Herr?
Da haben wir dich lachen hören, Sara. Ich höre dich gern lachen. Obwohl du es nicht zugeben wolltest, weil man ja einen Gast nicht bloßstellen will.
Meines Wissens sind wir uns da einig – Gastfreundschaft ist eines der wichtigsten Dinge. Wir sind auf eine gute Beziehung zu Gästen angewiesen. Das ist so wichtig, wenn man als Nomaden fremd ist, überall wo man hinkommt. Da lacht man Gäste nicht aus, selbst wenn sie einer 90jährigen Frau sagen, sie würde schwanger werden. Wo war ich stehen geblieben? Ja, bei der Gastfreundschaft. Sie ist heilig. Lot, glaub nicht, dass ich dich gar nicht verstehen könnte, als du um der Gastfreundschaft willen deine Töchter… Wir tun seltsame Dinge, wenn wir uns zu etwas verpflichtet fühlen. Und erst hinterher fragen wir uns, ob der Zweck wirklich die Mittel heiligt. Gastfreundschaft.
Und wenn es dann auch noch der Herr ist, der einen besucht… Ich hatte da so schön im Schatten der Terebinthe gesessen. Man sitzt im Schatten und genießt die Kühle und den harzigen Duft. Kennen Sie diesen Baum? Terebinthen, die kennen Sie wohl nicht. Aus dem Harz destillieren wir Terebinthin, aber ich glaube, das kennen Sie auch nicht, bei Ihnen gibt es ja nur den billigen Terebinthin-Ersatz.
Egal, – unter jenem speziellen Baum saß ich also. In Mamre, bei Hebron, wie gesagt, im Westjordanland. Da können Sie den Baum des Abraham besuchen. Der war ja jetzt schon so alt, als ich drunter saß, und wenn Sie da mal hinkommen, dann muss der ja schon bald 4.000 Jahre alt sein. Ich muss aber sagen, Terebinthen gibt es viele, ob das dann wirklich meine Terebinthe ist, die dort gezeigt wird, wer weiß. Vielleicht zeigt man Ihnen sogar eine Eiche. Außerdem, was heißt schon „mein Baum“. Es ist ja ein öffentlicher Platz, jeder kann herkommen zu diesem Gottesbaum in Mamre. Ja, Gottesbaum heißt er in unserer Sprache, also, fast. „Elahim“ heißen die Terebinthen hier, fast so wie Elohim, Gott. Alle kommen zu den Gottesbäumen auf den Hügeln und beten zu ihren Göttern. Manchmal kommen Leute sogar von der Küste, Seefahrer.
Die haben mir mal ihre Geschichte von einem Hyrieus aus Griechenland erzählt, der göttlichen Besuch hatte. Die drei Götter Zeus, Poseidon und Hermes sollen Hyrieus und seine unfruchtbare Frau unerkannt besucht haben. Die zwei Leutchen haben die drei Götter bewirtet, und zehn Monate später hat die Frau endlich ihr Kind gekriegt. Was es alles gibt, nicht wahr? Wenn das stimmt, dann sind meine Sara und ich nicht die einzigen, die das Glück eines göttlichen Besuchs hatten, mit anschließendem Kinderglück. Denn, ich muss sagen: auch unser Besuch stellte sich als göttlicher Besuch heraus.
Nun, an dem Tag waren weiter keine Pilger in Mamre. Ich hatte allein unter dem Baum gesessen, in Gedanken versunken, und da stand plötzlich der Herr vor mir. Alle drei waren sie da. Oder soll ich sagen: Alle drei war er da. Ich kann ja unmöglich von drei Göttern erzählen. Das haben wir hinter uns mit dem Mehrgottglauben, das hat Ihnen meine Sara schon erklärt. Es war aber ein Dreierbesuch. Den habe ich begrüßt.
Mein Herr, habe ich gesagt, wenn ich Gnade bei dir gefunden habe, dann sei mein Gast. Ich bin mir selbst nicht so sicher, ob ich „mein Herr“ wie zu einem Menschen oder wie zu Gott selbst gesagt habe. Oft merkt man ja erst hinterher, dass man soeben Gott begegnet ist. Jedenfalls haben sich die drei angesprochen gefühlt. Ist das nicht ein Ding, dass Sie, soviel ich weiß, auch einen Gott ihren Herrn nennen, der einer ist und doch drei?
Na, und dann kam das andere, wir sind gelaufen, die Gäste zu bewirten, und der Besuch hat uns einen Sohn angekündigt. Und er sagte: Du lachst, Sarai (da hieß sie ja noch Sarai), du glaubst mir nicht. Aber du wirst es nächstes Jahr sehen. Einstweilen sollst du schon einmal Sara heißen. Dass sich alles erfüllt hat, wissen Sie ja schon. Unser Isaak ist inzwischen längst ein stattlicher Mann.
Was ich aber noch erzählen will, das ist, wie die drei dann wieder aufgebrochen sind.
Danke, Abraham, es war fein bei dir, jetzt gehen wir weiter.
Nun, so bleibt doch noch ein bisschen.
Nein, wir haben zu tun.
Aber ihr seid doch müde.
Du hast uns vorzüglich gestärkt.
Habe ich keine Gnade bei euch gefunden?
Du sollst versichert sein, wir wären sehr gern geblieben.
Gut, aber sagt, wohin soll es gehen?
Nach Sodom gehen wir und nach Gomorra.
Nach Sodom? Das kenne ich ja!
Ja, kennst du da denn jemand?
Jaja, mein Neffe wohnt da, Lot heißt er. Mit seiner Familie.
Sie sehen, es ist immer gut, gastfreundlich zu sein. Du weißt vorher nie wozu. Aber schon hast du neue Beziehungen. Du kennst dann jemand, der kennt wieder jemand. Vielleicht kann Lot den dreien etwas Gutes tun, dann habe ich wieder etwas gut bei ihnen. Oder die drei tun dem Lot was Gutes, dann habe ich bei Lot was gut.
Sie denken vielleicht: was ist der Abraham berechnend. Der könnte doch einfach Gäste haben und sich freuen, und fertig. Denken Sie ruhig so. Aber Sie haben leicht denken. Sie leben ja auch in einem Land mit Rechtsstaat, Sozialfürsorge, Arbeitnehmervertretung. Wir leben als Fremde in fremden Ländern. Einfach so Freunde haben, das klingt schön. Aber davon können wir nicht leben. Eine Hand wäscht die andere, anders geht es bei uns nicht. Sie nennen das Vetternwirtschaft, Abhängigkeit, Filz. Aber es ist unsere einzige Sicherheit. Ich merke, ich fange an mich zu verteidigen, das brauche ich nicht. Ach, und ich glaube eigentlich gar nicht, dass bei Ihnen alle Gastfreundschaften so uneigennützig sind. Ich glaube, Sie haben schon auch Ihren Eigennutz.
Ich begleite also meine drei Gäste aus dem Schatten meiner Terebinthe heraus. Ich denke nach – die gehen jetzt also nach Sodom, wo Lot wohnt. Was wollen sie da wohl. Und da merke ich, der eine schaut mich auch so nachdenklich an. Als ob er noch etwas weiß und sich noch überlegen muss, ob er mir es sagen will. Und dann hat er mir tatsächlich gesagt, warum er nach Sodom will. Denn wenn ich eine Beziehung pflegen will, muss ich dem anderen schon immer auch einigermaßen das sagen, was ich weiß. Das hat also mein Besuch eingesehen, und so habe ich die Sache mit Sodom erfahren.
Der Herr sagte: Wir müssen nach Sodom, um zu sehen, ob die Menschen wirklich so gottlos sind, wie man erzählt. Und wenn es so ist, soll auch nichts von dieser Stadt übrig bleiben. So gingen sie los.
Wirklich, der Tag in Mamre mit dem Rindfleisch im Topf war einer meiner besten Momente. Ich dachte an meinen Neffen. Es war meine Chance. Und wie habe ich sie genutzt! Es ging zu wie auf einem orientalischen Markt, jeder ist mit seiner Maximalforderung eingestiegen, man muss gut einschätzen können, mit welcher Zahl man anfängt, ich bin mit 50 eingestiegen.
Ich also rief hinterher: Es könnten einige gute Menschen dort wohnen, dann wirst du doch Sodom nicht untergehen lassen!
Der Herr blieb stehen, während die zwei anderen weitergingen, voraus nach Sodom. Vielleicht waren es auch ein Gott und zwei Engel, meine Besucher, und nicht ein Gott in drei.
Zum Herrn sagte ich: 50. Wenn nur 50 gute Menschen in Sodom sind, dann verschone bitte die Stadt. Der Herr war einverstanden. Aber an 50 Gerechte in Sodom glaubte ich selbst nicht. Das war nur der Einstieg, um ins Geschäft zu kommen. Sofort fügte ich hinzu: nun schau, wenn es nur fünf weniger sind, das wäre ja auch unverhältnismäßig. Herr, ich bin Staub und Asche, wie darf ich wagen, dich etwas zu bitten, aber meinst du nicht, auch wegen nur 45 Gerechten müsste diese Stadt zu retten sein?
Er war einverstanden. Er war auch bei 30 einverstanden. Er war bei 20 noch nicht zornig, dass ich weiter verhandelte. Ich spürte, dass ich noch weiter gehen konnte. Am Ende hatten wir uns geeinigt: Wenn auch nur zehn Personen in der Stadt Sodom als gerecht erfunden