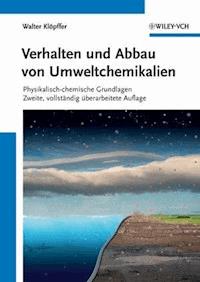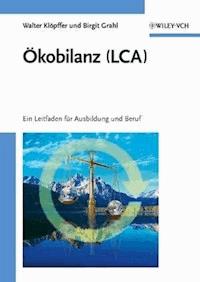
93,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Zeigt anhand eines konsequent durchexerzierten Fallbeispiels (Getränkekarton versus PET-Flasche) das praktische Vorgehen beim Aufstellen einer Ökobilanz nach den international gültigen Standards ISO EN 14040 und 14044. Es ist damit Lehrbuch und Praxis-Leitfaden in einem.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Contents
Vorwort
1 Einleitung
1.1 Was ist eine Ökobilanz?
1.2 Historisches
1.3 Die Struktur der Ökobilanz
1.4 Normung der Ökobilanztechnik
1.5 Literatur und Information zur Ökobilanz
1.6 Literatur zu Kapitel 1
2 Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens
2.1 Zieldefinition
2.2 Untersuchungsrahmen
2.3 Illustration der Komponente „Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens“ am Praxisbeispiel
2.4 Literatur zu Kapitel 2
3 Sachbilanz
3.1 Grundbegriffe
3.2 Energieanalyse
3.3 Allokation
3.4 Datenerfassung, Datenherkunft und Datenqualität
3.5 Datenaggregierung und Einheiten
3.6 Präsentation der Sachbilanz-Ergebnisse
3.7 Illustration der Komponente Sachbilanz am Praxisbeispiel
3.8 Literatur zu Kapitel 3
4 Wirkungsabschätzung
4.1 Grundprinzip der Wirkungsabschätzung
4.2 Methode der kritischen Volumina
4.3 Die Struktur der Wirkungsabschätzung nach ISO 14040 und 14044
4.4 Methode der Wirkungskategorien (Umweltproblemfelder)
4.5 Wirkungskategorien, Wirkungsindikatoren und Charakterisierungsfaktoren
4.6 Illustration der Komponente Wirkungsabschätzung am Praxisbeispiel
4.7 Literatur zu Kapitel 4
5 Auswertung, Berichterstattung und kritische Prüfung
5.1 Entstehung und Stellenwert der Komponente Auswertung
5.2 Die Inhalte der Komponente Auswertung nach ISO
5.3 Methoden der Ergebnisanalyse
5.4 Berichterstattung
5.5 Kritische Prüfung
5.6 Illustration der Komponente Auswertung am Praxisbeispiel
5.7 Literatur zu Kapitel 5
6 Von der Ökobilanz zur Nachhaltigkeitsanalyse
6.1 Nachhaltigkeit
6.2 Die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit
6.3 Entwicklungsstand der Methoden
6.4 Ein Life Cycle Assessment oder drei?
6.5 Schlussfolgerungen
6.6 Literatur zu Kapitel 6
Anhang 1 Lösungen zu den Übungen
Anhang 2 Beispiel: Standardberichtsbogen zum Strommix Deutschland aus UBA 2000, Materialsammlung S. 179 ff.
Liste der Akronyme
Stichwortverzeichnis
Walter Klöpffer und Birgit GrahlÖkobilanz (LCA)
Beachten Sie bitte auch weitere interessante Titel zu diesem Thema
W. Klöpffer, B. O. Wagner
Atmospheric Degradation of Organic Substances
Data for Persistence and Long-range Transport Potential
2007
ISBN: 978-3-527-31606-9
Die Autoren
Prof. Dr. Walter Klöpffer
LCA Consult and Review
Am Dachsberg 56 E
60435 Frankfurt
Prof. Dr. Birgit Grahl
Industrielle Ökologie
Schuhwiese 6
23858 Heidekamp
Alle Bücher von Wiley-VCH werden sorgfältigerarbeitet. Dennoch übernehmen Autoren, Herausgeber und Verlag in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© 2009 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Photokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere von Datenverarbeitungsmaschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden. Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.
Print ISBN 9783527320431
Epdf ISBN 978-3-527-62716-5
Epub ISBN 978-3-527-65992-0
Mobi ISBN 978-3-527-65991-3
Vorwort
Dieses Buch ging aus Vorlesungen an der Universität Mainz hervor.
Das Thema des Buches, die Ökobilanz, entwickelte sich aus bescheidenen Anfängen zu Beginn der 1970er Jahre zur einzigen international genormten Methode der ökologischen Produktanalyse. Die Entwicklung trat in die entscheidende Phase, als die Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) begann, die verschiedenen älteren Methoden zu harmonisieren. Dieser Prozess kam 1993 mit den Guidelines for Life Cycle Assessment: A „Code of Practice“, ein Resultat des SETAC-Workshops in Sesimbra, Portugal, zu einem Zwischenabschluss. Noch im selben Jahr begann die Normungstätigkeit durch die International Organization for Standardization (ISO), die unter Mitarbeit von insgesamt 40 Staaten die mittlerweile berühmte Serie ISO 14040 ff. (1997–2006) herausgab. In Deutschland wurde dieser Prozess vor allem durch den DIN-NAGUS begleitet, in dem die Autoren dieses Buches in den entscheidenden Jahren Mitglieder waren. Hier wurden die von den Expertengruppen des ISO/TC 207/SC 5 erarbeiteten Entwürfe diskutiert und kommentiert und wichtig erscheinende Aspekte auch über die deutschen Delegierten in den Normungsprozess eingebracht. Außerdem wurden die Übersetzungen aus der englischen in die deutsche Sprache bearbeitet und geprüft.
Zu heftigen Diskussionen führte das Thema „Bewertung“, das sich als nur sehr beschränkt konsensfähig erwies und auch in den ISO-Normen als „Gewichtung“ ein Schattendasein als optionaler Teil der Wirkungsabschätzung führt – nicht, wie ursprünglich geplant, als eigene Komponente. Außerdem ist die Gewichtung der Resultate streng verboten für „vergleichende Aussagen, die der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden“. Die Revision der Normen im Jahre 2006 verschärfte diese Position noch etwas, so dass nun schon die Absicht einer öffentlichen Verbreitung solcher Aussagen genügt, um die strengen Bestimmungen in Hinblick auf Berichterstattung und kritische Prüfung in Kraft treten zu lassen.
Die Autoren haben einige kritische Prüfungen nach der Panelmethode gemeinsam durchgeführt und sich dabei gründlicher mit den Normen auseinandergesetzt, als es für die Lehre allein vielleicht nötig gewesen wäre. Wie bei den meisten Normen handelt es sich um sperrige Texte, die schon aus diesem Grund nicht als Lehr- und Lernmaterial infrage kommen. Ein guter Grund dieses Buch zu schreiben, von dem wir hoffen, dass es den Anfängern/-innen den Einstieg in die Ökobilanz erleichtert und auch den Praktikern/-innen noch Neues bietet. Die Ökobilanz-Normen sind in einem Geist verfasst, der jedem Missbrauch der Methode vor allem in Marketing und Werbung vorbeugen soll. Es ist daher sehr oft die Rede davon, was man unterlassen muss, und weniger, wie man eine Ökobilanz konkret durchführen soll. So wird etwa in der Komponente „Wirkungsabschätzung“ keine Mindestliste von Wirkungskategorien vorgeschrieben, von Indikatoren und Charakterisierungsfaktoren ganz zu schweigen. Deshalb wird in diesem Buch besonderes Gewicht auf die Wirkungsabschätzung (Kapitel 4) gelegt. Die methodische Entwicklung ist aber noch im vollen Gang, weshalb wir uns bei einigen Kategorien auf die kritische Darstellung des Status quo beschränken mussten. Leserinnen und Leser werden an zahlreiche Literaturstellen und auch an aktuelle Webseiten verwiesen.
Gleich wichtig wie die Vermittlung der reinen Fakten erschien uns, ein tieferes Verständnis für die Methodik der Ökobilanzierung, einschließlich ihrer Grenzen, zu vermitteln. Dies gilt auch für die Umweltprobleme, die den Wirkungskategorien zugrunde liegen. Die wichtigste Anwendung der Ökobilanz ist das Lernen und Verstehen der Umweltauswirkungen von Produktsystemen „von der Wiege bis zur Bahre“, also von den Rohstoffen bis zum Recycling bzw. bis zur Abfallentsorgung. Dieser Lernprozess kann aber bei mangelhaftem Verständnis, ggf. verschlimmert durch die gedankenlose Benutzung einer Software, nicht in Gang kommen. Moderne Ökobilanzsoftware bietet Erleichterungen in der Durchführung von Ökobilanzen an, von denen wir noch vor 10 Jahren nur träumen konnten; sie darf aber weder die mühevolle Erhebung von Originaldaten noch die gründliche Systemerstellung, noch die Auswahl und Begründung der Wirkungskategorien ersetzen!
Die Ökobilanz bietet als angewandte (vereinfachte) Systemanalyse zweifellos auch viel Stoff für theoretische Arbeiten, die mittelfristig die Methodik bereichern können. Sie ist aber nicht „art pour l’art“, sondern soll in erster Linie den bereits angesprochenen Lerneffekt erzielen, dessen Ergebnisse wiederum in Entscheidungsfindungen einfließen können und sollen. Ökologisch richtige Entscheidungen in der Produktentwicklung werden einen Beitrag zur Verbesserung der Umwelt leisten. Die Anwendung der Ökobilanz ist also von entscheidender Bedeutung. Wir haben daher eine „echte“ vergleichende Ökobilanzstudie in vier Teile aufgetrennt und zur Illustration den vier Komponenten der Ökobilanz (ISO 14040) zugeordnet:
Diese Studie wurde uns dankenswerterweise vom Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU), Heidelberg, zur Verfügung gestellt. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese spezielle Ökobilanz aus rein didaktischen Gründen als Beispiel ausgewählt wurde. Ein konkretes Produktsystem ist immer anschaulicher als ein konstruiertes Beispiel. Konkrete Schlussfolgerungen der Beispiel-Ökobilanz gehören nicht zum Lehrziel, das wir uns mit diesem Buch gesetzt haben.
Zum Titel des Buches ist zu sagen, dass wir der korrekten deutschen Bezeichnung „Ökobilanz“ das für die englische Bezeichnung Life Cycle Assessment stehende Akronym LCA beigefügt haben. Bilanz kommt vom italienischen Wort „bilancio“ für Waage und erinnert an die wirtschaftliche Bilanz, die bis zu einem gewissen Grade auch bei der Ökobilanz Pate stand. Dem Gedanken der Analyse „von der Wiege bis zur Bahre“ entspricht hingegen LCA besser und die durch die Normen nicht gedeckte Eindeutschung „Lebenszyklusanalyse“ wird gelegentlich gebraucht. Diese Übersetzung war vom Vertreter der österreichischen OENORM angeregt worden, wurde aber vom DIN-NAGUS mit der Begründung abgelehnt, dass die aus dem schweizerischen BUS-Bericht von 1984 stammende Bezeichnung Ökobilanz schon in den deutschen Sprachschatz eingegangen sei. Die deutschsprachige Fassung der ISO-Normen 14040/44, die gleichzeitig auch europäische Norm und nationale Norm der Mitgliedsstaaten der CEN ist, beruht auf einer Abstimmung zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie ist für Ökobilanzen, die den Anspruch erheben nach der Norm durchgeführt zu sein, ohne Ausnahme verbindlich. Wir raten daher von der Benutzung einer abweichenden Nomenklatur dringend ab, da sie nur Verwirrung stiftet. Weiterhin zur Sprache: wir haben uns im ganzen Text bemüht, die korrekten deutschen Ausdrücke zu benutzen, konnten aber nicht alle Anglizismen vermeiden. Gewisse Aspekte der Ökobilanz wurden bisher in deutschsprachigen Publikationen nicht oder nicht gründlich behandelt.
Das Buch stellt den ersten Versuch einer deutschsprachigen Einführung in die Ökobilanz dar, die sowohl in der akademischen Lehre wie auch in der beruflichen Praxis gebraucht werden kann – zumindest hoffen wir das. Es schließt sich damit an einige in verschiedenen Sprachen abgefasste Texte an, die im Kapitel 1 zitiert sind. Die Abfassung des Buches war auch eine Gelegenheit, die Entwicklung der Ökobilanz aus der Sicht der deutschsprachigen Länder zu schildern, die in der internationalen Literatur nicht immer genügend gewürdigt wird. Was auch damit zu tun hat, dass zum Unterschied von den skandinavischen Ländern und den Niederlanden wichtige Texte nicht ins Englische übersetzt wurden. Die nunmehr vorliegende deutsche Einführung kommt spät, aber angesichts der in letzter Zeit wieder zunehmenden Beachtung von Umweltaspekten bei Produktion, Konsum, Gebrauch und Entsorgung von Produkten sicherlich nicht zu spät.
Zu großem Dank sind wir Herrn Andreas Detzel von IFEU verpflichtet, der nicht nur das durchgehende Beispiel zur Verfügung stellte, sondern auch das Manuskript gelesen und kommentiert hat. Martina Krüger, ebenfalls IFEU, half uns bei der Anpassung der Beispielstudie an die hier geforderte didaktische Darstellung. Zahlreiche weitere befreundete Kolleginnen und Kollegen aus der Gemeinde der Ökobilanzierer haben im Lauf der Jahre zum Erfolg der Methode und damit auch zur Abfassung des Buches beigetragen. Um nur wenige zu nennen: Harald Neitzel (damals UBA Berlin), der unvergessene Vorsitzende des DIN-NAGUS, Arbeitskreis Ökobilanz; Isa Renner, Hauptsachbearbeiterin und Projektleiterin zahlreicher Ökobilanzen am Battelle-Institut Frankfurt, später bei der C.A.U. GmbH; Almut Heinrich, Gründerin und Chefredakteurin des International Journal of Life Cycle Assessment (ecomed Verlag, jetzt Springer Heidelberg) und die langjährige Diskussionspartnerin Eva Schmincke, Five Winds International, die wesentlich an der Entwicklung der ISO Typ III Umweltproduktdeklarationen (EPD) auf der Basis von Ökobilanzen beteiligt ist.
Last, but not least, danken wir auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Wiley-VCH für ihre Geduld und Kompetenz bei der Erstellung des Buches.
Frankfurt am Main und Heidekamp,
Januar 2009
Walter KlöpfferBirgit Grahl
1
Einleitung
Heute ist die Ökobilanz (LCA) eine über die Normen ISO EN 14040 und 14044 definierte Methode, um Umweltaspekte und -wirkungen von Produktsystemen zu analysieren. An diesen Normen orientiert sich daher auch die Vorstellung der Methode in den Kapiteln 2 bis 5 im vorliegenden Buch. Im Vorfeld werden in diesem Kapitel die Rahmenbedingungen und der Weg der Methodenentwicklung vorgestellt.
1.1 Was ist eine Ökobilanz?
1.1.1 Definition und Abgrenzung
Der Begriff Ökobilanz wurde unseres Wissens erstmals 1984 in der Packstoffstudie des damals so benannten Schweizer Bundesamts für Umweltschutz1) benutzt. Diese Studie hatte einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der Ökobilanzierung, vor allem im deutschsprachigen Raum (s. Abschnitt 1.2), und daraus resultiert der auch in die Umgangssprache eingedrungene Name für eine Methode, die englisch mit Life Cycle Assessment(LCA) viel besser bezeichnet ist. Die Eindeutschung „Lebenszyklusanalyse“ hat sich in den offiziellen Normen nicht durchgesetzt, wird aber gelegentlich gebraucht. Weil das Wort Ökobilanz vielfach auch für betriebliche Umweltbilanzen benutzt wird, hat man im Zuge der Normung beim DIN (Deutsches Institut für Normung) die genauere Bezeichnung „Produkt-Ökobilanz“ bzw. „produktbezogene Ökobilanz“ erwogen, schließlich aber in der mit Österreich und der Schweiz abgestimmten deutschsprachigen Fassung der Norm wieder fallengelassen.
In der Einleitung der internationalen Rahmennorm ISO 14040 2) wurde die Ökobilanz wie folgt definiert:
„Die Ökobilanz ist eine Methode zur Abschätzung der mit einem Produkt verbundenen Umweltaspekte und produktspezifischen potentiellen Umweltwirkungen … Die Ökobilanz-Studie untersucht die Umweltaspekte und potentiellen Umweltwirkungen im Verlauf des Lebenswegs eines Produktes (d. h. von der Wiege bis zur Bahre) von der Rohstoffgewinnung, über Produktion, Anwendung bis zur Beseitigung.“
Ähnlich wie die International Standard Organization (ISO) hatte bereits 1993 die Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) im „Code of Practice“3) die Ökobilanz (LCA) definiert.
Ähnliche Definitionen finden sich weiterhin im Grundsatzpapier des DINNAGUS4) und in den Richtlinien, die im Auftrag der skandinavischen Umweltminister erarbeitet wurden, den „Nordic Guidelines“5)
Die bewusste Beschränkung der Ökobilanz auf die Analyse und Auswertung der von den Produktsystemen ausgehenden Umweltwirkungenbringt es mit sich, dass die Methode nur einen, nämlich den ökologischen Pfeiler der Nachhaltigkeit quantifiziert6) (vgl. Kapitel 6). Die Ausgliederung der ökonomischen und sozialen Faktoren grenzt die Ökobilanz (LCA) von der Produktlinienanalyse (PLA) und ähnlichen Methoden7) ab. Die Abgrenzung erfolgte, um die Methode nicht zu überfrachten, wohl wissend, dass eine Entscheidung z. B. im Bereich der Entwicklung nachhaltiger Produkte diese anderen Faktoren nicht außer Acht lassen kann und soll8).
1.1.2 Der Lebensweg eines Produkts
Der zentrale Gedanke einer Analyse von der Wiege bis zur Bahre (cradle-to-grave), also des Lebenswegs, ist stark vereinfacht in Abb. 1.1 dargestellt. Ausgangspunkt zum Aufbau des Produktbaumes ist in diesem Bild die Herstellung des Endproduktes und die Nutzungsphase. Die weitere Aufschlüsselung der Kästchen in Abb. 1.1 in einzelne Prozesse, sog. Prozessmodule, die hier nur angedeutete Einbeziehung der Transporte, der verschiedenen Formen der Energiebereitstellung, der Hilfsstoffe usw. machen aus dem einfachen Schema selbst bei scheinbar einfachen Produkten sehr komplexe „Produktbäume“ (verschiedene Rohstoffe für Materia lien und Energiebereitstellung, Zwischenprodukte, Hilfsstoffe, Abfallmanagement mit verschiedenen Beseitigungsarten und Recycling).
Abb.1.1 Stark vereinfachter Lebensweg eines (materiellen) Produkts.
Die miteinander verbundenen Prozessmodule (der Lebensweg oder Produktbaum) bilden ein System, in dessen Mittelpunkt ein Produkt, ein Prozess, eine Dienstleistung oder – in der allgemeinsten Formulierung – eine menschliche (ökonomische) Tätigkeit (human activity9)) steht. In der Ökobilanz werden Systeme analysiert, die eine spezielle Funktionerfüllen und dadurch einen Nutzen haben. Daher ist auch der Nutzen eines Systems der eigentliche Vergleichsmaßstab für Produktvergleiche und die einzig korrekte Basis für die Definition einer „funktionellen Einheit“10).
1.1.3 Die funktionelle Einheit
Neben der Analyse „von der Wiege bis zur Bahre“, also dem Denken in Systemen, Lebenswegen oder Produktbäumen, ist die „funktionelle Einheit“ der zweite grundlegende Begriff der Ökobilanz und soll daher bereits an dieser Stelle anhand eines einfachen Beispiels erläutert werden:
Der Nutzen einer Getränkeverpackung ist neben dem Schutz des Füllgutes vor allem die Transport- und Lagerfähigkeit. Als funktionelle Einheit definiert man hier meist die Bereitstellung von 1000 Liter Flüssigkeit in einer Weise, dass der Nutzen technisch erfüllt wird. Diese Funktion kann nun beispielsweise von
5000 0,2-L-Beuteln,
2000 0,5-L-Glasmehrwegflaschen,
1000 1-L-Einwegverbundkartons,
500 2-L-PET-Einwegflaschen
erfüllt werden, wobei die konkreten Verpackungsbezeichnungen willkürlich gewählt wurden. Zum Vergleich der Verpackungssysteme muss also der Lebens weg von 5000 Beuteln, 2000 Glasmehrwegflaschen, 1000 Kartons und 500 2-Liter-Einwegflaschen analysiert und verglichen werden, also vier Systeme, die in grober Näherung denselben Nutzen erfüllen.
Dass der Nutzen dabei nicht immer genau gleich ist (Bequemlichkeit, z. B. Gewicht, Benutzerfreundlichkeit, Ästhetik, Konsumverhalten, Eignung einer Verpackung als Werbeträger und andere Nebennutzen von Verpackungssystemen), braucht bei diesem einfachen Beispiel nicht zu stören. Wichtig ist die Feststellung, dass Systeme mit vergleichbarem Nutzen, nicht aber die Produkte selbst verglichen werden11). Dadurch kann man auch materielle Produkte (Güter) mit Dienstleistungen vergleichen, sofern diese denselben oder einen sehr ähnlichen Nutzen haben. Produkte werden in der Ökobilanz als „Güter und Dienstleistungen“ (goods and services) definiert. Da auch bei Dienstleistungen Energie gebraucht wird, Transportleistungen erbracht werden usw., kann man auch Dienstleistungen als Systeme definieren und mit materiellen Produktsystemen auf der Basis eines äquivalenten Nutzens (quantitativ über die funktionelle Einheit) vergleichen.
1.1.4 Die Ökobilanz als Systemanalyse
Die Ökobilanz basiert, anders ausgedrückt, auf einer vereinfachten Systemanalyse. Die Vereinfachung besteht in einer weitgehenden Linearisierung (vgl. Systemgrenzen und Abschneidekriterien in Abschnitt 2.2). Die real immer vorliegende Vernetzung vieler Teile der Lebenswege von Produkten führt beim Versuch der Modellierung oft zu äußerst komplexen Zusammenhängen, die entsprechend schwierig zu handhaben sind. Es gibt allerdings Möglichkeiten, Schleifenbildungen und andere Abweichungen von der linearen Struktur z. B. durch iterative Näherungen oder mit Hilfe der Matrizenmethode12) zu behandeln.
Die Systemanalyse sowie die sinnvolle Auswahl und Definition der Systemgrenzen ist daher ein wichtiger und arbeitsaufwändiger Schritt in jeder Ökobilanz (vgl. Kapitel 2).
Die Betrachtungsweise „von der Wiege bis zur Bahre“ hat vor allem den Vorteil, dass bloße Verschiebungen der Umweltbelastung (sog. trade-offs), z. B. bei Substitutionen, leicht erkannt werden können: Es nützt nichts, wenn ein Umweltproblem scheinbar dadurch gelöst wird, dass an anderen Orten, später oder in anderen Lebenswegabschnitten oder Umweltmedien zusätzliche Probleme auftreten, oder ein völlig unangemessener Energie- und Ressourcenverbrauch mit der Maßnahme verbunden ist. Solche Maßnahmen sind Scheinlösungen. Damit soll nicht bestritten werden, dass in Einzelfällen, vor allem bei akuter Gesundheitsgefährdung (z. B. bei der Substitution von Gefahrstoffen), solche suboptimalen Lösungen getroffen werden müssen.
1.1.5 Ökobilanz (LCA) und betriebliche Umweltbilanz
Die Gefahr der Problemverschiebung besteht immer dann, wenn zu enge räumliche oder zeitliche Systemgrenzen gewählt werden. Dies ist oft bei alleiniger Durchführung einer betrieblichen Umweltbilanz (oft etwas irreführend „Betriebs-Ökobilanz“ oder gar „Ökobilanz“ ohne erklärenden Zusatz genannt) der Fall. Wenn man z. B. die Systemgrenze mit dem Firmenzaun gleichsetzt, wird man dem Grundgedanken der Ökobilanz nicht gerecht: Es werden weder die Produktion angelieferter Waren noch die Entsorgung der Produkte berücksichtigt. Auch zum ordnungsmäßigen Betrieb gehörende Transporte (just in time), Auslagerung von Aktivitäten (outsourcing) und Teile der Abfallentsorgung, z. B. bei Benutzung kommunaler Kläranlagen, werden nicht erfasst.
Dennoch ist die Erstellung einer betrieblichen Umweltbilanz für viele Zwecke nützlich, zum Beispiel als Datenbasis eines Umweltmanagementsystems14).
Eine einfache Überlegung zeigt, dass betriebliche Umweltbilanzen auch für Produkt-Ökobilanzen die Datenbasis darstellen: Jeder Prozess zur Herstellung eines Produktes, z. B. 500 g Kartoffelsalat im Schraubdeckelglas, findet an einem bestimmten Ort in einem bestimmten Betrieb statt. Wenn Daten, z. B. zum Energie- oder Wasserverbrauch des Systems „1000 Schraubdeckelgläser mit je 500 g Kartoffelsalat mit Gurke, Ei und Joghurtsoße“, ermittelt werden sollen, muss jeder an Herstellung und Transport des verpackten Produktes beteiligte Betrieb sowie Betriebe, die an der Entsorgung der Verpackung beteiligt sind, die jeweils dort ablaufenden Prozesse so analysiert haben, dass sie auf das Produkt zuzurechnen sind. Das ist nicht trivial: So produziert ein landwirtschaftlicher Betrieb in der Regel nicht nur Milch, die Molkerei nicht nur Joghurt, der Glashersteller fertigt Gläser für unterschiedliche Kunden usw. Wenn allerdings alle Betriebe, die an der Produktion beteiligt sind (Akteurskette), bereits eine Betriebs-Ökobilanz mit produktzurechenbaren Daten hätten, könnten diese Ergebnisse zusammengefügt werden. Die produktbezogene Datenerfassung ist allerdings in betrieblichen Umweltbilanzen nicht die Regel.
Die Verknüpfung solcher betrieblicher Umweltbilanzen entlang der Lebenswege von Produkten würde prinzipiell die Möglichkeit zu einem (LCA-)„Akteurs kettenmanagement“ eröffnen15): Die an einem Produktsystem beteiligten Akteure könnten gemeinsam Optimierungspotenziale ausloten und realisieren. Dabei besteht die Hoffnung, dass sich auch auf diese Weise das Denken – und letztlich das Handeln – in Lebenszyklen realisieren ließe (Life Cycle Thinking und Life Cycle Management – LCM).
1.2 Historisches
1.2.1 Frühe Ökobilanzen
Die Ökobilanz ist eine relativ junge Methode, aber nicht ganz so jung wie viele glauben. Ansätze zu einem Lebenszyklusdenken finden sich schon in der älteren Literatur. So hat der schottische Ökonom und Biologe Patrick Geddes bereits in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ein Verfahren entwickelt, das als Vorläufer der Sachbilanz gelten kann16). Sein Interesse galt der Energieversorgung und hier speziell der Steinkohle.
Die ersten Ökobilanzen im modernen Sinn wurden um 1970 unter der Bezeichnung „Resource and Environmental Profile Analysis (REPA)“ am Midwest Research Institute in den USA durchgeführt17). Wie bei den meisten frühen Ökobilanzen oder „proto-LCAs“18) handelte es sich um die Analyse des Ressourcenverbrauchs und der Emissionen von Produktsystemen, sog. Inventare ohne Wirkungsabschätzung. Solche Studien werden heute meist als Sach-ÖkobilanzStudien19) bezeichnet. Die ersten mit Hilfe der neuen Methodik vergleichend untersuchten Systeme bezogen sich auf Getränkeverpackungen. Dasselbe gilt für die erste in Deutschland durchgeführte Ökobilanz20). Diese Studie wurde unter Leitung von B. Oberbacher 1972 am Battelle-Institut in Frankfurt am Main durchgeführt. Sie baute auf der von Franklin und Hunt vorgeschlagenen Methodik auf und erfasste zusätzlich die Kosten, u. a. auch der Entsorgungsmaßnahmen. Es ist interessant zu sehen, dass damals bereits bei den Milchverpackungen der leichte Polyethylen-Beutel oder -Schlauch am besten abschnitt, ähnlich wie bei neueren Studien21).
Weitere frühe Ökobilanzen wurden von Ian Boustead in Großbritannien22) und von Gustav Sundström in Schweden23) durchgeführt. Auch die ersten Arbeiten zur Schweizer Studie24) reichen bis in die 1970er Jahre zurück. Sie wurden an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Versuchsanstalt (EMPA) in St. Gallen durchgeführt, vgl. die Erinnerungen von Paul Fink, dem damaligen Leiter der EMPA25).
1.2.2 Umweltpolitischer Hintergrund
Es drängt sich die Frage auf, warum gerade um 1970 die Entwicklung der Ökobilanz einsetzte. Dafür scheint es mindestens zwei Gründe zu geben:
Während der erste Punkt von den zuständigen Behörden in die damals erst entstehende Umwelt-Politik eingeführt wurde, ist Punkt zwei durch einen Bestseller ins allgemeine Bewusstsein gerückt worden, nämlich „Die Grenzen des Wachstums“ oder der Bericht an den Club of Rome26). Das ungeheure Aufsehen, das dieses Buch bei seinem Erscheinen 1972 erregte, zeigt, dass das Thema „in der Luft lag“. Man spricht heute von einem Paradigmenwandel: die Wegwerf- und Konsummentalität der Nachkriegsgesellschaft war plötzlich in Frage gestellt. Die Wirklichkeit hat die Theorie schnell bestätigt in Form der ersten Ölkrise von 1973/74. Die in der Studie zu gering angenommenen Erdölvorräte führten zu einer Unterschätzung der Zeit bis zu ihrer Erschöpfung; die Studie war in dieser Hinsicht also zu pessimistisch, zeigte aber die Verwundbarkeit unserer ölabhängigen Industriegesellschaft. Daran hat sich bis heute nichts geändert, im Gegenteil!
Die Systemanalyse, schon länger in Spezialistenkreisen bekannt, hatte ihren Durchbruch zur allgemein akzeptierten Methode geschafft. Das International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) in Laxenburg bei Wien wurde gegründet. In Deutschland gab es autofreie Sonntage, die auch eingehalten wurden (!), und eine heute kaum mehr vorstellbare Aufbruchsstimmung mit einer Fülle von Ideen, wie alternative Energiequellen genutzt werden könnten und mit konventionellen Energieformen sparsamer umgegangen werden kann. Manches davon wurde verwirklicht, das meiste (noch) nicht.
1.2.3 Energieanalyse
Vor diesem vor allem energiepolitischen Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass auf der theoretischen Seite zunächst die Energieanalyse oder Prozesskettenanalyse entwickelt wurde, die auch ein wichtiger Teil der Sachbilanz (Kapitel 3) ist27). In Deutschland erfolgte diese Entwicklung vor allem in der Schule von Prof. Schaefer an der TU München28), aber auch in der Industrie29). Der über alle Stufen des Lebensweges aufsummierte (Primär-) Energieaufwand wurde früher vorwiegend „Energieäquivalenzwert“ genannt. In neuerer Zeit hat sich die Bezeichnung kumulier ter Energieaufwand (KEA) (vgl. Abschnitt 3.2.2) durchgesetzt30).
Mit der politischen Lösung der Ölkrisen ging in den 1980er Jahren das Interesse an Ökobilanzen bzw. deren Vorläufern zunächst zurück, um am Ende des Jahrzehnts wieder – völlig unerwartet – stark zuzunehmen.
1.2.4 Die 1980er Jahre
Zu den wenigen Arbeiten in der ersten Hälfte der 1980er Jahre (im deutschsprachigen Raum) zählte die schon gewürdigte Studie des Bundesamts für Umweltschutz (BUS), später Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern31), die Dissertation von Marina Franke an der TU Berlin32) und die Entwicklung der „Produktlinienanalyse“ (PLA) durch das Öko-Institut33). Die PLA geht insofern über die Ökobilanz (LCA) hinaus, als eine Bedarfsanalyse (BA) vorangestellt wird und die produktbezogene Umweltanalyse durch die Analysen der sozialen (SA) und ökonomischen Aspekte (ÖA) des Produktsystems ergänzt wird:
Die PLA umfasst daher die drei Säulen der Nachhaltigkeit im Sinne der Brundtland-Kommission34) (vgl. Kapitel 6) und der Agenda 2135), die auf der Weltkonferenz der UNO, Rio de Janeiro 1992, verabschiedet wurde.
1.2.5 Die Rolle der SETAC36)
Die starke Zunahme des Interesses an der Ökobilanz in Europa und Nordamerika – wo die Bezeichnung Life Cycle Analysis bzw. Assessment geprägt wurde – führte 1990 zu zwei internationalen Tagungen, die als Startpunkt der neueren Entwicklung gelten können:
Die Society for Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC) organisierte einen Workshop A Technical Framework for Life Cycle Assessment in Smugglers Notch37), Vermont (August 1990). Einen Monat später fand ein europäischer Workshop zum selben Thema in Leuven statt38).
In Smugglers Notch wurde das berühmte LCA-Dreieck der SETAC konzipiert, von Spöttern auch als „holy triangle“ bezeichnet (Abb. 1.2). In den Jahren 1990– 1993 waren SETAC und SETAC-Europe die führenden Akteure in der Entwicklung und Harmonisierung bzw. beginnenden Standardisierung der Ökobilanz (LCA). Die Workshop-Berichte39) gehören zu den wichtigsten Informationen über die Methodenentwicklung und wurden im deutschsprachigen Raum nur durch die „Oekobilanzen von Packstoffen 1990“40) übertroffen, die 1996 und 1998 aktualisiert wurden41). Weiterhin sehr einflussreich in Deutschland war der UBA-Text von 199242). Eine Darstellung der Historie und Methodik aus französischer Sicht wurde von Antoine Blouet und Emmanuelle Rivoire unter dem Titel „L’Écobilan“ publiziert43).
Die besondere Rolle des von Prof. Helias Udo de Haes geleiteten Umweltzentrums der Universität Leiden (CML) wurde in einer wissenschafts-soziologischen Studie von Gabathuler44) und mit einem Sonderheft des International Journal of Life Cycle Assessment45) gewürdigt. Die größte Leistung des CML war zweifellos die stärkere Berücksichtigung ökologischer Aspekte in der früher mehr „technokratisch“ ausgerichteten Ökobilanz. Dabei soll jedoch nicht vergessen werden, dass schon die ältere Schweizer Ökobilanz eine einfache Methode der Wirkungsabschätzung aufwies46). Die CML-Methode führte in der Praxis zu einer Überbetonung der chemischen Emissionen, während die prinzipiell in der Wirkungsabschätzung enthaltene Übernutzung der mineralischen, fossilen, biologischen und Land-Ressourcen mangels allgemein anerkannter Indikatoren in den Hintergrund trat47) (vgl. Kapitel 4).
1.3 Die Struktur der Ökobilanz
1.3.1 Die Struktur nach SETAC
Der erste Versuch, eine Struktur in die Ökobilanz zu bringen, war das bereits erwähnte SETAC-Dreieck von 1990/91 (Abb. 1.2).
Abb.1.2 Das ursprüngliche SETAC-Dreieck und die Erweiterung in den LCA-Guidelines („Code of Practice“)48).
Die ursprünglich drei Komponenten nach SETAC 1990/91 lauteten 1992 in der deutschen Fassung nach UBA Berlin49):
Sachbilanz (Inventar) (
Inventory
),
Wirkungsbilanz (
Impact Analysis
),
Schwachstellen- und Optimierungsanalyse (
Improvement Analysis
)
Hier bedeutet Sachbilanz, früher Inventar genannt, eine Stoff- und Energieanalyse des untersuchten Systems von der Wiege bis zur Bahre. Das Ergebnis der Sachbilanz ist eine Tabellele (inventory Tabelle), in der alle Massen- und Energieinputs und -outputs aufgelistet sind (vgl.Abb. 1.3 und Kapitel 3).
Abb.1.3 Stoff und Energieanalyse eines Produktsystems.
Die „nackten Zahlen“ der Sachbilanz bedürfen einer ökologischen Analyse oder Gewichtung. Inputs und Outputs werden entsprechend ihrer Wirkung in der Umwelt sortiert. So werden beispielsweise alle in der Sachbilanz ermittelten Emissionen in die Luft zusammengefasst, die zum sauren Regen beitragen (vgl. Kapitel 4). Dieser Arbeitsschritt wurde von SETAC zunächst als Impact Analysis, später als Impact Assessment bezeichnet. Im Deutschen änderte sich die Bezeichnung von „Wirkungsbilanz“ zu Wirkungsabschätzung.
Die Auswertung der in der Ökobilanz ermittelten Daten wurde bereits in Smugglers Notch gefordert und Improvement Analysis genannt und später in Improvement Assessment umbenannt. Die Einführung dieser Komponente wurde als großer Fortschritt betrachtet, weil damit die Interpretation der erhobenen Daten definierten Regeln folgte. Das Umweltbundesamt (UBA) Berlin hat diesen Arbeitsschritt in seine Empfehlung zur Durchführung von Ökobilanzen 1992 optional aufgenommen. Die Regeln zur Interpretation wurden später im Verlauf des ISO-Normungsprozesses modifiziert (vgl. Abschnitt 1.3.2). Diese Komponente wird heute als Auswertung bezeichnet50) (vgl. Abb. 1.4).
Abb.1.4 Komponenten einer Ökobilanz nach ISO EN 14040 (1997 und 2006).
1.3.2 Die Struktur der Ökobilanz nach ISO
Die von SETAC entwickelte Struktur wurde im Wesentlichen bis heute beibehalten, wobei die Normung durch ISO51) lediglich die Komponente Improvement Assessment durch „Interpretation“ (Auswertung) ersetzte. Die Optimierung von Produktsystemen wurde von ISO nicht in die genormten Inhalte übernommen, sondern neben anderen möglichen Anwendungen der Norm aufgeführt. Diese in der internationalen Norm enthaltene Struktur ist in Abb. 1.4 dargestellt.
Die Bezeichnungen der einzelnen Komponenten wurden gegenüber früheren Strukturen etwas geändert und lauten nun in der verbindlichen deutschen Fassung:
Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens,
Sachbilanz,
Wirkungsabschätzung,
Auswertung
Die Pfeile im Diagramm (Abb. 1.4) deuten ein mögliches iteratives Vorgehen an, was oft auch erforderlich ist (vgl. Kapitel 2). Direkte Anwendungen einer Ökobilanz liegen außerhalb des Rahmens der genormten Komponenten einer Ökobilanz.
Dass die direkten Anwendungen einer Ökobilanz außerhalb des Rahmens der genormten Arbeitsschritte einer Ökobilanz liegen, ist sinnvoll, da sich neben den zum Zeitpunkt der Normentstehung bereits absehbaren Anwendungen in der Praxis weitere Möglichkeiten entwickelt haben, die unter „sonstige Anwendungen“ subsumiert sind. Einige Beispiele sind Tabelle 1.1 zu entnehmen.
Tabelle 1.1 Beispiele für Anwendungen einer Ökobilanz nach ISO 14040.
Anwendung
Fragestellung
Projektbeispiele
Umweltrecht und -politik
Verpackungsverordnung
Altölverordnung
gentechnisch veränderte Organismen (GVO)
Landwirtschaft
PVC
öffentliches Beschaffungswesen
integrierte Produktpolitik
Getränkeverpackungen
52)
Altolverwertungswege
53)
GVO in der Landwirtschaft-LCA
54)
Beikrautbekämpfung Weinbau
55)
PVC in Schweden
56)
Kosten/Nutzen-Analysen umweltorientierter Beschaffung
57)
EuP-Richtlinie
58)
Produktvergleich
Tenside
Getränkeverpackungen
Lebensmittelverpackungen
Fußbodenbeläge
Isolierungsmaterialien
ECOSOL Sachbilanzen
59)
Verpackungsvergleiche
60)
Verpackungsvergleiche
61)
ERFMI Studie
62)
Gebäudeisolierung
63)
Kommunikation
Konsumentenberatung
Akteurskettenmanagement
ökologisches Bauen
Carbon Footprinting
ISO Typ III Deklaration
64)
PCR: Elektrizitat, Dampf, Wasser
65)
EPD: Bauprodukte
66)
PCR: Klimadeklaration Produkt
67)
klimaneutrales Unternehmen
68)
Abfallwirtschaft
Entsorgungskonzepte
Recycling
graphische Papiere
69)
Kunststoffe
70)
Betrieb
ökologische Bewertung von Sparten
Umweltleistung eines Unternehmens
71)
1.3.3 Bewertung – eine eigene Komponente?
Ein besonderes Schicksal hat der Arbeitsschritt Bewertung, der in der genormten Struktur nicht gesondert ausgewiesen ist. Eine Bewertung wird immer dann nötig, wenn die Ergebnisse einer vergleichenden Ökobilanz nicht eindeutig sind. Ist beim Vergleich zweier Produktsysteme beispielsweise bei System A der Energieverbrauch niedriger, dafür aber die Freisetzung von Substanzen, die zur Gewässereutrophierung und zur Bildung bodennahen Ozons beitragen, höher als beim System B, muss abgewogen werden: Was ist wichtiger? Für diese Entscheidung sind subjektive und/oder normative Wertvorstellungen erforderlich, wie sie im täglichen Leben z. B. bei Kaufentscheidungen bekannt sind72). Daher kann die Bewertung mit naturwissenschaftlichen (oder besser exakt-wissenschaftlichen) Methoden allein nicht durchgeführt werden.
Weil das so ist, wurde auf dem SETAC Europe Workshop in Leiden 199173) vorgeschlagen, Valuation (= Bewertung) als eigene Komponente einzuführen. Dieser Vorschlag wurde vom UBA Berlin74) und später von DIN-NAGUS75) aufgegriffen. Da allerdings subjektive Werthaltungen nicht zu normen sind, wurden methodische Regeln entwickelt, wie der Prozess der Entscheidungsfindung unterstützt werden kann. Im SETAC „Code of Practice“76) wurden diese Regeln in die Unterkomponente der Wirkungsabschätzung eingeordnet. Daran hat auch der Normungsprozess bei ISO nichts geändert. Dort sind die Regeln in die Komponente Wirkungsabschätzung integriert77) (vgl. Abschnitt 4.3). Die abschließende Zusammenfassung der Ergebnisse, die zur Entscheidungsfindung78) hinführt, soll allerdings in der letzten Komponente der Ökobilanz, der „Auswertung“79), stattfinden (vgl. Kapitel 5).
Die Bewertungsdiskussion hatte in Deutschland Ende der 1990er Jahre solche Ausmaße angenommen, dass sich die damalige Bundesumweltministerin Angela Merkel80) einschaltete, der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) eine viel beachtete Stellungnahme veröffentlichte81) und schließlich das UBA Berlin eine ISO-konforme Bewertungsmethodik ausarbeitete82).
1.4 Normung der Ökobilanztechnik
1.4.1 Entstehungsprozess
Die Normen zu Ökobilanzen ISO 14040 und 14044 gehören zur ISO 14000 Familie, die sich mit Umweltmanagement befasst (Abb. 1.5).
Abb.1.5 Das ISO 14000 Modell85).
Das in Deutschland im DIN zuständige Gremium ist der „Normenausschuss Grundlagen des Umweltschutzes“ (NAGUS). Auf internationaler Ebene werden im Technical Committee 207 (TC 207) bei der International Standard Organization (ISO) die nationalen Vorstellungen zusammengetragen und unter Beteiligung aller Länder, die mit ihren Normungsorganisationen Mitglied im TC 207 sind, eine internationale Norm entwickelt. Dieser Prozess dauert in der Regel mehrere Jahre.
Die Normung der Ökobilanz durch nationale Normungsorganisationen83) und vor allem durch die internationale Standardisierungsorganisation ISO wird seit Beginn der 1990er Jahre mit großem Aufwand durchgeführt84). Sie bereitete jedoch erhebliche Schwierigkeiten, weil einzelne Komponenten der Ökobilanz – vor allem die Wirkungsabschätzung und die Auswertung – noch in Entwicklung begriffen waren. Auf der nationalen Ebene haben nur zwei Normungsorganisationen vor der Verabschiedung der ISO 14040 eine eigene Norm zur Ökobilanz entwickelt: AFNOR (Frankreich) und CSA (Kanada). Zur reibungslosen internationalen Verständigung wird heute angestrebt, möglichst eine einzige international akzeptierte Norm verfügbar zu machen und so haben auch Frankreich und Kanada sich in den ISO-Prozess eingebracht.
Die wichtigste Normungsarbeit für Ökobilanzen wird daher bei ISO betrieben. Die Europäische Normung (CEN) und die angeschlossenen nationalen Organisationen übernehmen die Texte von ISO und übersetzen sie in die verschiedenen Sprachen (die CEN-Normen der 14040-Reihe existieren in drei offiziellen Sprachen: Englisch, Französisch und Deutsch). Die Arbeit im DIN-NAGUS und in ähnlichen nationalen Gremien besteht in der Zuarbeit zu den ISO-Arbeits gruppen, in der Erarbeitung und Abstimmung ergänzender Kommentare, in der Übersetzung von ISO-Texten und in ergänzender Normung für spezifisch deutsche bzw. nationale Problemfelder.
Die erste Serie internationaler Ökobilanz-Normen lehnte sich an die Struktur in Abb. 1.4 an:
ISO 14040: Ökobilanz – Prinzipien und allgemeine Anforderungen; internationale Norm 1997;
ISO 14041: Ökobilanz – Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens sowie Sachbilanz; internationale Norm 1998;
ISO 14042: Ökobilanz – Wirkungsabschätzung; internationale Norm 2000;
ISO 14043: Ökobilanz – Auswertung; internationale Norm 2000
1.4.2 Status Quo
Die Überarbeitung der internationalen Normen im Zeitraum 2001–2006 brachte eine Neustrukturierung ohne tiefer greifende sachliche Änderungen86). Die Rahmennorm heißt weiterhin ISO 1404087), enthält aber keine verbindlichen Handlungsanweisungen. Diese sind in der neuen Norm ISO 1404488) zusammengefasst, die nunmehr alle in Abb. 1.4 gezeigten Komponenten der Ökobilanz erfasst.
Dazu kommen zwei technische Berichte (TR) und eine technische Spezifikation (TS), die nur in englischer Sprache vorliegen:
ISO/TR 14047 Illustrative examples on how to apply ISO 14042;
ISO/TS 14048 Data documentation format;
ISO/TR 14049 Examples of the application of ISO 14041 to goal and scope definition and inventory analysis
Diese begleitenden Dokumente sind als Erläuterungen und Hilfe bei der Benutzung der Normen gedacht, haben jedoch selbst keine normative Geltung.
An der ersten Runde im ISO-Normungsprozess nahmen 24 nationale Normungsorganisationen teil, 16 weitere hatten Beobachterstatus. Die Schlussabstimmungen erbrachten über 95 % Zustimmung. Die Ökobilanz ist damit die einzige international genormte Methode zur Analyse der Umweltaspekte und potentiellen Wirkungen von Produktsystemen. Die Normen werden im Abstand von fünf Jahren überprüft. Die Revision von 2006 wird also mindestens bis 2011 Bestand haben.
Auf die sachlichen Inhalte der Normen, auf Vorzüge und Defizite wird bei der Beschreibung der einzelnen Komponenten der Ökobilanz in den Kapiteln 2 bis 5 eingegangen.
1.5 Literatur und Information zur Ökobilanz
Bis Mitte der 1990er Jahre war zur Ökobilanzierung fast nur „graue Literatur“ erhältlich. Mittlerweile sind einige, meist in englischer Sprache verfasste, Bücher erschienen, die das Thema ausführlich behandeln89). Eine wesentliche Informations quelle sind auch die Schriften nationaler und internationaler Organisationen zum Thema Ökobilanz (LCA), vor allem SETAC und SETAC Europe90), The Nordic Council91), US-EPA92), UBA Berlin93), BUS/BUWAL Bern94) und die European Environment Agency Kopenhagen (EEA)95).
Seit 1996 erscheint „The International Journal of Life Cycle Assessment“ (Int. J. LCA) im ecomed Verlag, Landsberg/Lech und Heidelberg (ab 01.01.2008 bei Springer, Heidelberg). Jeweils aktuelle Information über dieses Journal und verwandte Publikationen sind über das Internet abzufragen96). Die Zeitschrift hat sich in kurzer Zeit zum führenden Publikationsorgan der methodischen Weiterentwicklung der Ökobilanz entwickelt. Sie wurde ergänzt durch die Buchreihe „LCA-Documents“ der Ecoinforma Press, seit 2008 bei Wiley-Blackwell), Bayreuth, in Kooperation mit ecomed. Das Int. J. LCA ist auch in elektronischer Version verfügbar, die Kurzfassungen, Leitartikel und ähnliche Publikationen können kostenlos abgeladen werden. Weitere Zeitschriften, die regelmäßig Beiträge über Ökobilanzen veröffentlichen, sind das Journal of Industrial Ecology (MIT Press, seit 2008 bei Wiley-Blackwell), Cleaner Production (Elsevier) und Integrated Environ mental Assessment and Management – IEAM (SETAC Press).
Fachzeitschriften, deren thematisches Spektrum das jeweilige Thema der Ökobilanz umfasst, publizieren ebenfalls Ökobilanzliteratur. So wurde beispielsweise 1995 die große ECOSOL-Tensid-Sachbilanz der europäischen Tensidhersteller, durchgeführt von Franklin Associates, zur Gänze in zwei Heften von „Tenside, Surfactants, Detergents“ publiziert97).
Die Bedeutung des Publizierens für die Verbreitung und kritische Diskussion von Methoden, Theorien und Forschungsergebnissen kann gar nicht überschätzt werden. Besonders in neuen Zweigen der Wissenschaft definiert das Gutachterverfahren (Peer Review) von Tag zu Tag was als wissenschaftlich zu gelten hat und was nicht98). Es wirkt als Feineinstellung zu den großen erkenntnistheoretischen Prinzipien, insbesondere der nach Popper zentralen Frage der Falsifizierbarkeit99), die für Ökobilanzen noch nicht eindeutig zu beantworten ist. Die Frage der Wissenschaftlichkeit der Ökobilanz wird im Folgenden für die einzelnen Komponenten kritisch zu betrachten sein.
1.6 Literatur zu Kapitel 1
AFNOR 1994: Association Française de Normalisation (AFNOR): Analyse de cycle de vie. Norme NF X 30–300. 3/1994.
Badino und Baldo 1998: Badino, V.; Baldo, G. L.: LCA – Istruzioni per l’uso. Progetto Leonardo, Esculapio Editore, Bologna.
Baumann und Tillman 2004: Baumann, H.; Tillman, A.-M.: The Hitch Hiker’s Guide to LCA. An Orientation in LCA Methodology and Application. Studentlitteratur, Lund. ISBN 91-44-02364-2.
BDI 1999: Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI): Die Durchführung von Ökobilanzen zur Information von Öffentlichkeit und Politik. BDI-Drucksache Nr. 313. Verlag Industrie-Förderung, Köln, April 1999. ISSN 0407-8977.
Beck 1993: Beck, M. (Hrsg.): Ökobilanzierung im betrieblichen Management. Vogel Buchverlag, Würzburg. ISBN 3-8023-1479-4.
Berenbold und Kosswig 1995: Berenbold, H.; Kosswig, K.: A life-cycle inventory for the production of secondary alkane sulphonates (SAS) in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 152–156.
Berna et al. 1995: Berna, J. L.; Cavalli, L.; Renta, C.: A life-cycle inventory for the production of linear akylbenzene sulphonates in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 122–127.
BIfA/IFEU/Flo-Pak 2002: Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen: Vergleichende Ökobilanz für Loose-fill-Packmittel aus Stärke bzw. aus Polystyrol. Bayerisches Institut für angewandte Umweltforschung und -technik, Augsburg.
Blouet und Rivoire 1995: Blouet, A.; Rivoire, E.: L’Écobilan. Les produits et leurs impacts sur l’environnement. Dunod, Paris. ISBN 2-10-002126-5.
Boustead 1996: Boustead, I.: LCA – How it came about. The beginning in UK. Int. J. LCA 1 (3), 147–150.
Boustead und Hancock 1979: Boustead, I.; Hancock, G. F.: Handbook of Industrial Energy Analysis. Ellis Horwood Ltd., Chichester.
Braunschweig und Müller-Wenk 1993: Braunschweig, A.; Müller-Wenk, R.: Ökobilanzen für Unternehmungen. Eine Wegleitung für die Praxis. Verlag Haupt, Bern.
BSI 2008: British Standards Institution (Ed.): Publicly Available Specification (PAS) 2050:2008. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services.
BUS 1984: Bundesamt für Umweltschutz (BUS), Bern (Hrsg.): Oekobilanzen von Packstoffen. Schriftenreihe Umweltschutz, Nr. 24. Bern, April 1984.
BUWAL 1990: Ahbe, S.; Braunschweig, A.; Müller-Wenk, R.: Methodik für Oekobilanzen auf der Basis ökologischer Optimierung. In: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern (Hrsg.): Schriftenreihe Umwelt Nr. 133.
BUWAL 1991: Habersatter, K.; Widmer, F.: Oekobilanzen von Packstoffen. Stand 1990. In: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL), Bern (Hrsg.): Schriftenreihe Umwelt Nr. 132, Februar 1991.
BUWAL 1996,1998: Habersatter, K.; Fecker, I.; Dall’Aqua, S.; Fawer, M.; Fallscher, F.; Förster, R.; Maillefer, C.; Ménard, M.; Reusser, L.; Som, C.; Stahel, U.; Zimmermann, P.: Ökoinventare für Verpackungen. ETH Zürich und EMPA St. Gallen für BUWAL und SVI, Bern. In: Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft (Hrsg.): Schriftenreihe Umwelt Nr. 250/Bd. I und II. 2. erweiterte und aktualisierte Auflage, Bern 1998 (1. Auflage 1996).
CSA 1992: Canadian Standards Association (CSA): Environmental Life Cycle Assessment. CAN/CSA-Z760. 5th Draft Edition, May 1992.
Curran 1996: Curran, M. A. (ed.): Environmental Life-Cycle Assessment. McGraw-Hill, New York. ISBN 0-07-015063-X.
Deutsches Institut für Bauen und Umwelt 2007: TECU® – Kupferbänder und Kupferlegierungen. KME Germany AG. Programmhalter: Deutsches Institut für Bauen und Umwelt. Registrierungsnummer No: AUB-KME-30807-D. Ausstellungsdatum: 2007-11-01; verifiziert von: Dr. Eva Schmincke.
DIN-NAGUS 1994: DIN-NAGUS: Grundsätze produktbezogener Ökobilanzen (Stand Oktober 1993). DIN-Mitteilungen 73 (3), 208–212.
EPA 1993: Vigon, B. W.; Tolle, D. A.; Cornaby, B. W.; Latham, H. C.; Harrison, C. L.; Boguski, T. L.; Hunt, R. G.; Sellers, J. D.: Life Cycle Assessment: Inventory Guidelines and Principles. EPA/600/R-92/245, Office of Research and Development. Cincinnati, Ohio.
EPA 2006: Scientific Applications International Corporation (SAIC): Life Cycle Assessment: Principles and Practice. U.S. EPA, Systems Analysis Branch, National Risk Management Research Laboratory. Cincinnati, Ohio.
Eyrer 1996: Eyrer, P. (Hrsg.): Ganzheitliche Bilanzierung. Werkzeug zum Planen und Wirtschaften in Kreisläufen. Springer, Berlin 1996. ISBN 3-540-59356-X.
Fava et al. 1993: Fava, J.; Consoli, F. J.; Denison, R.; Dickson, K.; Mohin, T.; Vigon, B. (eds.): Conceptual Framework for Life-Cycle Impact Analysis. Workshop Report. SETAC and SETAC Foundation for Environ. Education. Sandestin, Florida, February 1–7, 1992. Published by SETAC.
Fava et al. 1994: Fava, J.; Jensen, A. A.; Lindfors, L.; Pomper, S.; De Smet, B.; Warren, J.; Vigon, B. (eds.): Conceptual Framework for Life-Cycle Data Quality. Workshop Report. SETAC and SETAC Foundation for Environ. Education. Wintergreen, Virginia, October 1992. Published by SETAC June 1994.
Fink 1997: Fink, P.: LCA – How it came about. The roots of LCA in Switzerland: Continuous learning by doing. Int. J. LCA 2 (3), 131–134.
Finkbeiner et al. 2006: Finkbeiner, M.; Inaba, A.; Tan, R. B. H.; Christiansen, K.; Klüppel, H.-J.: The new international standards for life cycle assessment: ISO 14040 and ISO 14044. Int. J. LCA 11 (2), 80–85.
Fleischer und Schmidt 1995: Fleischer, G.; Schmidt, W.-P.: Life Cycle Assessment. Ullmanns Encyclopaedia of Industrial Chemistry, Vol. B8, 585–600.
Fleischer und Schmidt 1996: Fleischer, G.; Schmidt, W.-P.: Functional unit for systems using natural raw materials. Int. J. LCA 1 (1), 23–27.
Franke 1984: Franke, M.: Umweltauswirkungen durch Getränkeverpackungen. Systematik zur Ermittlung der Umweltauswirkungen von komplexen Prozessen am Beispiel von Einweg- und Mehrweg-Getränkebehältern. EF-Verlag für Energie- und Umwelttechnik, Berlin.
Franke et al. 1995: Franke, M.; Berna, J. L.; Cavalli, L.; Renta, C.; Stalmans, M.; Thomas, H.: A life-cycle inventory for the production of petrochemical intermediates in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 384–396.
Fullana und Puig 1997: Fullana, P.; Puig, R.: Análisis del ciclo de vida. Primera edición. Rubes Editorial, S.L., Barcelona. ISBN 84-497-0070-1.
Gabathuler 1998: Gabathuler, H.: The CML story. How environ mental sciences entered the debate on LCA. Int. J. LCA 2 (4), 187–194.
Gensch 2008: Gensch, C.-O.; Klimaneutrale Weleda AG. Endbericht, Öko-Institut Freiburg.
Giegrich et al. 1995: Giegrich, J.; Mampel, U.; Duscha, M.; Zazcyk, R.; Osorio-Peters, S.; Schmidt, T.: Bilanzbewertung in produktbezogenen Ökobilanzen. Evaluation von Bewertungsmethoden, Perspektiven. Endbericht des Instituts für Energie- und Umweltforschung Heidelberg GmbH (IFEU) an das Umweltbundesamt, Berlin. Heidelberg, März 1995. UBA Texte 23/95. Berlin. ISSN 0722-186X.
Grahl und Schmincke 1996: Grahl, B.; Schmincke, E.: Evaluation and decision-making processes in life cycle assessment. Int. J. LCA 1 (1), 32–35.
Günther und Langowski 1997: Günther, A.; Langowski, H.-C.: Life cycle assessment study on resilient floor coverings. Int. J. LCA 2(2), 73–80.
Günther und Langowski 1998: Günther, A.; Langowski, H.-C. (eds.): Life Cycle Assessment Study on Resilient Floor Coverings. For ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturers Institute). Fraunhofer IRB Verlag 1998. ISBN 3-8167-5210-1.
Guinée et al. 2002: Guinée, J. B. (final editor); Gorée, M.; Heijungs, R.; Huppes, G.; Kleijn, R.; Koning, A. de; Oers, L. van; Wegener Sleeswijk, A.; Suh, S.; Udo de Haes, H. A.; Bruijn, H. de; Duin, R. van; Huijbregts, M. A. J.: Handbook on Life Cycle Assessment – Operational Guide to the ISO Standards. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. ISBN 1-4020-0228-9.
Hauschild und Wenzel 1998: Hauschild, M.; Wenzel, H.: Environmental Assessment of Products Vol. 2: Scientific Background. Chapman & Hall, London. ISBN 0-412-80810-2.
Heijungs 1997: Heijungs, R.: Economic Drama and the Environmental Stage. Formal Derivation of Algorithmic Tools for Environmental Analysis and Decision-Support from a Unified Epistemological Principle. Proefschrift (Dissertation/PhD-Thesis). Leiden. ISBN 90-9010784-3.
Heijungs und Suh 2002: Heijungs, R.; Suh, S.: The Computational Structure of Life Cycle Assessment. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2002. ISBN 1-4020-0672-1.
Heyde und Kremer 1999: Heyde, M.; Kremer, M.: Recycling and Recovery of Plastics from Packaging in Domestic Waste. LCA-type Analysis of Different Strategies. LCA Documents Vol. 5. Ecoinforma Press, Bayreuth. ISBN 3-928379-57-7.
Hirsinger und Schlick 1995a: Hirsinger, F.; Schlick, K.-P.: A life-cycle inventory for the production of alcohol sulphates in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 128–139.
Hirsinger und Schlick 1995b: Hirsinger, F.; Schlick, K.-P.: A life-cycle inventory for the production of alkyl polyglucosides in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 193–200.
Hirsinger und Schlick 1995c: Hirsinger, F.; Schlick, K.-P.: A life-cycle inventory for the production of detergent-grade alcohols. Tenside Surf. Det. 32, 398–410.
Hirsinger und Schlick 1995d: Hirsinger, F.; Schlick, K.-P.: A life-cycle inventory for the production of oleo-chemical raw materials. Tenside Surf. Det. 32, 420–432.
Huijbregts et al. 2006: Huijbregts, M. A. J.; Guinée, J. B.; Huppes, G.; Potting, J. (eds.): Special issue honoring Helias A. Udo de Haes at the occasion of his retirement. Special Issue 1, Int. J. LCA 11, 1–132.
Humbert et al. 2008: Humbert, S.; Rossi, V.; Margni, M.; Jolliet, O.; Loerincik, Y: Life cycle assessment of two baby food packaging alternatives: glass jars vs. plastic pots. Int. J. LCA (im Druck).
Hunt und Franklin 1996: Hunt, R.; Franklin, W. E.: LCA – How it came about. Personal reflections on the origin and the development of LCA in the USA. Int. J. LCA 1 (1), 4–7.
Huppes und Schneider 1994: Huppes, G.; Schneider, F. (eds.):Proceedings of the European Workshop on Allocation in LCA. Leiden, February 1994. SETAC Europe, Brussels.
IFEU/SLFA 1998: Ökobilanz Beikrautbekämpfung im Weinbau. Im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz, Mainz. IFEU, Heidelberg, SLFA, Neustadt an der Weinstraße, Dezember 1998.
IFEU 2002: Ostermayer, A.; Schorb, A.: Ökobilanz Fruchtsaftgetränke Verbund-Standbodenbeutel 0,2 l, MW-Glasflasche, Karton Giebelpackung. Im Auftrag der Deutschen SISI-Werke, Eppelheim. IFEU Heidelberg, Juli 2002.
IFEU 2004: Detzel, A.; Giegrich, J.; Krüger, M.; Möhler, S.; Ostermayer, A. (IFEU): Ökobilanz PET-Einwegverpackungen und sekundäre Verwertungsprodukte. Im Auftrag von PETCORE, Brüssel. IFEU Heidelberg, August 2004.
IFEU 2006: Detzel, A.; Böß, A.: Ökobilanzieller Vergleich von Getränkekartons und PET-Einwegflaschen. Endbericht, Institut für Energie- und Umweltforschung (IFEU) Heidelberg an den Fachverband Kartonverpackungen (FKN) Wiesbaden, August 2006.
IFEU 2006a: Detzel, A.; Krüger, M. (IFEU): LCA for food contact packaging made from PLA and traditional materials. On behalf of Nature-works LLC. IFEU Heidelberg, Juli 2006.
IFEU 2007: Krüger, M.; Detzel, A. (IFEU): Aktuelle Ökobilanz zur 1,5-L-PET-Einwegflasche in Österreich unter Einbeziehung des Bottleto-Bottle-Recycling. Im Auftrag des Verbands der Getränkehersteller Österreichs. IFEU Heidelberg, Oktober 2007.
ISO 1997: International Standard (ISO); Norme Européenne (CEN): Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. Prinzipien und allgemeine Anforderungen. EN ISO 14040 Juni 1997.
ISO 1998: International Standard (ISO); Norme Euro péenne (CEN): Environmental management – Life cycle assessment: Goal and scope definition and inventory analysis (Festlegung des Ziels und des Untersuchungsrahmens sowie Sachbilanz) ISO EN 14041 (1998).
ISO 2000a: International Standard (ISO); Norme Euro péenne (CEN): Environmental management – Life cycle assessment: Life cycle impact assessment (Wirkungsabschätzung). International Standard ISO EN 14042.
ISO 2000b: International Standard (ISO); Norme Européenne (CEN): Environmental manage ment – Life cycle assessment: Inter pretation (Auswertung). International Standard ISO EN 14043.
ISO 2006a: ISO TC 207/SC 5: Environmental management – Life cycle assessment – Principles and framework. ISO EN 14040 2006-10.
ISO 2006b: ISO TC 207/SC 5: Environmental manage ment – Life cycle assessment – Requirements and guidelines. ISO EN 14044 2006-10.
Janzen 1995: Janzen, D. C.: Methodology of the European surfactant life-cycle inventory for detergent surfactants production. Tenside Surf. Det. 32, 110–121.
Jensen et al. 1997: Jensen, A. A.; Hoffman, L.; Møller, B. T.; Schmidt, A.; Christiansen, K.; Elkington, J.; van Dijk, F.: Life Cycle Assessment (LCA). A guide to approaches, experiences and information sources. European Environmental Agency. Environmental Issues Series No. 6, August 1997.
Kemna et al. 2005: Kemna, R.; van Elburg, M.; Li, W.; van Holsteijn, R.: Methodology Study Eco-design of Energy-using Products – MEEUP Methodology Report for DG ENETR, Unit ENTR/G/3 in collaboration with DG TREN, Unit D1. Delft, 2005.
Kindler und Nikles 1979: Kindler, H.; Nikles, A.: Energieaufwand zur Herstellung von Werkstoffen – Berechnungsgrundsätze und Energieäquivalenzwerte von Kunststoffen. Kunststoffe 70, 802–807.
Kindler und Nikles 1980: Kindler, H.; Nikles, A.: Energiebedarf bei der Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen. Chem.-Ing.-Tech. 51, 1–3.
Klöpffer 1994: Klöpffer, W.: Environmental hazard assess ment of chemicals and products. Part IV. Life cycle assessment. ESPR – Environ. Sci. & Pollut. Res. 1 (5), 272–279.
Klöpffer 1997: Klöpffer, W.: Life cycle assessment – From the beginning to the current state. ESPR-Environ. Sci. & Pollut. Res. 4 (4), 223–228.
Klöpffer 2003: Klöpffer, W.: Life-cycle based methods for sustainable product development. Editorial for the LCM Section in Int. J. LCA 8 (3), 157–159.
Klöpffer 2006: Klöpffer, W.: The Role of SETAC in the development of LCA. Int. J. LCA Special Issue 1, Vol. 11, 116–122.
Klöpffer 2007: Klöpffer, W.: Publishing scientific articles with special reference to LCA and related topics. Int. J. LCA 12 (2), 71–76.
Klöpffer 2008: Klöpffer, W.: Life-cycle based sustainability assessment of products. Int. J. LCA 13 (2), 89–94.
Klöpffer et al. 1995: Klöpffer, W.; Grießhammer, R.; Sundström, G.: Overview of the scientific peer review of the European life cycle inventory for surfactant production. Tenside Surf. Det. 32, 378–383.
Klöpffer und Renner 1995: Klöpffer, W.; Renner, I.: Methodik der Wirkungsbilanz im Rahmen von Produkt-Ökobilanzen unter Berücksichtigung nicht oder nur schwer quantifizierbarer Umwelt-Kategorien. Bericht der C.A.U. GmbH, Dreieich, an das Umweltbundesamt (UBA), Berlin. UBA-Texte 23/95, Berlin. ISSN 0722-186X.
Klöpffer und Volkwein 1995: Klöpffer, W.; Volkwein, S.: Bilanzbewertung im Rahmen der Ökobilanz. Kapitel 6.4 in Thomé-Kozmiensky, K. J. (Hrsg.): Enzyklopädie der Kreislaufwirtschaft, Management der Kreislaufwirtschaft. EF-Verlag für Energie- und Umwelttechnik, Berlin, S. 336–340.
Klöpffer et al. 1999: Klöpffer, W.; Renner, I.; Tappeser, B.; Eckelkamp, C.; Dietrich, R.: Life Cycle Assessment gentechnisch veränderter Produkte als Basis für eine umfassende Beurteilung möglicher Umweltauswirkungen. Federal Environment Agency Ltd. Monographien Bd. 111, Wien. ISBN 3-85457-475-4.
Klüppel 1997: Klüppel, H.-J.: Goal and scope definition and life cycle inventory analysis. Int. J. LCA 2 (1), 5–8.
Leuven 1990: Life Cycle Analysis for Packaging Environmental Assessment. Proceedings of the Specialised Workshop organized by Procter & Gamble, Leuven, Belgium, September 24/25.
Lindfors et al. 1994a: Lindfors, L.-G.; Christiansen, K.; Hoffmann, L.; Virtanen, Y.; Juntilla, V.; Leskinen, A.; Hansen, O.-J.; Rønning, A.; Ekvall,T.; Finnveden, G.; Weidema, Bo P.; Ersbøll, A. K.; Bomann, B.; Ek, M.: LCA-NORDIC Technical Reports No. 10 and Special Reports No. 1–2. Tema Nord 1995:503. Nordic Council of Ministers. Copenhagen 1994. ISBN 92-9120-609-1.
Lindfors et al. 1994b: Lindfors, L.-G.; Christiansen, K.; Hoffmann, L.; Virtanen, Y.; Juntilla, V.; Leskinen, A.; Hansen, O.-J.; Rønning, A.; Ekvall,T.; Finnveden, G.: LCA-NORDIC Technical Reports No. 1–9. Tema Nord 1995:502. Nordic Council of Ministers. Copenhagen 1994.
Lindfors et al. 1995: Lindfors, L.-G.; Christiansen, K.; Hoffmann, L.; Virtanen, Y.; Juntilla, V.; Hanssen, O.-J.; Rønning, A.; Ekvall, T.; Finnveden, G.: Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment. Nordic Council of Ministers. Nord 1995:20. Copenhagen 1995.
Lundholm und Sundström 1985: Lundholm, M. P.; Sundström, G.: Ressourcen und Umweltbeeinflussung. Tetrabrik Aseptic Kartonpackungen sowie Pfandflaschen und Einwegflaschen aus Glas. Malmö 1985.
Lundholm und Sundström 1986: Lundholm, M. P.; Sundström, G.: Ressourcen- und Umweltbeeinflussung durch zwei Verpackungssysteme für Milch, Tetra Brik und Pfandflasche. Malmö 1986.
Marsmann 1997: Marsmann, M.: ISO 14040 – The first project. Int. J. LCA 2 (3), 122–123.
Mauch und Schäfer 1996: Mauch, W.; Schaefer, H.: Methodik zur Ermittlung des kumulierten Energieaufwands. In Eyrer, P. (Hrsg.): Ganzheitliche Bilanzierung. Werkzeug zum Planen und Wirtschaften in Kreisläufen. Springer, Berlin, S. 152–180. ISBN 3-540-59356-X.
Meadows et al. 1972: Meadows, D. H.; Meadows, D. L.; Randers, J.; Behrens III, W. W.: The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind. Universe Books, New York 1972. ISBN 0-87663-165-0.
Meadows et al. 1973: Meadows, D. L.; Meadows, D. H.; Zahn, E.; Milling, P.: Die Grenzen des Wachstums. Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. 101.–200. Ts. rororo Taschenbuch, Hamburg 1973; neue Auflage im dtv Taschenbuchverlag. ISBN 3-499-16825-1.
Merkel 1997: Merkel, A.: Foreword: ISO 14040. Int. J. LCA 2 (3), 121.
Neitzel 1996: Neitzel, H. (ed.): Principles of product-related life cycle assessment. Int. J. LCA 1 (1), 49–54.
O’Brien et al. 1996: O’Brien, M.; Doig, A.; Clift, R.: Social and environmental life cycle assessment (SELCA) approach and methodological development. Int. J. LCA 1 (4), 231–237.
Oberbacher et al. 1996: Oberbacher, B.; Nikodem, H.; Klöpffer, W.: LCA – How it came about. An early systems analysis of packaging for liquids which would be called an LCA today. Int. J. LCA 1 (2), 62–65.
Popper 1934: Popper, K. R.: Logik der Forschung. J. Springer, Wien 1934. 7. Auflage: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1982. 1st English edition: The Logic of Scientific Discovery. Hutchison, London 1959.
Postlethwaite 1995a: Postlethwaite, D.: A life-cycle inventory for the production of sulphur and caustic soda in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 412–418.
Postlethwaite 1995b: Postlethwaite, D.: A life-cycle inventory for the production of soap in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 157–170.
Projektgruppe ökologische Wirtschaft 1987: Produktlinienanalyse: Bedürfnisse, Produkte und ihre Folgen. Kölner Volksblattverlag, Köln.
Rüdenauer et al. 2007: Rüdenauer, I.; Dross, M.; Eberle, U.; Gensch, C.; Graulich, K.; Hünecke, K.; Koch, Y.; Möller, M.; Quack, D.; Seebach, D.; Zimmer, W.; et al.: Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe. Part 1: Comparison of the Life Cycle Costs of Green and Non Green Products. Service contract number: DG ENV.G.2/SER/2006/0097r. Öko-Institut Freiburg 2007.
Saur 1997: Saur, K.: Life cycle impact assessment (LCA-ISO activities). Int. J. LCA 2 (2), 66–70.
Schaltegger 1996: Schaltegger, S. (Ed.): Life Cycle Assessment (LCA) – Quo vadis? Birkhäuser Verlag, Basel und Boston. ISBN 3-7643-5341-4 (Basel), ISBN 0-8176-5341-4 (Boston).
Schmidt und Schorb 1995: Schmidt, M.; Schorb, A.: Stoffstromanalysen in Ökobilanzen und Öko-Audits. Springer Verlag, Berlin. ISBN 3-540-59336-5.
Schmidt et al. 2004: Schmidt, A.; Jensen, A. A.; Clausen, A.; Kamstrup, O.; Postlethwaite, D.: A comparative life cycle assessment of building insulation products made of stone wool, paper wool and flax. Part 1: Background, goal and scope, life cycle inventory, impact assessment and interpretation. Int. J. LCA 9 (1), 53–66.
Schmincke und Grahl 2006: Schmincke, E.; Grahl, B.: Umwelteigenschaften von Produkten. Die Rolle der Ökobilanz in ISO Typ III Umweltdeklarationen. UWSF – Z Umweltchem Ökotox 18(2).
Schmitz et al. 1995: Schmitz, S.; Oels, H.-J.; Tiedemann, A.: Ökobilanz für Getränkeverpackungen. Teil A: Methode zur Berechnung und Bewertung von Ökobilanzen für Verpackun gen. Teil B: Vergleichende Untersuchung der durch Verpackungssysteme für Frischmilch und Bier hervorgerufenen Umweltbeeinflussungen. UBA Texte 52/95. Berlin.
Schmitz und Paulini 1999: Schmitz, S.; Paulini, I.: Bewertung in Ökobilanzen. Methode des Umweltbundesamtes zur Normierung von Wirkungsindikatoren, Ordnung (Rangbildung) von Wirkungskategorien und zur Auswertung nach ISO 14042 und 14043. Version ’99. UBA Texte 92/99, Berlin.
Schul et al. 1995: Schul, W.; Hirsinger, F.; Schick, K.-P.: A life-cycle inventory for the production of detergent range alcohol ethoxylates in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 171–192.
SETAC 1991: Fava, J. A.; Denison, R.; Jones, B.; Curran, M. A.; Vigon, B.; Selke, S.; Barnum, J. (eds.): SETAC Workshop Report: A Technical Framework for Life Cycle Assessments. August 18–23 1990, Smugglers Notch, Vermont. SETAC, Washington, DC, January 1991.
SETAC 1993: Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC): Guidelines for Life-Cycle Assessment: A „Code of Practice“. From the SETAC Workshop held at Sesimbra, Portugal, 31 March – 3 April 1993. Edition 1, Brussels and Pensacola (Florida), August 1993.
SETAC Europe 1992: Society of Environmental Toxicology and Chemistry – Europe (Ed.): Life-Cycle Assessment. Workshop Report, 2–3 December 1991, Leiden. SETAC Europe, Brussels.
Stalmans et al. 1995: Stalmans, M.; Berenbold, H.; Berna, J. L.; Cavalli, L.; Dillarstone, A.; Franke, M.; Hirsinger, F.; Janzen, D.; Kosswig, K.; Postlethwaite, D.; Rappert, Th.; Renta, C.; Scharer, D.; Schick, K.-P.; Schul, W.; Thomas, H.; Van Sloten, R.: European life-cycle inventory for detergent surfactants production. Tenside Surf. Det. 32, 84–109.
Suter et al. 1995: Suter, P.; Walder, E. (Projektleitung). Frischknecht, R.; Hofstetter, P.; Knoepfel, I.; Dones, R.; Zollinger, E. (Ausarbeitung). Attinger, N.; Baumann, Th.; Doka, G.; Dones, R.; Frischknecht, R.; Gränicher, H.-P.; Grasser, Ch.; Hofstetter, P.; Knoepfel, I.; Ménard, M.; Müller, H.; Vollmer, M. Walder, E.; Zollinger, E. (AutorInnen): Ökoinventare für Energiesysteme. ETH Zürich und Paul Scherrer Institut, Villingen im Auftrag des Bundesamtes für Ener gie wirtschaft (BEW) und des Nationalen Energie-Forschungs-Fonds NEFF. 2. Auflage.
Suter et al. 1996: Suter, P.; Frischknecht, R. (Projektleitung); Frischknecht, R. (Schlussredaktion): Bollens, U.; Bosshart, S.; Ciot, M.; Ciseri, L.; Doka, G.; Frischknecht, R.; Hirschier, R.; Martin, A.; Dones, R.; Gantner, U. (AutorInnen der Überarbeitung): Ökoinventare von Energiesystemen. ETH Zürich und Paul Scherrer Institut, Villingen im Auftrag des Bundesamtes für Energiewirtschaft (BEW) und des Projekt-und Studienfonds der Elektrizitätswirtschaft (PSEL). 3. Auflage. Zürich.
Svenska Miljöstyrningsrådet 2006: Climate Declaration, Carbon Footprint for Natural Mineral Water. Registration number: S-P-00123. Program: The EPD®system. Program operator: AB Svenska Miljöstyrningsrådet (MSR), Product Category Rules (PCR):
Natural mineral water (PCR 2006:7), PCR review conducted by: MSR Technical Committee chaired by Sven-Olof Ryding ([email protected]), Third party verified: Extern Verifier: Certiquality. Download from http://www.environdec.com.
Thomas 1995: Thomas, H.: A life-cycle inventory for the production of alcohol ethoxy sulphates in Europe. Tenside Surf. Det. 32, 140–151.
Tiedemann 2000: Tiedemann, A. (Hrsg.): Ökobilanzen für graphische Papiere. UBA Texte 22/2000, Berlin.
Tukker et al. 1996: Tukker, A.; Kleijn, R.; van Oers, L.: A PVC substance flow analysis for Sweden. Report by TNO Centre for Technology and Policy Studies and Centre of Environmental Science (CML) Leiden to Norsk Hydro, TNO-Report STB/96/48-III. Apeldoorn, November 1996.
UBA 1992: Arbeitsgruppe Ökobilanzen des Umweltbundesamts Berlin: Ökobilanzen für Produkte. Bedeutung – Sachstand – Perspektiven. UBA Texte 38/92. Berlin.
UBA 1995: Umweltbundesamt (Hrsg.): Schmitz, S.; Oels, H.-J.; Tiedemann, A.: Ökobilanz für Getränkeverpackungen. UBA Texte 52/95, Berlin.
UBA 1997: Umweltbundesamt Berlin: Materialien zu Ökobilanzen und Lebensweganalysen. Aktivitäten und Initiativen des Umweltbundesamtes. Bestandsaufnahme Stand März 1997. UBA Texte 26/97. Berlin. ISSN 0722-186X.
UBA 2000: Plinke, E.; Schonert, M.; Meckel, H.; Detzel, A.; Giegrich, J.; Fehrenbach, H.; Ostermayer, A.; Schorb, A.; Heinisch, J.; Luxenhofer, K.; Schmitz, S.: Ökobilanz für Getränkeverpackungen II, Zwischenbericht (Phase 1) zum Forschungsvorhaben FKZ 296 92 504 des Umweltbundesamtes Berlin – Hauptteil: UBA Texte 37/00, Berlin September 2000. ISSN 0722-186X.
UBA 2000a: Kolshorn, K.-U., Fehrenbach, H.: Ökologische Bilanzierung von Altöl-Verwertungswegen. Abschlussbericht zum Forschungsvorhaben Nr. 297 92 382/01 des Umweltbundesamtes Berlin. UBA Texte 20/00, Berlin Januar 2000. ISSN 0722-186X.
UBA 2002: Schonert, M.; Metz, G.; Detzel, A.; Giegrich, J.; Ostermayer, A.; Schorb, A.; Schmitz, S.: Ökobilanz für Getränkeverpackungen II, Phase 2. Forschungsbericht 103 50 504 UBA-FB 000363 des Umweltbundesamtes Berlin: UBA Texte 51/02, Berlin Oktober 2002. ISSN 0722-186X.
Udo de Haes 1996: Udo de Haes, H. A. (ed.): Towards a Methodology for Life Cycle Impact Assessment. SETAC Europe, Brussels, September. ISBN 90-5607-005-3.
Udo de Haes und De Snoo 1996: Udo de Haes, H. A.; de Snoo, G. R.: Environmental certification. Companies and products: Two vehicles for a life cycle approach? Int. J. LCA 1 (3), 168–170.
Udo de Haes und De Snoo 1997: Udo de Haes, H. A.; De Snoo, G. R.: The agro-production chain. Environmental management in the agricultural production-consumption chain. Int. J. LCA 2 (1), 33–38.
UNO 1992: Agenda 21 in deutscher Übersetzung. Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung im Juni 1992 in Rio de Janeiro – Dokumente – http://www.agrar.de/agenda/agd21k00.htm.
Vattenfall et al. 2007: Product category rules: PCR for Electricity, Steam, and Hot and Cold Water Generation and Distribution. Registration no: 2007:08; Publication date: 2007-11-21; PCR documents: pdf-file; download from www.environdec.com Prepared by: Vattenfall AB, British Energy, EdF – Electricite de France, Five Winds International, Swedpower and Rolf Frischknecht – esu-services Switzerland, Enel Italy. PCR moderator: Caroline Setterwall, Vattenfall AB, Sweden.
VDI 1997: VDI-Richtlinie VDI 4600: Kumulierter Energieaufwand (Cumulative Energy Demand). Begriffe, Definitionen, Berechnungsmethoden. deutsch und englisch. Verein Deutscher Ingenieure, VDI-Gesellschaft Energietechnik Richtlinienausschuss Kumulierter Energieaufwand, Düsseldorf.