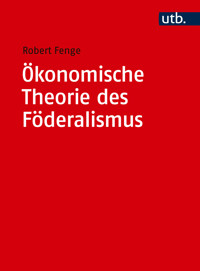
33,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Föderalismus ist ein Organisationsprinzip. Dies gilt für Staaten wie Deutschland und die USA sowie auch für den Staatenverbund EU. Robert Fenge stellt in diesem Buch ökonomische Erklärungsansätze und Modelle vor, die Kriterien und Argumente für die Beurteilung föderaler Strukturen liefern. Er illustriert die Thematik durch Abbildungen und Beispiele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
utb 6269
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · Tübingen
Psychiatrie Verlag · Köln
Psychosozial-Verlag · Gießen
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Prof. Dr. Robert Fenge lehrt Volkswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwissenschaft, an der Universität Rostock.
Robert Fenge
Ökonomische Theorie des Föderalismus
Autorenbild: © privat
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838562698
© UVK Verlag 2025
– Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6269
ISBN 978-3-8252-6269-3 (Print)
ISBN 978-3-8463-6269-3 (ePub)
Inhalt
Exkursverzeichnis
Vorwort
1Einleitung
1.1Föderalismus und Dezentralisierung
1.2Aufriss des Buches
Teil I ∙ Eine ökonomische Theorie des Staates
2Rechts- und Eigentumsordnung
3Allokative Staatsaufgaben
3.1Öffentliche Güter
3.2Externe Effekte
3.3Steigende Skalenerträge und natürliche Monopole
3.4Asymmetrische Information
4Distributive Staatsaufgaben
4.1Umverteilung von Einkommen
4.2Sozialversicherungen
5Stabilitätsorientierte Staatsaufgaben
5.1Arbeitslosigkeit
5.2Geldmengenpolitik
6Die Logik kollektiven Handelns
Teil II ∙ Größe, Anzahl und Aufbau föderaler Gebietskörperschaften
7Die optimale Größe einer Gebietskörperschaft bei immobiler Bevölkerung
7.1Das Ideal der fiskalischen Äquivalenz bzw. der perfekten Korrespondenz
7.2Überlappende Gebietskörperschaften
7.3Kosten der politischen Entscheidung und Verwaltung
7.4Nähe der Regierung zu den Präferenzen der Bürger: Das Dezentralisierungstheorem
7.4.1Die Annahme uniformer Bereitstellung durch eine zentrale Regierung
7.4.2Schlechtere Informiertheit zentraler Regierungen über Präferenzen
7.5Steigende Skalenerträge
7.6Spillover-Effekte
7.7Steuerexport
7.8Mobilität der Bevölkerung
8Abstimmung mit den Füßen bei mobiler Bevölkerung: Das Tiebout-Modell
8.1Die Clubtheorie
8.1.1Das Wohlfahrtsoptimum
8.1.2Das Gleichgewicht
8.1.3Der Anpassungsprozess zum Gleichgewicht
8.1.4Wettbewerb unter benevolenten Regierungen
8.1.5Wettbewerb unter Leviathan-Regierungen
8.1.6Einordnung der Clubtheorie
8.2Ökonomien mit Land
8.2.1Wohlfahrtsoptimum: Das Henry-George-Theorem
8.2.2Dezentraler Wettbewerb unter Regierungen
8.2.3Überlappende Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter
8.3Grenzen und Nutzen des Ansatzes von Tiebout
Teil III ∙ Die Kompetenzaufteilung staatlicher Aufgaben in einem föderalen Staatensystem
9Die Zuweisung allokativer Kompetenzen
9.1Mobile Bevölkerung und effiziente lokale Steuern
9.1.1Wohnsitzabhängige Steuern und Fiscal Zoning
9.1.2Wohnsitzunabhängige Steuern
9.2Mobiles Kapital und Steuerwettbewerb
9.2.1Kleine Regionen
9.2.2Große Regionen
9.2.3Fiskalische Externalitäten und vertikale Subventionen
9.3Spillover-Effekte, Steuerexport und vertikaler Finanzausgleich
9.3.1Effizienz der Allokation bei vollkommen mobiler Bevölkerung
9.3.2Effiziente vertikale Subventionen bei vollkommen immobiler Bevölkerung
10Die Zuweisung distributiver Kompetenzen
10.1Umverteilung aus der Gerechtigkeitsperspektive
10.1.1Das Fiskalische Residuum und Probleme des Finanzausgleichs
10.1.2Horizontale Gerechtigkeit bei immobiler Bevölkerung
10.1.3Horizontaler Finanzausgleich bei immobiler Bevölkerung
10.1.4Mobile Bevölkerung und Umverteilung: Race to the bottom
10.2Umverteilung aus der Effizienzperspektive
10.2.1Immobile Bevölkerung
10.2.2Mobile Bevölkerung und vertikaler Finanzausgleich
11Theorie zwischenstaatlicher Transfers und föderaler Zuweisungen
11.1Typen vertikaler Zuweisungen
11.2Begrenzte Zweckzuweisungen (Closed-ended matching grants)
12Weiche Budgetbeschränkungen: Das Bailout-Problem
Teil IV ∙ Politökonomische Ansätze
13Das Konnexitätsprinzip
14Politische Rechenschaft (Accountability)
15Disziplinierung und Selektion durch Wahlen
15.1Das Grundmodell
15.2Direkte fiskalische Beschränkungen
16Zähmung des Leviathan durch Steuerwettbewerb
17Maßstabswettbewerb (Yardstick Competition)
18Fiskalische Dezentralisierung versus Zentralisierung
18.1Fiskalische Regime
18.2Dezentralisierung
18.3Zentralisierung
19Weitere Aspekte und Herausforderungen
Literatur
Stichwort- und Personenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Exkursverzeichnis
Exkurs 1|James Buchanan und das Paradox des Regiert-werdens
Exkurs 2|Die Klassiker jenseits des Minimalstaats
Exkurs 3|Funktionaler Föderalismus
Exkurs 4|Einfluss von Einwohnerzahl und -dichte auf Kosten öffentlicher Güter
Exkurs 5|Alexis de Tocqueville über das föderale System in den USA
Exkurs 6|John Stuart Mill und die Metropolregierung
Exkurs 7|Die Federalist Papers und die Anti-Federalists
Vorwort
Dieses Buch ist für Leser geschrieben, die sich für die ökonomische Rechtfertigung des föderalen Staates interessieren. Was sind die Aufgaben eines Staates? Wie und warum werden staatliche Einheiten gebildet? Wie groß sollten diese staatlichen Einheiten sein? Was für ein föderaler Aufbau des Staates oder auch eines Staatenbundes ergibt sich daraus? Welche Aufgaben sollten in einem föderalen Staat auf einer bestimmten über- oder untergeordneten staatlichen Ebene angesiedelt sein? Welche Rolle spielen dabei Transfers zwischen den föderalen Ebenen? Insbesondere die Frage der Dezentralisierung versus Zentralisierung staatlicher Aufgaben steht im Mittelpunkt dieses Buches. Sie wird sowohl aus einer wohlfahrtsökonomischen Sicht beantwortet, die die Aufgabenzuteilung anhand der normativen Kriterien der Effizienz und der Gerechtigkeit beurteilt, als auch aus einer politökonomischen Sicht, die den Willen der Wähler in einer Demokratie als Maßstab nimmt.
Die Leser sollen eingeführt werden in unterschiedliche ökonomische Methoden zur Darstellung und Erklärung des Föderalismus. Teilweise werden mikroökonomische Kenntnisse vorausgesetzt. Fundamentale ökonomische Konzepte und Modellansätze werden ausführlich erläutert. Es wird keine vollständige Behandlung oder Erwähnung der bisherigen ökonomischen Literatur zu dem Thema angestrebt. Statt das Forschungsgebiet in seiner ganzen Breite darzustellen, geht es hier um vertiefende Einblicke in zentrale Fragestellungen und Modelle. Dieses Buch stellt wesentliche Forschungsbeiträge zum Fiskalföderalismus vor, stellt sie in einen Zusammenhang und präsentiert sie in einem einheitlichen methodischen Rahmen. Die dazu verwendeten ökonomischen Modelle haben gegenüber einer rein verbalen Argumentation den Vorteil, dass die Annahmen klar gekennzeichnet werden und die Schlussfolgerungen logisch abgeleitet werden können. Das Buch soll anregen zu einer kritischen Auseinandersetzung mit diesen modellhaften Argumenten.
Das Buch geht aus zwei Vorlesungen hervor, die ich im Lauf der letzten Jahre an der Universität Rostock gehalten habe. Einige Kapitel des vorläufigen Manuskripts waren im Sommersemester 2024 Gegenstand eines Seminars, und ich möchte den Seminarteilnehmern für zahlreiche Hinweise und Anmerkungen danken. Darüber hinaus möchte ich allen, die mich bei der Arbeit an diesem Buch mit wertvollen Hinweisen und Kommentaren unterstützt haben, danken, insbesondere Henrik Carlhoff, Hilte Geerdes-Fenge, Stefan Mengel, Anja Mönk, Niklas Potrafke, Ronnie Schöb, Marcel Thum und Helena Witschel. Sie haben das Buch nicht nur viel lesbarer gemacht, sondern vor allem inhaltliche Klarstellungen und Ergänzungen beigetragen. Die Mühe und das Engagement, eine frühe Version des Buches durchgearbeitet zu haben, kann ich nicht hoch genug wertschätzen. Alle verbleibenden Fehler und Mängel der Arbeit sind selbstverständlich nur mir anzulasten.
1Einleitung
1.1Föderalismus und Dezentralisierung
Was kennzeichnet einen föderalen Staat? Das entscheidende Kriterium ist, ob es unterhalb des nationalen Zentralstaats weitere politische Ebenen gibt, die autonome Entscheidungen bezüglich ihrer Politik treffen können. Wenn diese subnationalen Staatseinheiten (Gebietskörperschaften) selbständig über zumindest einige Aufgaben, Ausgaben oder Steuern entscheiden können, reden wir von einem föderalen Staat. Hingegen ist ein unitarischer Staat oder Einheitsstaat dadurch gekennzeichnet, dass es nur eine Zentralregierung gibt, die autonome Entscheidungen treffen kann. Also ist auch ein Staat, in dem es zwar regionale Regierungen oder Verwaltungseinheiten gibt, die aber nur abgeleitete Macht besitzen und Aufgaben erfüllen, die von der Zentralregierung delegiert werden, ein unitarischer Staat.1 Im Gegensatz dazu besteht in einem föderalen Staat für Gebietskörperschaften unterhalb der zentralen Ebene eine in der Regel verfassungsmäßig garantierte Selbstbestimmung in bestimmten Politikbereichen, die von der Zentralregierung nicht einseitig geändert werden kann. Durch diese Autonomie können subnationale Regierungen eigene Gesetze erlassen, Steuern erheben und öffentliche Dienstleistungen selbständig erbringen.2
Die Frage der Dezentralisierung von Aufgaben, Ausgaben und Einnahmen muss von der Frage, ob ein Staat föderal ist, unterschieden werden, denn auch Einheitsstaaten können ihre Politik mehr oder weniger dezentral durchführen. Die überwiegende Mehrheit der Länder weltweit sind Einheitsstaaten.3 Einige unitarische Staaten haben mehrere Gebietskörperschaftebenen, denen spezielle Aufgaben von der Zentralregierung zugewiesen werden. Je mehr staatliche Funktionen auf subnationaler Ebene ausgeführt werden, umso dezentraler ist ein Einheitsstaat. Zum Beispiel ist Frankreich in Regionen, Departements und Gemeinden eingeteilt, die als Organe der Selbstverwaltung von der Zentralregierung beaufsichtigt werden. Sie besitzen keine eigenständige Staatlichkeit. Allein die Zentralregierung verfügt über die staatliche Souveränität und entscheidet, welche Befugnisse und Zuständigkeiten an die unteren Regierungsebenen delegiert werden.
In föderalen Staaten hingegen bedeutet Dezentralisierung, dass den subnationalen Regierungen autonome Politikbereiche zugewiesen werden, die häufig in der Verfassung niedergelegt sind. Beispiele für föderale Staaten mit einem hohen Grad an Dezentralisierung sind Australien, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, die Schweiz, Österreich und Deutschland. In Deutschland sind die Kompetenzen der Bundesländer im Grundgesetz verankert. Jedes Bundesland besitzt zudem eine eigene Verfassung. Im Bundesrat können die Bundesländer bei der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mitwirken.
Welche Auswirkungen die Dezentralisierung der autonomen Politik hat, ist eine der wesentlichen Grundfragen dieses Buches. Staaten unterscheiden sich nach dem Ausmaß, in dem die Kompetenzen für staatliche Aufgaben auf den unteren hierarchischen Ebenen angesiedelt sind. Ein Prinzip föderaler Staaten ist das Subsidiaritätsprinzip, das besagt, die Regulierungskompetenz sollte bei der niedrigst möglichen Gebietskörperschaftsebene liegen, die in der Lage ist, die staatliche Aufgabe so zu bewältigen, dass dies gesellschaftlichen Normen wie der Effizienz und der Gerechtigkeit genügt.
Wie können unterschiedliche Grade von Dezentralisierung gemessen werden? Als ein mögliches Maß für die Dezentralisierung eines Staates werden Ausgaben subnationaler Staatsebenen als Anteil an den staatlichen Gesamtausgaben verwendet. Tabelle 1 zeigt diese Ausgabenanteile der OECD Fiscal Decentralisation Database für verschiedene föderale und unitarische Staaten über den Zeitraum von 1995 bis 2022.
Anmerkungen: Die zweite Spalte gibt an, ob es sich um föderale (F) oder unitarische (U) Staaten handelt. Staaten mit (U/F) sind Grenzfälle.
Quellen: OECD Fiscal Decentralisation Database (https://www.oecd.org/en/data/datasets/oecd-fiscal-decentralisation-database.html); * IMF Data, Access to Macroeconomic & Financial Data, Fiscal Decentralization (https://data.imf.org/?sk=1c28ebfb-62b3-4b0c-aed3-048eeebb684f).
Tabelle 1: Öffentliche Ausgaben subnationaler Regierungsebenen in Prozent der gesamten öffentlichen Ausgaben
Gemessen an diesem Ausgabenanteil ist der Grad der Dezentralisierung in fast allen föderalen Staaten im Jahr 2022 mit mindestens 40 Prozent relativ hoch. Außerdem hat die Dezentralisierung seit 1995 zum Teil deutlich zugenommen, besonders in Belgien, Deutschland und Kanada. Allerdings ist auch in einigen unitarischen Staaten der Ausgabenanteil subnationaler Gliedstaaten erheblich, vor allem in den skandinavischen Ländern Dänemark, Finnland und Schweden, aber auch in Polen und Spanien. In allen fünf Ländern ist der Anteil um mehr als 9 Prozentpunkte gestiegen. In anderen Staaten hingegen ist die Dezentralisierung deutlich zurückgegangen, so in Irland, Japan, den Niederlanden und Südafrika.
Für die Dezentralisierungsgrade der Länder kann es unterschiedliche Gründe geben. Ein wesentlicher Grund für einen hohen Dezentralisierungsgrad ist zunächst die jeweilige Verfassungsstruktur. Föderale Staaten sind tendenziell dezentraler organisiert als unitarische Staaten. Die historische Entstehung von Bundestaaten kann den Dezentralisierungsgrad von Ländern wie Belgien, Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika erklären. Ein weiterer Grund kann die Größe der Länder bezüglich der Landesfläche oder der Bevölkerungszahl sein. In großen Ländern wie Australien, Brasilien, Kanada, Russland und den Vereinigten Staaten können die Skalenvorteile, also die Ersparnis an Ausgaben bei zentraler Bereitstellung, geringer sein als in kleineren Ländern. Zudem ist plausibel, dass die Präferenzen der Bevölkerung für öffentliche Güter in großen Ländern heterogener sind. Um diese dann gezielter befriedigen zu können, sind dezentrale Strukturen vorteilhaft. Ist außerdem die Größe des Landes verbunden mit einer geringeren Bevölkerungsdichte, dann werden sogenannte Spillover-Effekte4 zwischen einzelnen Landesregionen eine geringere Rolle spielen. Auch dies macht eine Regulierung der Politik auf zentraler Ebene weniger notwendig. Diese Argumente werden in den Teilen II und III vertieft.
Allerdings hat der Ausgabenanteil als Indikator für Dezentralisierung einen Nachteil. Das Maß sagt nichts darüber aus, ob die subnationalen Regierungen die Kontrolle über den jeweiligen Ausgabenposten haben. In welchem Ausmaß können sie die Politikziele mitbestimmen? Inwieweit haben sie Einfluss auf die Durchführung der politischen Maßnahmen und auf die Höhe des Budgets, das dafür veranschlagt wird? Wird das Budget aus eigenen Mitteln finanziert oder nimmt die subnationale Regierung Mittel in Anspruch, die ihr von der Zentralregierung zugewiesen werden? Wie groß ist die finanzielle Kontrolle auch im weiteren Verlauf eines solchen Projekts? Diese Fragen zeigen, dass ein höherer Ausgabenanteil einen ersten Hinweis auf den Grad der Dezentralisierung geben kann, aber nicht deckungsgleich mit dem Vorhandensein von Kompetenzen nachgelagerter Regierungsebenen ist. Das erklärt zum Teil, warum unitarische Staaten so hohe Ausgabenanteile ihrer Gliedstaaten aufweisen können.
Ähnliche Probleme gibt es für das Maß des Einnahmenanteils subnationaler Regierungen. Aus dieser Kritik heraus hat man Indikatoren der Steuerautonomie entwickelt, die die Steuereinnahmen subnationaler Regierungen um Kriterien für deren Entscheidungsfreiheit erweitert. So wird neben dem Anteil der Steuereinnahmen am Gesamtsteueraufkommen des Staates betrachtet, in welchem Ausmaß die Gliedstaaten den Steuersatz oder die Steuerbemessungsgrundlage festlegen können. Außerdem wird berücksichtigt, welchen Einfluss subnationale Regierungen auf die Aufteilung von Gemeinschaftssteuern auf alle Staatebenen haben.5
Für alle politischen Entscheidungen, die einer gesellschaftlichen Norm entsprechen sollen, also zum Beispiel der Gerechtigkeit oder der Effizienz, muss eine Regierung die Präferenzen ihrer jeweiligen Bürgerschaft gut kennen. Das ist aus ökonomischer Sicht der entscheidende Vorteil einer dezentralen Politik.6 Damit dezentrale Regierungen Entscheidungen treffen können, die auf die lokalen Präferenzen ihrer Bürger abgestimmt sind, müssen sie autonom sein. Nur so kann in bestimmten Bereichen flexibel und bürgernah regiert werden. Wir werden im Folgenden unter Dezentralisierung verstehen, dass der Zentralstaat den subnationalen Regierungen nicht nur politische Aufträge und gegebenenfalls Budgetmittel zuweist, sondern dass er gleichzeitig auch die Kompetenzen für autonome Entscheidungen überträgt.
1.2Aufriss des Buches
Wie der Titel besagt, ist das Buch eine Darstellung der Theorie zum Thema Föderalismus. Zunächst werden in Teil I die Aufgaben des Staates bestimmt. In den weiteren Teilen wird untersucht, inwiefern ein föderaler Staat geeignet ist, diese Aufgaben zu erfüllen. Die Ergebnisse und Konsequenzen einer Dezentralisierung politischer Entscheidungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft sollen vorgeführt und aus verschiedenen Perspektiven dargestellt werden. Dabei wird versucht, die ökonomische Theorie möglichst in einem einheitlichen Modellrahmen zu präsentieren. In den Teilen II und III ist das ein normativer Ansatz, bei dem die staatlichen Entscheidungen der Regierungen an einem Sozialplaner gemessen werden, der die Normen der Pareto-Effizienz und der Gerechtigkeit anlegt. Im Teil IV werden die Entscheidungen der Regierenden in einem Ansatz der Prinzipal-Agenten-Theorie (Political-Agency-Modelle) daran gemessen, ob die Präferenzen der Wähler bestmöglich befriedigt werden. Um hier den gemeinsamen Modellansatz zu wahren, werden keine Medianwählermodelle präsentiert.7 Das große Forschungsfeld empirischer Untersuchungen hätte den Rahmen des Buches gesprengt und wird ebenfalls ausgeklammert.8 Gelegentlich wird auf einzelne empirische Ergebnisse als Ergänzung zu den Modellen hingewiesen. Zudem werden viele anschauliche Beispiele sowie graphische Darstellungen präsentiert, um die Erklärungsansätze und Modelle zu illustrieren.
Im Teil I wird zunächst gefragt, welche Aufgaben in einer Gesellschaft vom Staat übernommen werden sollten. Die Alternative wäre eine gesellschaftliche Selbstorganisation, die über einen Markt individuelle Interessen verhandelt und über private Verträge regelt. Der Staat sollte dann Aufgaben übernehmen, wenn diese Selbstorganisation nicht funktioniert. Die Frage ist also, unter welchen Bedingungen eine marktwirtschaftliche Lösung gesellschaftlicher Interessenskonflikte versagt. Es wird der Versuch unternommen, alle staatlichen Aufgaben auf das Kooperationsproblem des Trittbrettfahrerverhaltens zurückzuführen. Freiwillige, über private Verträge herstellbare Kooperation kommt in den Konfliktfällen nicht zustande, wenn ein Abweichen von der kooperativen Lösung einen individuellen Vorteil verschafft. In solchen gesellschaftlichen Situationen kann die Institution des Staates, ausgestattet mit dem Gewaltmonopol, Kooperation erzwingen, die alle Gesellschaftsmitglieder besser stellt.
Das Kapitel 2 zeigt zunächst, wie der Rechtsstaat die Gesellschaft durch eine Eigentumsordnung aus einem für alle nachteiligen Naturzustand befreien kann. Dabei spielen die beiden Eigenschaften der Nicht-Rivalität und der Nicht-Ausschließbarkeit der Dienstleistung, die den rechtsstaatlichen Schutz für alle Bürger kennzeichnen, eine entscheidende Rolle. Insbesondere die Nicht-Ausschließbarkeit ist der Grund, warum nur eine staatliche Autorität das Trittbrettfahrerproblem beim Eigentumsschutz überwinden kann.
Das Kapitel 3 geht auf die allokativen Aufgaben des Staates ein, also alle Fälle, in denen die knappen Ressourcen der Ökonomie aufgrund bestimmter Merkmale in der Produktion oder im Konsum auf dem Markt nicht Pareto-effizient eingesetzt werden. Das Pareto-Kriterium besagt, dass in diesen Fällen eine andere Allokation als diejenige, die sich im Markt ergibt, mindestens ein Gesellschaftsmitglied besserstellt, ohne ein anderes schlechter zu stellen. Ein solches Marktversagen tritt auf bei öffentlichen Gütern, die die Eigenschaften der Nicht-Rivalität und der Nicht-Ausschließbarkeit im Konsum haben, und deshalb von Konsumenten mitgenutzt werden können, ohne dass sie dafür einen Preis entrichten. Ein weiterer Fall von Marktversagen sind Güter und Dienstleistungen, die in der Produktion oder im Konsum Nebenwirkungen, sogenannte externe Effekte, verursachen, die auch für diejenigen, die nicht direkt an der Produktion oder am Konsum beteiligt sind, schädliche oder auch nützliche Auswirkungen haben können. Dann geht es um Güter, deren Durchschnittskosten in der Produktion durchgängig fallen, so dass sich auf dem Markt natürliche Monopole bilden, die ineffizient sind. Und schließlich tritt bei vielen Gütern das Problem auf, dass Anbieter und Nachfrager unterschiedliche Informationen über den Wert oder die Qualität besitzen. In diesen Fällen asymmetrischer Information kommt es ebenfalls zu einer ineffizienten Allokation. Alle Marktsituationen dieser Art lassen sich auf das Trittbrettfahrerproblem zurückführen. Der Staat kann deshalb hier eine Funktion haben. Die Möglichkeiten staatlicher Eingriffe werden in allen vier Fällen diskutiert.
Das Kapitel 4 thematisiert die Umverteilungsfunktion des Staates, wenn das marktwirtschaftliche Ergebnis nicht den Gerechtigkeitsvorstellungen der Gesellschaft entspricht. Dabei geht es zum einen um die Einkommensumverteilung und zum anderen um die Absicherung von Lebensrisiken, die über Sozialversicherungen erfolgt. Bei der Einkommensumverteilung ist die Frage, ob sie freiwillig durch eine private Umverteilung von Reichen zu Armen funktionieren kann. Eine freiwillige Umverteilung setzt voraus, dass diejenigen, die die Umverteilung bezahlen, ein Eigeninteresse daran haben. Ist dies nicht der Fall, dann kann Umverteilung nur durch staatlichen Zwang umgesetzt werden. Für den Vergleich zwischen Markt und Staat ist deshalb der andere Fall entscheidend. Sind die Nettozahler altruistisch veranlagt und ziehen selbst einen Nutzen aus dem Transfer an ärmere Personen, dann wird es freiwillig auf Basis privater Vereinbarungen eine Umverteilung geben. Aber diese Umverteilung wird zu gering sein, da einige Reiche sich als Trittbrettfahrer verhalten können und von der Umverteilung durch andere Reiche ebenfalls profitieren. Deshalb versagt hier der Markt und eine staatliche Umverteilung kann ein effizientes Niveau erreichen. Eine zweite Form der Umverteilung sind die staatlichen Sozialversicherungen, da sie nicht risikoabhängig sondern einkommensabhängig finanziert werden. Eine Versicherung von Lebensrisiken ist asymmetrischer Information unterworfen, d. h., dass private Versicherungsunternehmen in der Regel schlechtere Informationen über den möglichen Eintritt des Schadensfalls besitzen als die Versicherungsnehmer. Daraus entsteht das Problem der adversen Selektion, bei der nur noch Personen mit hohem Schadensrisiko versichert werden. Eine staatliche Versicherung kann in dieser Situation erzwingen, dass auch die anderen Risikofälle versichert werden und dadurch wiederum nach dem Pareto-Kriterium eine Verbesserung erreicht wird.
Das Kapitel 5 behandelt die stabilitätsorientierten Aufgaben des Staates. Dabei geht es zum einen um die Fiskalpolitik, insbesondere als Mittel zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit, und zum anderen um die Geldpolitik. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit wird entweder auf asymmetrische Information zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber oder auf steigende Skalenerträge in der Produktion zurückgeführt. Wenn Arbeitnehmer eine schlechtere Information über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens haben, verhandeln sie in die Verträge Absicherungen für schlechte Zeiten hinein. Solche Verträge führen zu einer stärkeren Senkung der Beschäftigung im Krisenfall als effizient wäre. Da es keine privaten Versicherungen gegen Arbeitslosigkeit auf dem Markt wegen des hohen Ausfallrisikos gibt, kann der Staat über eine staatliche Arbeitslosenversicherung die ineffizient niedrige Beschäftigung anheben. Bei steigenden Skalenerträgen in der Produktion verhalten sich die Unternehmen wie Monopolisten mit einem zu hohen Preis und zu geringer Produktion bzw. Beschäftigung. Der Anpassungsmechanismus über geringere Löhne funktioniert hier nicht mehr. Nur eine Erhöhung der aggregierten Nachfrage durch die Fiskal- oder Geldpolitik des Staates kann hier zu einer höheren Beschäftigung führen. Eine weitere Funktion der Geldpolitik ist die Kontrolle der Inflation. Individuell lässt sich Inflation nicht bekämpfen, da es externe Effekte von Lohnzurückhaltung oder höherer Ersparnis gibt. Deshalb kann nur staatliche Geldmengenpolitik einen kollektiven Zwang ausüben, der das Versagen individuell rationalen Verhaltens überwindet.
Das Kapitel 6 zieht die Schlussfolgerungen für kollektives Handeln aus dem Ergebnis, dass alle in den vorherigen Kapiteln betrachteten einschlägigen Situationen, die staatliches Handeln rechtfertigen, auf das Trittbrettfahrerproblem zurückzuführen sind. Insbesondere die Erkenntnisse, die Olson (1992) daraus gezogen hat, werden hier zusammengefasst. Man kann sagen, dass mit dieser Bestimmung der Staatsaufgaben eine genuin ökonomische Theorie des Staates vorliegt.
In Teil II werden staatliche Aufgaben als lokale öffentliche Güter und Dienstleistungen definiert, die einen Nutzen nur für Individuen in einem bestimmten geographischen Raum stiften. Staatliche Einheiten, die solche öffentlichen Güter bereitstellen, werden als Gebietskörperschaften definiert. Aus diesem Ansatz heraus wird bestimmt, wie der Aufbau des Staates aussehen sollte, damit staatliche Aufgaben optimal erledigt werden können. Wie groß sollten Gebietskörperschaften sein, die bestimmte Zuständigkeiten für politische Aufgaben besitzen? Wie viele Gebietskörperschaften sollte es in einem Staat geben, um eine effiziente Versorgung der Bürger mit öffentlichen Gütern und Dienstleistungen sicherzustellen? Wie sollten diese Gebietskörperschaften hierarchisch angeordnet sein, um unterschiedliche staatliche Funktionen ausfüllen zu können?
In Kapitel 7 wird von einer immobilen Bevölkerung ausgegangen, die verteilt in einem Staatsgebiet lebt. In diesem Rahmen werden Kriterien aufgestellt, die zur Bestimmung der optimalen Bevölkerungsgröße einer Gebietskörperschaft herangezogen werden können. Zunächst werden die Prinzipien der perfekten Korrespondenz und der fiskalischen Äquivalenz hergeleitet, die angeben, wie idealerweise Gebietskörperschaften einer Ebene zugeschnitten sein sollten, um effizient ein lokales öffentliches Gut bereitzustellen. Dann werden die Prinzipien auf überlappende Gebietskörperschaften angewandt, die auf übereinander angeordneten Ebenen liegen und unterschiedliche öffentliche Güter anbieten. Ein Vorteil eines föderalen Aufbaus ist, dass dezentrale Wahlen die Präferenzen der Bürger besser enthüllen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Aufteilung eines Staates in Gebietskörperschaften sind die Kosten der Verwaltung und der politischen Entscheidungsfindung. Das Hauptargument für eine Dezentralisierung der Politik ist die Nähe zu den Präferenzen der Bürger. Dieses Argument wird durch das Dezentralisierungstheorem von Oates formalisiert, das hier diskutiert und im Anhang bewiesen wird. Weitere Kriterien, die eher für eine Zentralisierung sprechen, sind steigende Skalenerträge, die eine zentrale Bereitstellung kostengünstiger machen, Spillover-Effekte, die den Nutzen eines öffentlichen Gutes über die Grenzen der Gebietskörperschaft hinaus auch nicht-ansässigen Individuen spenden, sowie Steuerexport, der einen Teil der Kosten des öffentliche Gutes auswärtigen Individuen auferlegt. Schließlich wird hier zum nächsten Kapitel übergeleitet, indem die Annahme immobiler Bevölkerung aufgegeben wird und die Folgen der Mobilität für die Größe einer Gebietskörperschaft diskutiert werden.
Das Kapitel 8 geht grundsätzlich von einer mobilen Bevölkerung aus und stellt zunächst das Tiebout-Modell vor, in dem die Gesellschaftsmitglieder durch ihre Wanderungsentscheidungen ihre Präferenzen für lokale öffentliche Güter enthüllen. Diese sogenannte Abstimmung mit den Füßen führt nur unter bestimmten Voraussetzungen zu einer effizienten Bereitstellung, die wir hier diskutieren. Anschließend wird die Idee von Tiebout, für die er nur einen Modellentwurf geliefert hat, im Rahmen der Clubtheorie formalisiert. Zunächst wird die Gründung und Formation von Gebietskörperschaften durch Individuen, die sich entsprechend ihrer Präferenzen und Einkommen in solchen Gemeinschaften selbst organisieren, analysiert. Es wird ein Modell vorgestellt, in dem eine solche Selbstselektion von Individuen zu homogenen Gruppen in Gebietskörperschaften eine optimale Einwohnerzahl und effiziente Bereitstellung mit dem lokalen öffentlichen Gut zur Folge hat. Danach betrachten wir exogen gegebene Gebietskörperschaften, deren Regierungen im Wettbewerb um Einwohner stehen. Sowohl bei wohlwollenden Regierungen, die die Wohlfahrt der Bürger maximieren, als auch bei sogenannten Leviathan-Regierungen, die im Eigeninteresse das Steueraufkommen maximieren, kann gezeigt werden, dass der Wettbewerb zur optimalen Bevölkerungsgröße und effizienten Versorgung mit öffentlichen Gütern in den Gebietskörperschaften führt.
Wenn Gebietskörperschaften durch eine fixe Ressource wie Land gekennzeichnet sind, ändern sich die Effizienzbedingungen. Die Landrente, die in solchen Gebietskörperschaften eingenommen wird, muss dann zur Finanzierung des lokalen öffentlichen Gutes herangezogen werden. Das wird mit dem sogenannten Henry-George-Theorem gezeigt. Der Erwerb von Land und Immobilien kann dazu dienen, die Zahlungsbereitschaft von Einwanderern für die Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter zu ermitteln. Dezentraler Wettbewerb unter lokalen Regierungen, die diese Information nutzen, kann auch in diesem Fall zur effizienten Allokation führen. Wenn hingegen mehrere Ebenen von Gebietskörperschaften verschiedene lokale öffentliche Güter für ein bestimmtes Gebiet bereitstellen, ist eine Dezentralisierung der politischen Entscheidungen bis auf die kleinstmögliche Gebietskörperschaft, die jeweils nur den Nutzerkreis ihres spezifischen Gutes umfasst, nicht mehr effizient. Für solche überlappenden Gebietskörperschaften kann gezeigt werden, dass nur sogenannte Metropolregionen, die auch solche lokalen öffentlichen Güter bereitstellen, die nur für einen Teilbereich der Region Nutzen stiften, die optimale Politik garantieren. Eine weitere Dezentralisierung auf Teilregionen ist ineffizient.
In Teil III wird von dem Bestehen eines föderalen Staatsgebildes ausgegangen und untersucht, auf welcher föderalen Ebene politische Kompetenzen angesiedelt sein sollten. Dabei wird zwischen allokativen Kompetenzen, die die Effizienz der Bevölkerungsansiedlung, der Kapitalverteilung und Bereitstellung öffentlicher Güter zum Ziel haben, und distributiven Kompetenzen, die eine gerechte Umverteilung von individuellen Einkommen und von Budgeteinnahmen der Regionen anstreben, unterschieden.
Das Kapitel 9 geht auf die Anreizwirkungen von regionalen Steuern auf die Ansiedlung von Individuen in einer Gebietskörperschaft ein. Für eine effiziente Bevölkerungsverteilung kommt es auf die Verfügbarkeit von wohnsitzabhängigen und wohnsitzunabhängigen Steuern an. Wenn wohnsitzabhängige Steuern zwar bezüglich der Mobilitätsentscheidungen effizient sind, aber darüber hinaus die Nachfrage nach Land verzerren, können Flächennutzungspläne (Fiscal Zoning) eingesetzt werden, um diese Ineffizienz zu vermeiden. Bei der Kapitalallokation geht es zunächst darum, wie sich der Steuerwettbewerb zwischen kleinen Regionen, die keinen Einfluss auf den Weltmarktzins des Kapitals haben, und zwischen großen Regionen auswirkt. Der Wohlfahrtsverlust durch Steuerwettbewerb kann durch fiskalische Externalitäten erklärt werden, also wechselseitige Einflüsse der Kapitalwanderung auf die Budgets der Regionen, die bei den fiskalischen Entscheidungen nicht berücksichtigt werden. Es wird dann gezeigt, wie eine Zentralregierung diese Externalitäten durch vertikale Subventionen internalisieren kann und damit eine effiziente regionale Steuerpolitik herbeiführt. Schließlich werden Spillover-Effekte und Steuerexport analysiert, die bei der Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter auftreten können, wenn die Größe der Gebietskörperschaften nicht perfekt zugeschnitten ist. Spillover-Effekte sind Nutzenauswirkungen von lokalen öffentlichen Gütern auf Nachbarregionen, bei denen sich die lokalen Regierungen für zu geringe Versorgungsmengen entscheiden, weil sie diese externen Nutzen nicht berücksichtigen. Steuerexport bedeutet, die Kosten lokaler öffentlicher Güter werden zum Teil von Nachbarregionen über bestimmte Steuern mitfinanziert. Diese Kostenabwälzung führt zu einer zu großen Bereitstellung mit dem lokalen öffentlichen Gut. In einer Ökonomie mit vollkommen mobiler Bevölkerung muss eine Regierung die Wanderungsanreize, die sie mit ihrer Politik öffentlicher Güter und deren Finanzierung setzt, berücksichtigen. Wenn sie dies tut, dann werden die Effekte von Spillover und Steuerexport internalisiert (Anreizäquivalenz) und die Allokationsentscheidungen der Regierungen sind effizient. Ist die Bevölkerung hingegen ganz oder teilweise immobil, dann können für die lokalen Regierungen Anreize über einen vertikalen Finanzausgleich einer zentralen Regierung gesetzt werden, die zu effizienten Entscheidungen führen.
In Kapitel 10 geht es um die föderale Zuordnung von Kompetenzen zur Umverteilung von Einkommen. Zunächst wird gezeigt, dass eine identische Umverteilungspolitik in Gebietskörperschaften dennoch zu einer ungleichen Behandlung von Bürgern führen kann. Der Grund ist, dass die Zusammensetzung der Bevölkerung an reichen und armen Individuen verschieden ist. Diese unterschiedliche Bevölkerungsstruktur führt zu ungleichen Umverteilungskapazitäten der Gebietskörperschaften. Um eine horizontal gerechte Umverteilung zwischen allen Bürgern zu erreichen, müssen dann diese Unterschiede in den Budgets der Gebietskörperschaften ausgeglichen werden. Deshalb ist eine horizontal gerechte Umverteilung individueller Einkommen geknüpft an eine Umverteilung, die die Budgets der regionalen Regierungen ausgleicht. Eine dezentrale Umverteilung von Einkommen in den Regionen sollte deshalb bei immobiler Bevölkerung durch einen horizontalen Finanzausgleich begleitet werden, um horizontale Gerechtigkeit für die Bürger aller Regionen herbeizuführen. Bei mobiler Bevölkerung kann es bei dezentraler Umverteilung allerdings zu einem Wettlauf der Umverteilungsniveaus nach unten kommen. Eine Absenkung der Umverteilung kann in einer Gebietskörperschaft reiche Individuen anziehen und arme Individuen abschrecken. Da diese Wanderungseffekte für eine Region vorteilhaft sein können, führt das zu einem Unterbietungswettbewerb bei der Umverteilung. Eine wohlfahrtsoptimale Umverteilung zwischen allen Bürgern kann dann nur durch eine Zentralregierung umgesetzt werden.
Umverteilung muss nicht zur Folge haben, dass es Gewinner und Verlierer gibt. Wenn Umverteilung auf Altruismus beruht, können auch die Nettozahler einen Nutzen daraus ziehen. In dem Fall nimmt Umverteilung den Charakter eines öffentlichen Gutes an, der den Nutzen aller erhöht. Wenn man diese Perspektive einnimmt, kann nach der Höhe der Umverteilung gefragt werden, im Vergleich zu der kein anderes Umverteilungsniveau die Beteiligten – Zahler oder Empfänger – besser stellen kann, ohne jemand anderen schlechter zu stellen. Die Frage ist dann, ob eine solche Pareto-effiziente Umverteilung besser zentral oder dezentral erreicht wird. Bei immobiler Bevölkerung ist eine dezentrale Umverteilung effizient, weil sie auf die lokalen Präferenzen Rücksicht nimmt. Eine zentrale Umverteilung, die die Bürger aller dezentralen Gebietskörperschaften gleich behandeln muss, kann hingegen nur die durchschnittliche Zahlungsbereitschaft berücksichtigen, was in jeder lokalen Gebietskörperschaft zu einem ineffizienten Umverteilungsniveau führt. Bei mobiler Bevölkerung wird eine dezentrale Umverteilung Wanderungsanreize setzen. Da die Kosten der Umverteilung dadurch steigen, dass Nettoempfänger angezogen und Nettozahler abgeschreckt werden, werden die lokalen Regierungen ein ineffizient geringes Umverteilungsniveau wählen. Eine Zentralregierung, die durch die Gleichbehandlung aller Individuen keine Migrationsanreize setzt, wird zwar weiterhin eine ineffiziente zentrale Umverteilung betreiben. Wenn sie aber die Migrationsexternalitäten einer dezentralen Umverteilung durch vertikale Subventionen internalisiert, kann sie dadurch auf lokaler Ebene Anreize für effiziente Umverteilungsniveaus setzen.
Das Kapitel 11 vergleicht die verschiedenen Arten zwischenstaatlicher Transfers und fragt nach der bestmöglichen Verwendungsweise dieser Transfers. Man unterscheidet hier zwischen horizontalen Transfers, die zwischen Gebietskörperschaften einer Ebene stattfinden, und vertikalen Transfers, die von einer übergeordneten an eine untergeordnete föderale Ebene geleistet werden. Zweckgebundene Transfers sind an bestimmte Aufgaben der Empfänger geknüpft. Wenn es um die Umverteilung von Einnahmen oder Ausgaben zwischen Gebietskörperschaften geht, sind allgemeine horizontale Transfers ohne Zweckbindung, sogenannte Pauschaltransfers (block grants), am besten geeignet, die Finanzausstattung auszugleichen, ohne verzerrende Effekte auf die Politik der lokalen Entscheidungsträger auszuüben. So ein Finanzausgleich kann auch durch vertikale Zuweisungen von zentraler Ebene geschehen, die eine horizontal ausgleichende Wirkung besitzen. Wenn es hingegen um die Internalisierung von Spillover-Effekten, Steuerexport oder Migrationsexternalitäten geht, sind vertikale Zuschüsse mit Zweckbindung für eine effiziente Politik vorzuziehen, die sich an den Stückkosten der öffentlichen Bereitstellung beteiligen (matching grants). Weiterhin wird die Möglichkeit der Deckelung von zweckgebundenen Zuweisungen untersucht, bei der die Grenzkosten der Bereitstellung nur bis zu einer bestimmten Fördergrenze subventioniert werden. Eine solche Begrenzung der Fördermittel ist aber entweder wirkungslos, wenn die Entscheidungen der lokalen Regierungen unterhalb der Fördergrenze bleiben, oder sie internalisieren die externen Effekte nicht mehr, und es gibt nur einen Mitnahmeeffekt, der ineffizient ist.
In Kapitel 12 wird ein strategisches Problem bei der Gewährung von vertikalen Subventionen von einer Zentralregierung an die lokalen Regierungen untersucht. Es geht um das Problem des Bailout, also der Unterstützung von Gebietskörperschaften durch eine zentrale Regierung, die für die lokalen Regierungen Anreize setzt, unwirtschaftlich mit ihren Haushaltsmitteln umzugehen. Man spricht hier auch von weichen Budgetbeschränkungen, wenn die Lokalregierung durch ihre Fiskalpolitik überhöhte Zuweisungen der Zentralregierung strategisch hervorrufen kann. Dieses Bailout, also die Rettung in fiskalisch schwierigen Situationen, kann die Herbeiführung dieser Notlage provozieren. Entscheidend dafür ist, dass die Zentralregierung auf die Entscheidungen der Lokalregierung mit ihrer Rettungspolitik reagiert. Erst dadurch kann die lokale Ebene Einfluss auf die zentralen Subventionen nehmen, indem sie eine entsprechende Politik wählt. Wenn die Zentralregierung hingegen von vorneherein das Ausmaß ihrer Subventionen festlegen und diese nicht an die Entscheidungen der Lokalregierungen anpassen würde, wäre strategisches Verhalten ausgeschlossen. Es bleibt aber die Frage, wie glaubwürdig eine solche „harte“ Zentralpolitik ist, wenn sie sich weitergehenden Hilfsmaßnahmen gegenüber den lokalen Gebietskörperschaften von vorneherein verschließt.
Teil IV wendet sich den politökonomischen Ansätzen zur Analyse föderaler Systeme zu. Dabei wird unterstellt, dass die Regierungen nicht mehr benevolent die Wohlfahrt der Bürger maximieren, sondern dass sie Eigeninteressen verfolgen, die von den Zielen der Bürger abweichen können. Methodisch wird dafür das Prinzipal-Agenten-Modell gewählt. Dabei wird der Wähler als Auftraggeber (Prinzipal) verstanden, der der Regierung als Auftragnehmer (Agent) eine bestimmte politische Aufgabe erteilt. Die Regierung stellt sich dann nach der ersten Legislaturperiode zur Wiederwahl, und der Wähler muss entscheiden, ob sie ihre Aufgabe gut erfüllt hat. Wenn das der Fall ist, wird er den Amtsinhaber wiederwählen, sonst nicht. Die Schwierigkeit besteht in der asymmetrischen Information zwischen Wähler und Politiker, da der Wähler nicht sicher beobachten kann, ob der Amtsinhaber genug Anstrengung bei der Bewältigung der Aufgabe unternommen hat.
In Kapitel 13 wird das Prinzipal-Agenten-Modell zunächst auf eine Zentralregierung angewendet, die einer nachgeordneten lokalen Regierung eine bestimmte politische Maßnahme aufträgt. Die Zentralregierung kann aber nicht genau beobachten, ob das Ergebnis, wie die Maßnahme umgesetzt wurde, auf die Leistung der lokalen Regierung oder andere Zufallseinflüsse zurückzuführen ist. Deshalb kann die lokale Regierung ihren Aufwand reduzieren und dies damit kaschieren, dass das schlechtere Ergebnis auf exogenen Umständen beruhe. Die Zentralregierung kann dann durch zwei unterschiedliche Formen der Verknüpfung von Finanzierung und Aufgabenerfüllung (Konnexitätsprinzip) versuchen, die lokale Regierung zu effizientem Handeln zu bewegen. Bei der sogenannten Ausführungskonnexität werden der ausführenden Gebietskörperschaft, also der lokalen Regierung, die anfallenden Ausgaben aufgebürdet, wobei sie pauschal von der Zentralregierung eine Mittelzuweisung erhält, mit der sie auskommen muss. Bei der Veranlassungskonnexität übernimmt die veranlassende Gebietskörperschaft, also die Zentralregierung, die Kosten der Maßnahme. Mithilfe der Prinzipal-Agenten-Theorie kann man zeigen, dass die Ausführungskonnexität zu einer effizienten Aufgabenerfüllung führt.
In Kapitel 14 geht es um die Prinzipal-Agenten-Beziehung zwischen Wähler und Regierung. Auch hier kann der Auftraggeber, nämlich der Wähler, nur unzureichend feststellen, ob die Regierung nach einer Amtsperiode eine gute Politik betrieben hat. Da eine schlechte Performance auch auf Zufallsereignissen beruhen kann, muss der Wähler Signale nutzen, um eine amtierende Regierung bei der Wiederwahl entsprechend zur Verantwortung zu ziehen. Diese Zuordnung politischer Verantwortung (Political Accountability) kann nun bei dezentralen Regierungen, die nur für ihre Gebietskörperschaft zuständig sind, besser erfolgen, als bei einer Zentralregierung, die nur in einer Mehrheit von Gebietskörperschaften eine erfolgreiche Politik vorweisen muss, um wiedergewählt zu werden.
In Kapitel 15 geht es für den Wähler darum, zwischen regierenden Amtsinhabern zu unterscheiden, die eine gute Politik im Sinne der Wähler durchführen und das Steueraufkommen für öffentliche Güter ausgeben, und solchen schlechten Amtsinhabern, die aus dem Steueraufkommen für eigene Zwecke Renten abzweigen. Wahlen haben hier zwei Funktionen. Zum einen können sie dazu dienen, schlechte Amtsinhaber abzuwählen (Selektionseffekt). Zum anderen können sie aber auch für schlechte Amtsinhaber Anreize setzen, sich in der Amtsperiode nicht allzu schlecht zu präsentieren, damit sie für eine zweite Amtszeit wiedergewählt werden (Disziplinierungseffekt). Verfassungsrechtliche Maßnahmen, wie fiskalische Beschränkungen für Regierungen, können zwar dazu führen, dass schlechte Amtsinhaber sich disziplinieren lassen und eine gute Politik in der ersten Amtszeit vorweisen. Damit erhöht sich aber die Wahrscheinlichkeit, dass schlechte Amtsinhaber wiedergewählt und eben nicht herausselektiert werden. Ob solche fiskalischen Beschränkungen dann die Wohlfahrt der Wähler erhöhen, hängt von der Gewichtung beider Effekte ab.
Das Kapitel 16 demonstriert die positive Seite des Steuerwettbewerbs, wenn es darum geht, übermäßige Steuererhebung von Regierungen zu begrenzen. Der Wettbewerb um mobile Produktionsfaktoren veranlasst dezentrale Regierungen zu Steuersenkungen. Dieser Wettlauf nach unten (race to the bottom) hat bei Leviathan-Regierungen, die Renten aus dem Steueraufkommen abzweigen wollen, eine positive Wohlfahrtswirkung. Im Vergleich zur Wirkung von direkten fiskalischen Beschränkungen ist der Steuerwettbewerb allerdings nur dann das bessere Instrument, wenn es einen hinreichend großen Anteil an guten Kandidaten für das politische Amt gibt, die bei der Abwahl eines schlechten Politikers ins Amt kommen können. Der Steuerwettbewerb erhöht die Wohlfahrt, wenn schlechte Amtsinhaber sich offenbaren und nicht wiedergewählt werden, und wenn dieser Selektionseffekt stärker ins Gewicht fällt als der Disziplinierungseffekt. Letzteres ist der Fall, wenn es genug gute Politiker gibt, die als Herausforderer des Amtsinhabers gewählt werden können. Gibt es diese nicht, dann kommt der Disziplinierung ein stärkeres Gewicht in der Wohlfahrt zu, und fiskalische Beschränkungen sind das bessere Instrument.
In Kapitel 17 geht es um eine weitere Form des Wettbewerbs bei Dezentralisierung der Politik. Beim sogenannten Maßstabswettbewerb (Yardstick Competition) können die Wähler die Politik ihrer Regierung vergleichen mit der Politik eines Nachbarlandes. Wenn die Kosten und Möglichkeiten der Politik in beiden Ländern ähnlich sind, dann kann der Vergleich den Wählern zeigen, ob die eigene Regierung eine gute oder schlechte Politik betreibt. Amtsinhaber, die sich dann aufgrund ihrer Performance als schlecht erweisen, werden abgewählt. Auch hier kann gezeigt werden, dass der Maßstabswettbewerb die Wohlfahrt nur dann erhöht, wenn der Selektionseffekt mehr Gewicht hat als der Disziplinierungseffekt. Der Maßstabswettbewerb ist ein weiteres Argument für die Dezentralisierung von politischen Entscheidungen. Je mehr Gebietskörperschaften untereinander in diesem Wettbewerb stehen, umso besser kann politische Verantwortung einem schlechten Amtsinhaber zugeordnet werden, da er sie nur dann verschleiern könnte, wenn alle vergleichbaren Regierungen ebenfalls schlechte Politik machen würden.
In Kapitel 18 werden die Vor-oder Nachteile der Dezentralisierung mit der Zentralisierung verglichen, wenn eine lokale Regierung sich nur durch ihr Budget von einer zentralen Regierung unterscheidet. Der Informationsgrad der Wähler über die Politik der Nachbarländer und die Ähnlichkeit der ökonomischen und politischen Umstände zwischen den Ländern sind dann die entscheidenden Faktoren, die den Vergleich bestimmen. Wenn Wähler nur partielle Informationen über die Politik in anderen Ländern besitzen und die Kosten der Politik zwischen den Ländern nicht perfekt korreliert sind, gibt es keine Möglichkeit des Maßstabswettbewerbs zwischen den Ländern. In diesem Fall hängt die Stärke des Selektionseffekts und des Disziplinierungseffekts bei Dezentralisierung und Zentralisierung von der Konstellation der genannten Faktoren ab.
Das Kapitel 19 geht abschließend auf einige weitere Aspekte des Föderalismus ein und beschreibt kurz Forschungsergebnisse, die sich dazu in der Literatur finden. Es geht um den Flypaper-Effekt und die fiskalische Illusion, den Aspekt der interregionalen Versicherung durch zentralstaatliche Subventionen, die Wirkung von Dezentralisierung auf Korruption und Lobbyismus, Wachstumseffekte der Dezentralisierung in China und Russland und den Laboratoriumsföderalismus. Zukünftige Herausforderungen für den Föderalismus stellen sich bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union. Sowohl die Finanzverfassung der EU als auch die Ansiedlung einzelner Politikfelder auf der europäischen Ebene werden in der Literatur analysiert und diskutiert. Weitere Herausforderungen sind der Umwelt- und Klimaschutz sowie der gesundheitspolitische Umgang mit Pandemien.
1Diese Definition unterscheidet sich von der von Oates (1972, S. 17f.), der auch einen solchen Staat föderal nennen würde. Wie wir sehen werden, ist dieser Unterschied wesentlich für die Gültigkeit des sogenannten Dezentralisierungstheorems von Oates.
2Vgl. OECD/UCLG (2022), S. 25f., sowie Boadway und Shah (2009), S. 4ff. Gegenwärtig gibt es 24 föderale Staaten, die etwa 40 Prozent der Weltbevölkerung repräsentieren: Argentinien, Australien, Äthiopien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Föderation Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Deutschland, Indien, Irak, Kanada, Komoren, Malaysia, Föderierte Staaten von Mikronesien, Nepal, Nigeria, Österreich, Pakistan, Schweiz, Somalia, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten von Amerika.
3Zu den Einheitsstaaten gehören Länder wie Ägypten, China, Frankreich, Indonesien, Italien, Japan, Korea, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Schweden, die Türkei und Großbritannien.
4Spillover-Effekte sind Nutzenauswirkungen einer lokalen Politik auf die Nachbarregionen. Siehe Kapitel 7.6.
5Für diese Maße der Steuerautonomie und die Ergebnisse verweise ich auf Ebel und Yilmaz (2002), Stegarescu (2005) und OECD/Korea Institute of Public Finance (2013)
6Siehe dazu insbesondere Kapitel 7.4 und 14.
7Siehe dazu Wildasin (1986, 1987b).
8Eine erste wichtige empirische Arbeit zur Frage, wie sich die Größe und der Wohlstand eines Landes und unterschiedliche Formen von Heterogenität der Bevölkerung auf die Zentralisierung der Politik (gemessen in Einnahmen- und Ausgabenanteilen) auswirken, stammt von Oates (1972, Kapitel 5). Weitere wesentliche ökonometrische Beiträge zu den Determinanten fiskalischer Zentralisierung sind u. a. Wallis und Oates (1988), Panizza (1999) und Stegarescu (2009).
Teil I ∙ Eine ökonomische Theorie des Staates
„A theory of governmental structure begins most naturally with why we need governments.“
Mancur Olson
„Der moderne Staat hat zwei Aufgaben: Er setzt die verfassungsmäßige Ordnung durch, und er stellt ‚öffentliche Güter‘ bereit. […] ‚Das Recht‘ selbst ist ein ‚öffentliches Gut‘.“
James Buchanan
Alle Aufgaben des Staates lassen sich so definieren, dass sie der Befriedigung solcher individuellen Interessen durch Zwang dienen, die sonst durch private Vereinbarung aufgrund des Trittbrettfahrerproblems nicht befriedigt werden könnten. Bei diesen Aufgaben kann es sich um den Rechtsschutz, die Landesverteidigung oder die Bekämpfung von Kriminalität handeln, oder es geht um die Bereitstellung von Infrastruktur, Gesundheits- oder Bildungswesen.9 Gemeinsam ist allen diesen Aufgaben, dass sie privat und individuell von den Bürgern nicht in ausreichendem Maß oder gar nicht erledigt würden, obwohl die Erfüllung dieser Aufgaben allen Bürgern einen Nutzen stiften, sie also besser stellen würde.
Dieser Teil des Buches ist der Versuch, die ökonomischen Rechtfertigungsgründe der Staatstätigkeit auf das Trittbrettfahrerproblem zurückzuführen und den Staat als Mittel der Selbstbindung (commitment device) zu verstehen, mit dem das Trittbrettfahrerverhalten überwunden werden kann. Es handelt sich also um eine ökonomische Staatstheorie aus einem Prinzip heraus.10
Wir beginnen mit der Frage, wie Individuen in einer Gesellschaft ihre Interessen und Ziele erreichen können. Grundsätzlich gibt es zwei Herangehensweisen. Die erste ist die über freiwillige Vereinbarungen und private Verträge zwischen den Individuen. Die zweite ist die Organisation der Einzelinteressen durch staatliche Institutionen zum Wohl der Individuen. Beide Wege können sich ergänzen oder als Alternativen betrachtet werden.
Jedes Individuum verfolgt sein eigenes Interesse, selbst wenn es altruistische Ziele sind. Im ökonomischen Sinn versteht man unter der Verfolgung eigener Interessen, dass die Individuen sich für das entscheiden, was ihnen den höchsten Nutzen stiftet oder was sie unter allen verfügbaren Optionen am meisten präferieren. Diese rein formale Entscheidungsmaxime kann eben auch beinhalten, dass man präferiert, den Nutzen anderer zu steigern, anderen zu helfen, sich also altruistisch zu verhalten. Man kann unterstellen, dass die meisten Ziele in der Verwirklichung eigener Vorteile bestehen. Nun gibt es Eigeninteressen, die ein Individuum für sich allein verfolgen kann, weil sie die Interessen von niemand anderem einschränken oder berühren und weil sie vollkommen autonom umgesetzt werden können. Dies könnte man den Bereich der Privatsphäre nennen, in dem jeder unabhängig von anderen tun oder lassen kann, was er will. Dann gibt es aber eigene Interessen und Ziele, zu deren Erreichung ein Individuum auf andere Individuen angewiesen ist, entweder weil es einen Interessenskonflikt gibt oder weil sich die wechselseitigen Interessen gemeinsam besser verwirklichen lassen. Dies könnte man die soziale Sphäre nennen. In dieser Interessenssphäre kann das Individuum mit anderen in Verhandlungen treten. Im Wesentlichen wird es in diesen Verhandlungen um einen Abgleich der Interessen gehen, also um die Frage, wie man sich wechselseitig bei der Erreichung der Ziele unterstützen kann, und um einen Vertrag, der den dazu notwendigen Austausch von Aktivitäten und Rechten regelt.
Aus ökonomischer Sicht kann man diesen Teil der sozialen Sphäre als Markt betrachten. Der Markt ist nichts anderes als eine gesellschaftliche Selbstorganisation über private Verträge. Der Markt ist der Ort, an dem alle gesellschaftlichen Angelegenheiten, die die Einzelinteressen verschiedener Individuen berühren, in wechselseitigen Verträgen geregelt werden. In diesen privaten Verträgen wird der Austausch von Rechten vereinbart, die zum Beispiel das Eigentum an Gütern, die Bereitstellung von Dienstleistungen oder die Aufteilung von Einkommen und Vermögen betreffen. Durch vom Staat durchgesetzte Verträge können die Individuen ihre Interessen und Ziele in der sozialen Sphäre besser erreichen, als wenn sie sich diese in einem Naturzustand erkämpfen müssten.
9Einige dieser Aufgaben betreffen sogenannte öffentliche Güter, andere verursachen externe Effekte. Wir werden in den Kapiteln 2 bis 5 auf die unterschiedlichen Gründe für das Auftreten von Trittbrettfahrerverhalten zurückkommen.
10Dieser Teil I baut auf dem Ansatz von Robert Inman (1987) auf, dass alle Formen von Marktversagen einen gemeinsamen Grund haben, und der Staat als Institution kollektives Handeln gegenüber nicht-kooperativem individuellem Handeln durchsetzen kann.
2Rechts- und Eigentumsordnung
Nach Thomas Hobbes (1651) ist die Gesellschaftsform des Naturzustands die Anarchie, also eine Gesellschaft ohne staatliche Autorität, in der alle gegeneinander einen Überlebenskampf führen (der Krieg aller gegen alle). So etwas wie ein Recht auf Eigentum gibt es hier nicht. Jeder muss das, was er besitzt, gegen die anderen verteidigen. Und es ist weder legal noch illegal, wenn jeder versucht, dem anderen seinen Besitz streitig zu machen, da es im Naturzustand kein Gesetz gibt und daher auch kein Begriff von Legalität existiert.11 In diesem Zustand herrscht bedingungslose Freiheit. Ist dieser Zustand aber zum Vorteil aller Individuen der Gesellschaft, oder lässt sich ein Zustand finden, in dem wenigstens einige oder sogar alle ihre Interessen besser befriedigen können und keiner sich schlechter stellt?
Betrachten wir folgende Situation, in der das sogenannte Gefangenendilemma12 entsteht. Zwei Individuen A und B haben jeweils einen Besitz Y und können sich dafür oder dagegen entscheiden, dem anderen den Betrag Z seines Besitzes wegzunehmen: Z < Y. Wenn sie sich für Wegnehmen entscheiden, verursacht dies Kosten C, die aber geringer sind als der Gewinn aus dem Diebstahl: C < Z.13 Andernfalls wäre der Diebstahl gar keine Option. Es wird angenommen, dass jeder Diebstahl erfolgreich ist. Beide Individuen überlegen sich jetzt, ob sie den anderen bestehlen oder nicht. Daraus ergeben sich folgende Nettovorteile je nach den Entscheidungen von A und B:14
Nettoauszahlungen für A: unten links, Nettoauszahlungen für B: oben rechts
Tabelle 2.1: Gefangenendilemma des Naturzustands
Wenn beide nicht stehlen, behalten sie ihren Besitz und haben keine weiteren Kosten: (Y, Y). Wenn A den B bestiehlt, B aber nicht stiehlt, dann hat B nur noch eine Nettoauszahlung von Y − Z, während A durch den Diebstahl zusätzlich Z bekommt, aber die Kosten des Stehlens C trägt. Durch den Zugewinn Z − C erhöht sich sein Besitz auf Y + Z − C. Umgekehrt erhält B die Auszahlung Y + Z − C und A erhält Y − Z, wenn B stiehlt, aber A nicht. Wenn beide sich für das Stehlen entscheiden, nehmen sie sich gegenseitig Z weg, so dass ihr Besitz jeweils Y bleibt, sie aber beide die Kosten des Diebstahls tragen: Y − C.
Das gemeinsame Verhalten des Nicht-Stehlens, das zu (Y, Y) führt, erfordert eine Kooperation, die verbindlich für beide ist. Denn es ist für jedes der beiden Individuen von Vorteil, sich für Stehlen zu entscheiden, und zwar ganz unabhängig davon, was der andere macht. Die überlegene Strategie nicht-kooperativen Verhaltens, also des Stehlens, kennzeichnet das sogenannte Gefangenendilemma. Betrachten wir die Entscheidung von A, so stellt er sich mit Diebstahl besser, wenn B sich für Nicht-Stehlen entscheidet: Y + Z − C > Y. Er stellt sich damit aber auch besser, wenn B sich ebenfalls für Stehlen entscheidet: Y − C > Y − Z. Da diese Entscheidung spiegelbildlich auch für B in beiden Fällen vorteilhaft ist, werden sich beide für Stehlen entscheiden und die Auszahlung (Y − C, Y − C) erhalten. Diese Entscheidung im Gleichgewicht, von der keines der beiden Individuen abweicht, führt aber zu geringeren Auszahlungen als bei gleichzeitiger Wahl der Strategie Nicht-Stehlen: (Y, Y). Das heißt, eine gemeinsame kooperative Entscheidung, sich nicht zu bestehlen, würde beide Individuen besser stellen, als wenn sie ihrem individuellen Vorteil folgen und sich für Stehlen entscheiden. Trotz der Besserstellung der Individuen ist dieser kooperative Zustand (Y, Y) aber bei individueller Vorteilsmaximierung nicht erreichbar. Wenn sich beide Individuen für Nicht-Stehlen entscheiden würden, gäbe es für jedes der beiden Individuen den Anreiz, davon abzuweichen und den anderen zu bestehlen. Dieses Verhalten nennt man das Trittbrettfahrerverhalten.15
In diesem Zwei-Personen-Spiel mag es noch sein, dass die beiden Individuen die Situation durchschauen und eine Absprache erfolgt, kooperativ zu handeln. Aber auch hier bleibt der Anreiz, sich durch Abweichen besser zu stellen, und das Misstrauen, dass der andere sich nicht-kooperativ verhält. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn man das Abweichen verschleiern kann und dadurch keine anderweitigen Sanktionen zu befürchten hat. Wenn wir eine gesellschaftliche Situation nehmen und das Gefangendilemma mit vielen Personen analysieren, dann muss das individuelle Verhalten eher als anonym betrachtet werden. Das Trittbrettfahren wird dann zu einer sehr wahrscheinlichen Handlungsoption.
Selbst wenn explizite und implizite Vereinbarungen zu kooperativem Verhalten getroffen werden können, sind sie möglicherweise nicht viel wert. Denn im Unterschied zu einem Vertrag sind diese Vereinbarungen oder Absprachen nicht rechtlich sanktionsfähig und durchsetzbar. Deshalb besteht jederzeit das Risiko, dass eine Abmachung nicht von allen eingehalten wird.
Wie kann man von dem schlechteren Gleichgewicht Y − C, Y − C zu der kooperativen Lösung (Y, Y) gelangen? Wie ist ein Übergang vom Hobbesschen Naturzustand zu einem für alle besseren Zustand möglich? Eine Antwort ist, dass eine Eigentumsordnung eingeführt wird, die von einem Rechtsstaat durchgesetzt wird. Eine staatliche Eigentumsordnung umfasst den Schutz von Eigentumsrechten und die Durchsetzung von Verträgen zur Änderung von Eigentumsrechten, sprich dem Tausch dieser Rechte. Wenn sich die Individuen auf den Rechtsstaat einigen, dann weist dieser ihnen Eigentumsrechte zu und macht das Wegnehmen damit zu einer illegalen Handlung, die bestraft wird. Diese Strafe muss so hoch sein, dass sich Stehlen nicht mehr lohnt. Entscheidend ist, dass sich alle Gesellschaftsmitglieder dieser staatlichen Ordnung unterwerfen und akzeptieren, dass der Staat diese Bestrafung durchsetzt.
Sei diese Strafe so hoch, dass sie den Vorteil des Stehlens überwiegt: S > Z − C. Wir nehmen an, dass jeder, der stiehlt, dieses Diebstahls auch überführt wird.16 Die Auszahlungsmatrix mit einem solchen Eigentumsschutz ist dann:
Nettoauszahlungen für A: unten links, Nettoauszahlungen für B: oben rechts
Tabelle 2.2: Eigentumsordnung
Wenn sich jedes Individuum überlegt, ob es unter Berücksichtigung der Strafe stehlen soll, wird es sich für Nicht-Stehlen entscheiden, ganz gleich, wie sich das andere Individuum entscheidet: Die Nettoauszahlung bei Nicht-Stehlen ist immer höher. Damit wird durch die staatliche Eigentumsordnung Nicht-Stehlen zur dominanten Strategie, und im neuen Gleichgewicht (Y, Y) stellen sich beide Individuen besser als im Gleichgewicht des Naturzustands (Y − C, Y − C).17 Die Besserstellung aller ist erreicht, allerdings nicht durch freiwilliges kooperatives Verhalten, sondern durch Unterwerfung unter eine Eigentumsordnung und Durchsetzung dieser Ordnung mit Zwang.18
Warum gibt es nicht verschiedene Schutzorganisationen, denen sich Gesellschaftsmitglieder wahlweise anschließen können, um ihr Eigentum schützen zu lassen? Warum läuft es auf eine monopolistische Schutzorganisation hinaus, die alle Gesellschaftsmitglieder schützt? Hier kommt eine Eigenschaft einer staatlichen Eigentumsordnung zum Tragen, die sie als öffentliches Gut19 ausweist: die Nicht-Rivalität bei der Nutzung. Wenn ein zusätzliches Individuum die Eigentumsordnung nutzt, so behindert es damit nicht die Nutzung durch andere Individuen. Mit anderen Worten sind die Kosten der Nutzung durch eine weitere Person Null oder zumindest vernachlässigbar gering. Die Nicht-Rivalität ist der Extremfall bei Gütern, die immer geringere Durchschnittskosten verursachen, für je mehr Konsumenten man sie bereitstellt. Diesen Mengenvorteil in der Bereitstellung nennt man auch steigende Skalenerträge. Wenn im Extremfall nur Fixkosten für die Produktion des Gutes entstehen, dann sind die Grenzkosten für einen zusätzlichen Konsumenten Null und die Durchschnittskosten fallen mit größerer Anzahl von Konsumenten, da die Fixkosten sich auf mehr Köpfe verteilen20. Aber auch wenn es nicht zum Extremfall der Nicht-Rivalität kommt, sondern eine partielle Rivalität im Konsum21 bestehen bleibt, gibt es den Größenvorteil in der Bereitstellung, wenn die positiven Grenzkosten stets unterhalb der Durchschnittskosten bleiben und diese damit sinken. Die Durchschnittskosten werden dann minimiert, wenn alle potenziellen Nachfrager des Gutes von einem Anbieter bedient werden, ein sogenanntes natürliches Monopol. Da der Eigentumsschutz durch eine – private oder staatliche – Organisation diese Eigenschaft besitzt, produziert sie den größten Vorteil aus der Kooperation, wenn sie alle Gesellschaftsmitglieder umfasst. Die partielle oder Nicht-Rivalität bei größer werdender Anzahl von Gesellschaftsmitgliedern erzeugt den Zugewinn, den man bei Kooperation erzielen kann.22 Bei sinkenden Durchschnittskosten wird dieser Zugewinn maximal, wenn eine monopolistische Schutzorganisation den Eigentumsschutz garantiert.23
Robert Nozick (1974) hat im Detail beschrieben, welche Kostenvorteile sich ergeben, wenn Individuen sich im Naturzustand zu Schutzverbänden vereinigen, und verschiedene privat entstehende Schutzvereinigungen sich zu immer größer werdenden Organisationen zusammenschließen, bis schließlich eine „dominant protective association“ übrigbleibt, die alle Individuen der Gesellschaft als Mitglieder umfasst. Durch Arbeitsteilung kann jeder umso mehr Zeit sparen, die er ansonsten für den Eigentumsschutz aufwenden müsste, wenn man sich diese Aufgabe unter mehr Personen aufteilen kann. Wenn sich Mitglieder verschiedener Schutzvereinigungen um Eigentum streiten, können Reibungskosten bzw. Kosten der Entscheidungsfindung eingespart werden, indem eine übergeordnete Schutzorganisation diesen Konflikt löst. Der Kostenvorteil durch komparative Vorteile entsteht, wenn einige Individuen sich auf den Eigentumsschutz aller spezialisieren. Opportunitätskosten können gespart werden, wenn man seiner eigentlichen Arbeit nachgehen kann, ohne sich um den Eigentumsschutz kümmern zu müssen. Nozick schlussfolgert:
„Out of anarchy, pressed by spontaneous groupings, mutual-protection associations, division of labor, market pressures, economies of scale, and rational self-interest there arises something very much resembling a minimal state […].“ (S. 16f.)
Kosteneinsparungen, die durch Nicht-Rivalität bei der Nutzung einer Eigentumsordnung zustandekommen, führen also dazu, dass sich alle Individuen einer Gesellschaft einer (monopolistischen) Schutzorganisation unterwerfen. Das heißt, sie akzeptieren und befolgen die Regeln und Vorschriften der Organisation, die zum Beispiel eine Sanktionierung bei Verletzung des Eigentumsrechtes vorsehen. Diese partielle Preisgabe von Selbstbestimmung der Mitglieder charakterisiert diese Organisation aber noch nicht als Staat. Nozick kann zwar erklären, warum Individuen sich freiwillig zu der größtmöglichen Schutzvereinigung zusammenschließen. Letztlich kann er aber nicht den Unterschied zwischen dieser privaten Schutzvereinigung mit Monopolmacht und dem Staat mit Gewaltmonopol erklären.24
Jeder, der sich in einem Verein oder einer Unternehmung mit anderen zusammentut, um einen bestimmten Zweck zu verfolgen, muss sich an die Regeln halten, die der Verein oder die Unternehmung vorgibt, solange er dort Mitglied sein will. Wer nicht zur partiellen Aufgabe der Autonomie bereit ist, also zur Unterordnung unter diese Regeln, der kann aus dem Verein oder der Unternehmung ausscheiden. Er gibt dann aber auch die Erreichung und Nutzung des gemeinsamen Zwecks auf, den man in der Organisation verfolgt.
Um den Unterschied einer solchen monopolistischen Schutzvereinigung zu einem Staat auszumachen, muss die zweite Eigenschaft einer Eigentumsordnung herangezogen werden, die sie ebenfalls als öffentliches Gut kennzeichnet: die Nicht-Ausschließbarkeit von der Nutzung oder dem Konsum. Diese Eigenschaft bedeutet, dass ein Konsument nicht vom Konsum des Gutes ausgeschlossen werden kann, wenn das Gut einmal bereitgestellt worden ist. Entweder ist der Ausschluss vom Konsum des öffentlichen Gutes unmöglich (z. B. saubere Luft) oder er ist mit zu hohen Kosten verbunden (z. B. Nutzung von Straßen).25 Eine solche Eigenschaft hat auch eine durch eine private monopolistische Schutzvereinigung bereitgestellte Eigentumsordnung, da sie jedermann schützt, der in einer Gesellschaft lebt. Und zwar kann der Einzelne diesen Schutz nutzen, ohne selbst freiwillig etwas zu dieser Eigentumsordnung finanziell oder sachlich (z. B. einer Dienstpflicht) beitragen zu müssen. Nun ist aber eine Eigentumsordnung mit erheblichen Einrichtungskosten für Gerichte, Polizei, Gefängnisse etc. verbunden. Der individuelle Vorteil des Nicht-Kooperierens besteht also in der uneingeschränkten Nutzung des öffentlichen Gutes „Eigentumsordnung“.
Diese Eigenschaft der Nicht-Ausschließbarkeit erzeugt das Gefangenendilemma, in dem jedes Individuum einen Anreiz hat, aus dem kooperativen Zustand auszubrechen, wenn alle anderen sich weiter kooperativ verhalten.26 Jeder hat einen individuellen Vorteil durch das nicht-kooperative Verhalten, solange es die Kooperation weiter gibt und er deren Vorteile weiter mitnutzen kann. Dieses sogenannte Trittbrettfahrerverhalten und damit das Gefangenendilemma kann nur dann überwunden werden, wenn es eine Organisation gibt, die die Achtung aller Individuen vor dem Privateigentum durch Sanktionen erzwingt. Es muss also eine Organisation sein, die alle Individuen einer Gesellschaft zur Teilnahme und zur Finanzierung des Eigentumsschutzes zwingen darf. Das aber darf nur der Staat und wird vom Staat erwartet, weil sonst das Trittbrettfahren nicht verhindert werden kann. Wenn aber das Trittbrettfahren möglich bleibt, dann kommt es zu keinem Eigentumsschutz, da jeder und damit alle einen Vorteil haben, sich der Finanzierung der Eigentumsordnung zu entziehen.
Der Staat unterscheidet sich also von einer monopolistischen privaten Schutzorganisation dadurch, dass er alle Individuen einer Gesellschaft zur Beteiligung am gemeinsamen Eigentumsschutz zwingen kann. Damit darf er alle zur Teilnahme an der gemeinschaftlichen Eigentumsordnung verpflichten und in Form von Steuern von allen einen Finanzierungsbeitrag für den gemeinsamen Zweck einfordern. Unter dem Gewaltmonopol kann man also den ausschließlichen legitimen Zwang zur Teilnahme an einem Projekt mit gemeinschaftlichem Zweck (eine Politik) und deren Finanzierung verstehen. Während ein privater Schutzverein ein Monopol auf die Bereitstellung des Eigentumsschutzes haben kann und damit als alleiniger Anbieter allen Nachfragern in der Gesellschaft die Dienstleistung anbietet, kommt beim Staat hinzu, dass er die Beteiligung an der gemeinschaftlichen Aufgabe (Unterwerfung unter die Regeln der Eigentumsordnung) und deren Finanzierung erzwingen kann und insofern zum Dienstleistungsmonopol noch das Gewaltmonopol hinzukommt. Ersteres wird begründet durch die Nicht-Rivalität in der Nutzung, letzteres durch die Nicht-Ausschließbarkeit von der Nutzung.
Dieses Ergebnis zeigt, dass Eigentumsschutz ein öffentliches Gut ist, das freiwillig nicht bereitgestellt wird. Denn jeder hat einen Vorteil davon, dass alle anderen das Eigentum respektieren, man selbst aber das Eigentum anderen wegnimmt. Da es aber so ist, dass jeder besser gestellt wird, wenn alle das Eigentum respektieren, ist eine Unterwerfung unter eine staatliche Eigentumsordnung der einzige Weg, diese Besserstellung zu erreichen. Diese Unterwerfung stellt eine Selbstbindung an Regeln dar, die dem Individuum von außen durch den Staat auferlegt werden und denen sich das Individuum nicht entziehen kann. Erst diese Selbstverpflichtung durch eine exogene Institution, den Staat, signalisiert allen anderen Individuen in der Gesellschaft glaubwürdig, dass das Individuum sich an die Eigentumsrechte hält. Deshalb werden eine teilweise Beschränkung der Autonomie und die Übertragung der Verantwortung an den Staat von den Individuen akzeptiert. Der Staat wird als Mittel zur glaubwürdigen Selbstbeschränkung eingesetzt, um das öffentliche Gut „Eigentumsordnung“ bereitstellen zu können.
Exkurs 1 | James Buchanan und das Paradox des Regiert-werdens
Der amerikanische Ökonom James Buchanan (1919–2013) hat in seinem Werk „Die Grenzen der Freiheit“ von 1975 das Argument, aufgrund des Gefangenendilemmas müsste eine staatliche Eigentumsordnung eingerichtet werden, ausgedehnt auf die Einführung eines allgemeinen Rechtssystems. Die Verfassung, die dazu geeignet ist, das Trittbrettfahrerproblem des Naturzustands zu überwinden, wird hier vertragstheoretisch begründet. Die Gesellschaftsmitglieder halten sich freiwillig an Vertragsvereinbarungen, die die wechselseitige Anerkennung von Rechten beinhalten. Die Rechte betreffen erstens Verhaltensregeln zur wechselseitigen Unverletzlichkeit der Personen, zweitens Verfügungsrechte über Güter und Ressourcen, drittens Regeln zur Rechtsdurchsetzung, viertens Regeln über die Art und Weise kollektiver Entscheidungen bzw. Wahlverfahren, fünftens Bestimmungen zur Trennung zwischen privatem und öffentlichem Wirtschaftssektor und schließlich sechstens Regeln zur Steueraufteilung, sprich Finanzverfassung.27 Ein solcher Verfassungsvertrag führt zu dem, wie es Buchanan nennt, „Paradoxon, ‚regiert zu werden‘ […]. Der Vertrag ist nämlich solange wertlos, wie es keine Garantie gegen Vertragsverletzung gibt. Irgendein Zwangsmechanismus, ein Instrument oder Exekutivorgan, muss zum ursprünglichen Vertrag hinzukommen, und jede Partei wird es positiv bewerten, wenn eine entsprechende Sicherung vorgesehen ist.“28 Diese positive Einstellung zu einer Regierung ist angesichts des Freiheitswillens des Menschen ein Paradox. Denn „sobald die Zwangsinstanz einmal ausgewählt und über die vereinbarten Regeln in Kenntnis gesetzt ist, haben die Beteiligten auf die ‚Entscheidungen‘ dieser Instanz keinen Einfluss mehr und können ihn auch nicht haben.“ Die Institution Rechtsstaat muss als unbeteiligter und neutraler Dritter den Individuen, um deren Rechte es geht, gegenüberstehen und darf weder von ihnen beeinflusst werden noch eine eigene Bewertung der vorgegebenen Regeln vornehmen. Dies aber führt nach Buchanan zu Enttäuschungen und Verdruss. „Die Menschen fühlen sich dazu gezwungen, einen ‚Gesellschaftsvertrag‘ einzuhalten, den sie (tatsächlich, Anm. des Verf.) niemals geschlossen haben, und sie sehen sich der möglichen Bestrafung durch eine Zwangsinstanz ausgeliefert, über die sie weder eine direkte noch eine indirekte Kontrolle ausüben.“29 James Buchanan beschreibt diesen Zustand deshalb als Paradox, weil seine Erklärung, warum die Menschen implizit einen solchen Vertrag inklusive staatlicher Kontrollinstanz eingehen und sich daran halten, zu kurz greift. Eine Regierung wird nicht nur deshalb akzeptiert, damit sie den Verfassungsvertrag sichert. Vielmehr ist diese externe Zwangsinstitution das Instrument der Selbstbindung, um allen Gesellschaftsmitgliedern glaubwürdig zu vermitteln, dass man sich selbst kooperativ und gesetzeskonform verhalten wird. Denn nur dadurch bringt man auch alle anderen Gesellschaftsmitglieder dazu, sich ebenfalls kooperativ und gesetzeskonform zu verhalten. In diesem Sinn ist das Regiert-werden dann auch kein Paradox mehr und führt dazu, das Trittbrettfahrerproblem zu überwinden.
Buchanan (1975) hat darauf hingewiesen, dass eine freiwillige Vereinbarung über eine Eigentumsordnung umso weniger eingehalten wird, je mehr Personen an dieser Abmachung beteiligt sind. Der Einfluss des Einzelnen auf das Verhalten der anderen wird geringer, die soziale Kontrolle unter den Mitgliedern der Gruppe wird aufwändiger und verschwindet in Großgruppen gänzlich, sodass die Vertragsverletzung gerade in Großgruppen sehr wahrscheinlich ist.
Mancur Olson (1992) hat den Maßstab dafür, „ob eine Gruppe fähig ist, ohne Zwang oder äußere Anreize in ihrem Gruppeninteresse zu handeln“, an die Frage geknüpft, „ob die individuellen Handlungen eines oder mehrerer Mitglieder der Gruppe von den anderen Mitgliedern bemerkt werden kann.“:
„Die Wahrnehmbarkeit der Handlungen eines einzelnen Gruppenmitglieds kann durch die Maßnahmen der Gruppe selbst beeinflusst werden. Eine bereits organisierte Gruppe z. B. kann sicherstellen, dass die geleisteten oder nicht geleisteten Beiträge jedes einzelnen Gruppenmitglieds ebenso wie die Wirkungen des Verhaltens eines einzelnen Mitglieds auf die Belastung oder den Gewinn der anderen öffentlich bekannt gemacht werden, um auf diese Weise sicherzustellen, dass die Bemühungen der Gruppe nicht infolge unzureichender Information zusammenbrechen.“ (S. 44)
Insofern zeigt sich gerade für große Gruppen wie eine Gesellschaft mit vielen Bürgern, deren einzelner Beitrag zu einer gemeinsamen Aufgabe unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt, dass der Staat notwendig ist, um die Einhaltung und Finanzierung einer Eigentumsordnung mit Zwang durchzusetzen. Die erste und wichtigste Aufgabe des Staates besteht also darin, die Einhaltung des rechtlichen Rahmens zu gewährleisten, innerhalb dessen die Angelegenheiten der Bürger in privaten Vereinbarungen rechtssicher geregelt werden können. Diese Aufgabe besteht im Aufbau eines Rechtsstaates, der durch Gesetze und Gerichte den Rechtsschutz für Eigentum und den Tausch von Eigentum in Verträgen gewährleistet. Damit schafft der Staat die Voraussetzungen, damit Märkte überhaupt funktionieren können. Nur wenn Individuen über etwas ausschließlich verfügen können, kann es Marktaktivitäten, d. h. den Tausch von Eigentumsrechten, geben.30
Aber selbst wenn der Staat das öffentliche Gut „Eigentumsordnung“ eingerichtet und damit die Voraussetzungen für private Verträge geschaffen hat, kann der Markt als Institution der Interessensbefriedigung versagen. Für diese Fälle von Marktversagen gibt es unterschiedliche Gründe. Wir werden in den folgenden Kapiteln zeigen, dass sie sich alle auf das Trittbrettfahrerproblem bzw. das Gefangenendilemma zurückführen lassen.




























