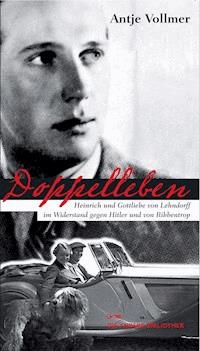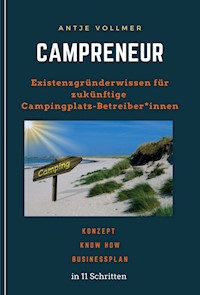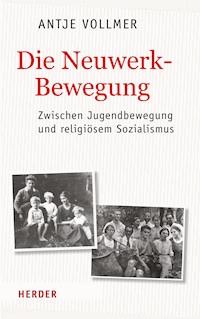Klaus Mertes/Antje Vollmer
Ökumene in Zeiten des Terrors
Impressum
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2016
Alle Rechte vorbehalten
Vorwort
Wie kam es zu diesem Briefwechsel? Den Beginn unseres Gedankenaustausches markiert das Jahr 2010, das Jahr, in dem die Ereignisse öffentlich wurden, die irreführend als »Missbrauchsskandal« in der katholischen Kirche bezeichnet werden – irreführend deswegen, weil nicht die Aufdeckung des Missbrauchs der Skandal war, sondern das jahrzehntelange Schweigen über den Missbrauch. Die eine von uns, Antje Vollmer, leitete damals auf Wunsch des Deutschen Bundestages einen »Runden Tisch zur Aufarbeitung der Heimerziehung in der Bundesrepublik der 50er- und 60er-Jahre« und versuchte dort das so schwierige Gespräch zwischen Opfern, Tätern und verantwortlichen Institutionen. Der Deutsche Bundestag war bis dahin aus rechtlichen Gründen daran gescheitert, eine Entschädigungsmöglichkeit für die Betroffenen zu finden und die vergangenen Unrechtserfahrungen angemessen zu thematisieren. Der andere, Klaus Mertes, hatte gerade mit einem Brief an die ehemaligen Schüler des Canisius-Kollegs eine heftige öffentliche Debatte angestoßen. Der Jesuitenorden stand damals ebenfalls vor der Forderung nach Entschädigungszahlungen für die Opfer von Missbrauch. Wir hatten also gemeinsam eine schwierige und umstrittene Aufgabe vor uns, die uns gelegentlich subjektiv und objektiv zu überfordern schien. Nichts war da notwendiger als ein vertraulicher Erfahrungsaustausch. Eines Tages klingelte Antje Vollmer an der Pforte des Canisius-Kollegs in Berlin. So begann unser Gespräch über all die verwickelten Fragen und unauflöslichen Widersprüche, mit denen wir monatelang zu tun hatten, über die öffentliche Rolle, in die wir hineingeraten waren, und über den unbequemen Platz zwischen allen Stühlen, auf dem wir uns oft befanden.
In diesem Jahr starb Christoph Schlingensief, ein Freund von Antje Vollmer, der vor seiner letzten Operation nach einem katholischen Priester verlangte. Christoph Schlingensief war ein intensiv gläubiger und zweifelnder Mensch, der sich ein Leben lang mit den gesellschaftlichen Fragen von Macht und Gewalt, aber auch mit seinem Kinderglauben auseinandersetzte. In seiner »Kirche der Angst vor dem Fremden in mir« trat er in beinahe blasphemischer Zuspitzung bei der Abendmahlsszene in der Position Christi auf, gab Auskunft über den aktuellen Stand seiner tödlichen Erkrankung und warf mit Hostien um sich. Dabei rief er die Abendmahlsworte in den sakralen Raum hinein, den er seiner Heimatkirche in Oberhausen nachgestaltet hatte, und verfremdete die Worte zugleich: »Das ist mein Leib, das ist euer Leib, das ist unser Leib.« Über Christoph Schlingensief und die letzten Gespräche mit ihm waren wir wieder bei dem Thema angekommen, das auch das thematische Zentrum unseres vorliegenden Briefwechsels ausmacht: Das christliche Abendmahl – und zwar nicht bloß in historischer Erinnerung, sondern als vergegenwärtigtes Ereignis.
Ein erkenntnisbringendes Gespräch über Machtmissbrauch und sexualisierte Gewalt, über Täter- und Opfer-Dynamiken führt in die Spannung der politischen Diskurse ebenso wie in die Tiefen der eigenen Biographie, auch dann, wenn man weder Opfer noch Täter im engeren Sinne des Wortes ist. Die Zusammenhänge, in denen Täter-Opfer-Konstellationen entstehen und sich verfestigen, sind immer auch systemischer Natur und betreffen deswegen die ganze Gesellschaft. Ganz offensichtlich ist die Frage nach den Ursprüngen und nach der Überwindung der Gewalt ein Schlüsselthema aller Religionen, zumal der christlichen, in deren Zentrum die Geschichte von der Kreuzigung Jesu steht.
Entscheidend für diesen Briefwechsel war dann aber, dass wir uns wieder im Kuratorium der Stiftung 20. Juli 1944 begegneten. Jedes Jahr feiern Angehörige der wegen ihres Widerstandes gegen das NS-Regime Ermordeten unter dem Galgen im Hinrichtungsschuppen einen ökumenischen Gottesdienst, zu dem erstmals am 20. Juli 1946 P. Odilo Braun OP und Eberhard Bethge, der Freund Dietrich Bonhoeffers, einluden. Von Anfang an gab es bei diesem Gottesdienst das Ringen um die angemessene Form. Nach den ökumenischen Erfahrungen der Hingerichteten und der Überlebenden wollte man nicht einfach auseinandergehen, aber auch nicht auf die Feier des Abendmahles verzichten, zumal die Ermordeten es vor ihrer Hinrichtung in den Gefängnissen gemeinsam gefeiert oder doch danach verlangt hatten.
Ökumene in Zeiten des Terrors
Ein Briefwechsel
Berlin, 16. November 2015
Lieber Pater Mertes,
Es ist ein merkwürdiger Zeitpunkt, um unseren Briefwechsel zu beginnen. Erst drei Tage ist es her seit jenem Freitag, dem 13. November, dem Tag der Attentate in Paris, die nicht nur Frankreich und Europa, sondern auch die ganze Welt grundlegend zu verändern drohen. 129 meist sehr junge Menschen sind da wahllos getötet worden, zahllose weitere sind verletzt. Auch die Attentäter sind jung. Sie sind zu allem entschlossen, sie sehen sich alsGotteskrieger. Sie sprengen sich in die Luft mit dem Ruf »Gott ist groß« auf den Lippen, einem ausgestreckten Zeigefinger als symbolischem Zeichen der Einheit ihres Gottes in der einen, die Kalaschnikow in der anderen Hand. »Wir sind im Krieg«, heißt es wieder als Antwort, wie damals nach dem 11. September 2001. Ist das der zutreffende Begriff für die Zustände, in denen wir uns nun wieder befinden? Und sind wir je aus diesem erklärten und offensichtlich akzeptierten Kriegszustand herausgekommen?
Nach einer neuen Statistik sind allein im letzten Jahr über 32000 Menschen solchen Attentaten zum Opfer gefallen. Als ob die Welt in einem suizidalen Zustand wäre! Die meisten starben im Irak, in Syrien, Afghanistan, Nigeria, Pakistan. Haben wir diese Opfer weltweit auch so betrauert wie »unsere Toten« in Europa oder in den USA? Haben wir sie überhaupt zur Kenntnis genommen? Und haben wir nur ahnungsweise etwas verstanden von all dem? Woher kommt dieser Hass? Und warum sucht er eine religiöse Form, Formel, Pathos, Motivation, um sich auszudrücken? Ist das nur Blasphemie oder hat es einen Grund, der uns erschrecken müsste? Und wie verhalten wir, wir Christen, uns dazu? Moralisch? Kriegerisch? Überlegen? Als Opfer oder als Richter? Als Teilnehmer und Propagandisten eines kollektiven abendländischen Kreuzzugs gegen dieses neueBöse? Als Besitzer und Verteidiger von ewigen humanitären Werten, die weltweit Geltung und Beachtung einfordern? Als Realpolitiker oder als Hörer der Bergpredigt, die uns die Feindesliebe als einzige Möglichkeit anbietet, um der Spirale der Gewalt zu entrinnen? Auf welcher Seite stehen wir überhaupt und was bedeutet es, dass man unbedingt auf einer Seite stehen muss?
In diesen Wirrnissen fangen wir also unseren Briefwechsel an, der mit all diesen Herausforderungen zu tun hat, aber vor allem mit der Frage, wie wir uns als Christen – in unserem speziellen Fall wir beide, Sie als Katholik und ich als Protestantin – in dieser unruhigen Welt verstehen, in welcher Verfassung wir selbst sind, um uns überhaupt mit diesem religiösen, politischen, menschlichen Stimmengewirr, das unsere Gegenwart bestimmt, auseinandersetzen zu können.
Das Lutherjahr 2017 wirft seine Schatten voraus, die fünfhundertste Wiederkehr des Jahres, in dem die große Kirchenspaltung begann, die keiner der beteiligten Kaiser, Könige, Kirchenführer und Weisheitslehrer damals zu verhindern imstande war. Dieser tragischen Spaltung der abendländischen Christenheit folgte bald ein Dreißigjähriger Krieg, bei dem Europa gänzlich unregierbar wurde – einfailing statenach dem anderen, ein ganzer Kontinent, der in die Barbarei zurückfiel. Die Hälfte seiner Bevölkerung, Kriegsknechte wie Zivilisten, war tot, die Städte waren verwüstet, Kulturschätze von unendlicher Schönheit zerstört. Die meisten Überlebenden, von zu viel Trauer, Not und Gewalterfahrung abgestumpft und traumatisiert, trieben heimatlos über die verbrannten Landstriche.
Auch damals waren religiöse Fahnen, Symbole und Parolen die Zeichen, mit denen die Soldateska und ihre Feldherren in den Krieg zogen, mit heißen Gebeten und mit Waffen, die von Geistlichen beider Konfessionen gesegnet waren. Das alles hat ihnen nicht geholfen, geholfen hat erst die Vernunft desWestfälischen Friedens von Münster und Osnabrück aus dem Jahre 1648. Da waren offensichtlich keine Ideologen und heißblütigen Gotteskämpfer mehr am Werk, sondern vernunft- und ausgleichsbegabte Skeptiker, die genug von den jeweiligen Kriegsparteien und ihren Obsessionen verstanden, um jenen fast unmöglich scheinenden Kompromiss nicht aus den Augen zu verlieren, der es allen Beteiligten am Ende erlaubte, die Waffen aus der Hand zu legen.
Macht es einen Sinn, heute, am Anfang unseres Briefwechsels, diese dunklen Zeiten des Terrors in der Geschichte Europas und unserer beider Kirchen erneut wachzurufen? Ist das der passende Hintergrund für unser Bemühen, selbst in apokalyptischen Szenarien einen Apfelbaum zu pflanzen, so wie es Martin Luther einmal seinen von Sorgen vergrübelten Freunden angeraten hat?
Wir werden es erfahren in den kommenden Wochen, die wir uns für diesen Briefwechsel vorgenommen haben. Fangen wir also an mit unserem Gespräch zwischen Sankt Blasien, wo Sie Ihre Schule leiten, und Berlin, wo mein Schreibtisch steht.
Eigentlich wollte ich dieses Schreiben mit einer ganz anderen, sehr persönlichen Geschichte beginnen: mit einer Geschichte, die an einem besonderen Sommermorgen ihren Anfang nahm.
Es begann am 20. Juli 2013 in der Gedenkstätte Plötzensee. Es war der Morgen eines sehr heißen Tages. (Auch am 20. Juli 1944, als das Attentat auf Adolf Hitler in der stickigen Wolfsschanze in Ostpreußen versucht wurde, soll es ungewöhnlich heiß gewesen sein.) Im Inneren des Plötzenseer Henkerschuppens, wo ein Gedenkgottesdienst stattfinden sollte, fühlte es sich dennoch kühl an, eine Kühle, die mehr von innen kam. Wie jedes Jahr wurde an diesem Ort vor allen offiziellen Gedenkfeiern ein Gottesdienst gefeiert, gemeinsam vorbereitet von dem katholischen Geistlichen und seinem protestantischen Kollegen, angekündigt als »ökumenischer Gottesdienst mit Abendmahl und Eucharistiefeier.« Für viele der Angehörigen der Hingerichteten ist dieses Zusammentreffen an diesem Ort der berührendste und wichtigste Termin des ganzen Tages.
Die Liturgie war offensichtlich gemeinsam erarbeitet, die Texte wurden gemeinsam gelesen, die Predigt wechselte jährlich zwischen dem katholischen und dem protestantischen Geistlichen. Dann kam der Abendmahlsteil und ich fand in dem verteilten Programmzettel zweierlei Versionen, eine katholische und eine protestantische. »Also ist auch das in jährlichem Wechsel«, vermutete ich. Da es mit der protestantischen Variante des Abendmahls begann, nahm ich daran teil und achtete nicht zu sehr darauf, dass ungefähr die Hälfte der Besucher sitzen blieb. Als alles vorbei war: die Einsetzungsworte gesprochen, die Einladung verkündet, Brot und Wein ausgeteilt und jeder mit einem Segenswort entlassen, begriff ich erst meinen Irrtum. Denn danach begann alles noch einmal, nur nach katholischem Ritus: Einsetzungsworte, Wandlung, Einladung, zum Tisch des Herrn zu treten, Verteilung der Hostien …
Ich erinnere mich noch genau, was mir durch den Kopf ging: ein einziges schockiertes Staunen. Wie nach einer gedehnten Schrecksekunde kam dann ein Begreifen: Selbst hier, am Ort des Henkers, der keinerlei Unterschied machte, selbst hier gibt es keine Möglichkeit, das Trennende zwischen den Konfessionen zu überwinden. Selbst hier fällt das geistlich verordnete Fallbeil, das das richtige vom falschen Abendmahl trennt. Selbst diese Tode haben nicht Kraft genug, die Worte »für euch alle ohne Unterschied gegeben« Realität werden zu lassen.
Ich war fassungslos, traurig, wütend, alles zugleich. Einen Moment lang dachte ich daran, einfach noch einmal aufzustehen und das zweite Mal an den Altar zu treten. Ich bin schon oft so mit zur Austeilung gegangen, wenn ich an katholischen Eucharistiefeiern teilgenommen habe, um für mich diese kirchenpolitische Trennung einfach nicht anzuerkennen, ihr keine Macht über meinen Glauben einzuräumen. Aber dieses Mal habe ich es nicht gewagt. Ich wollte in diesem engen Kreis niemanden verletzen, ich wollte den katholischen Priester an diesem besonderen Tag nicht öffentlich in Schwierigkeiten bringen. Ich wollte diesen Ort der Hingerichteten nicht entfernt für etwas nutzen, was man als Demonstration eines Dissenses deuten konnte. Aber ich sah: Ich war definitiv nicht eingeladen, ich war in meine eigene protestantische Abendmahlsform verbannt, die den Makel trug, nicht ganz vollständig und richtig, irgendwie unwürdig zu sein.
St. Blasien, 30. November 2015
Liebe Frau Vollmer,
herzlichen Dank für Ihren Brief. Die vielen Fragen, die Sie stellen, würden mich erschlagen, wenn ich mich vornehmlich für Antworten zuständig fühlen würde – Berufskrankheit des Lehrers, der ich bin. Dabei stellen Sie die Fragen, wie ich Sie kenne, nicht in der Absicht, von mir nun ultimative Antworten zu hören, sondern um ein gemeinsames Fragen zu beginnen. Durch gemeinsames Fragen können wir einander als Christen unterschiedlicher Konfessionen viel näher kommen als durch Austauschen von Positionen.
Soll man sich, kann man sich in so bewegten Zeiten mit scheinbar abgelegenen Fragen wie der nach dem gemeinsamen Abendmahl und derÖkumene der Märtyrer (Papst Johannes Paul II.) weiter beschäftigen? Gibt es nichts Dringenderes? Ich erlebe die gegenwärtige Zeit als eine Wendezeit. Hass und Kriege im Nahen und Mittleren Osten; Mitverantwortung und Mitschuld des Westens; Scheitern des Dublin-Regimes und Öffnung innereuropäischer Grenzen für Flüchtlinge; eine neue Rechte in Europa und Deutschland; suizidal-mörderischer Terrorismus am 11. September 2001 und jetzt am 13. November 2015 sowie Wiederholungszwänge der neuenguèrre contre le terrorisme – das alles gibt auch mir mehr und mehr das Gefühl, dass wir mitten in etwas Neuem stehen, das sich nicht mehr mit den Kategorien der Nachkriegsepoche begreifen und gestalten lässt. Zugleich kommt mir die Vision: Wäre nicht die Vollendung der Einheit zwischen Christen in der gegenseitigen Gastfreundschaft beim Abendmahl ein großes Zeichen für die ganze Welt? Die Vollendung dessen, was in Deutschland mit dem westfälischen Frieden 1648 eingeleitet wurde? Das Ende des Hasses zwischen Konfessionen? Ein Hoffnungszeichen auch für die muslimische Welt, in der sich Sunniten und Schiiten gegenseitig zerfleischen? Überwindung von Hass im Namen von Religionen und Konfessionen – das ist doch das große Thema der Zeit!
Wendeereignisse teilen die Zeit in ein Davor und Danach ein. Es ist zwar nicht alles falsch, was ich vorher gedacht habe, aber ich muss die Grundlagen meines Denkens neu sortieren.Metánoia heißt das im Evangelium. Es geht mir zum ersten Mal in meinem Leben so, dass ich mich traue, zu meinen, ich könnte mich ein wenig in die Männer und Frauen des Widerstandes einfühlen: Sie mussten auch angesichts des Neuen, in dem sie lebten, plötzlich ganz neu fragen: Wo finde ich Orientierung in einer Zeit, in der die alten Orientierungsmaßstäbe zwar nicht einfach falsch sind, aber auch nicht mehr genau passen? Gerade in Wendezeiten kann ich die Maßstäbe für meine Orientierung nicht bloß aus dem Blick zurück gewinnen. Aber was sind dann die Maßstäbe für die Visionen, die Kriterien für den neu zu erringenden Frieden?
Das PhänomenMartyrium bietet sich mir als Brücke zwischen Themen der Vergangenheit und der Gegenwart an.Martyrium gehört zu den aktuell missbrauchten religiösen Begriffen. Die Mörder von Paris sind keine »Märtyrer«. Märtyrer reißen nicht unschuldige Menschen bewusst mit in den Tod. Der Blick auf das Martyrium Jesu macht das sonnenklar, und auch der Blick auf das Martyrium der in Plötzensee und andernorts Ermordeten des Widerstandes gegen die Nazi-Diktatur.
An jenem ökumenischen Gottesdienst am 20. Juli 2013, den Sie in Ihrem Brief erwähnen, habe ich auch teilgenommen. Ich habe bei der Austeilung der Kommunion assistiert. Gerne würde ich Ihnen sagen, was ich mit der Feier des Abendmahles unter dem Galgen von Plötzensee überhaupt verbinde: Es geht um das Gedenken und Vergegenwärtigen von Martyrien. Hitler wollte, dass seine Feinde nicht einfach nur sterben, sondern einen entwürdigenden Tod sterben. Am Galgen. Das ist ein typisches Kennzeichen von Martyrium. Die Mörder der Märtyrer wollen nicht nur physisch, sondern auch geistig über ihre Feinde siegen. Dasselbe gilt für den Tod Jesu: Es ging seinen Feinden nicht nur um seine Tötung, sondern um seine Tötung am Kreuz, also um seine Entwürdigung. Plötzensee ist auf drastische Weise vergleichbar mit Golgota.
Plötzensee ist ebenso wie Golgota die letzte Station auf einem Weg der Umkehr zur Nächstenliebe. Das ist bei den Suizid-Mördern gerade nicht der Fall. Sie lieben nur ihre eigenen Leute und hassen die anderen, sie töten sie sogar, die »Fremden«, die »Feinde«. Und noch einen Unterschied gibt es: Im christlichen Bekenntnis heißt es, dass der Tod Jesu eine ganz bestimmte Wirkung über seinen Tod hinaus hat: Versöhnung zwischen Feinden und gerade nicht Hass und Krieg. So sehe ich das auch für Plötzensee. Der Widerstand und schließlich der Tod in Plötzensee hatten eineversöhnende Wirkung, denn im Widerstand gegen die Nazis kamen Personen zusammen, die sich unter anderen Umständen nicht einmal angeschaut hätten: Protestanten, Katholiken, Gewerkschafter, Sozialdemokraten, Kommunisten, Zeugen Jehovas, Deutschnationale, Militärs, Pazifisten. Eine Einheit auf neuer Grundlage zeigte sich.
Es gibt viele Beispiele dafür. Mir persönlich ist das Zeugnis von Alfred Delp SJ und Helmuth James von Moltke am nächsten. Gemeinsam standen sie am 10. Januar 1945 vor dem Volksgerichtshof. Man konnte ihnen nichts anderes nachweisen, als dass sie miteinander im Kreisauer Kreis über die Zukunft Deutschlands nach der Nazidiktatur gesprochen hatten. Was die Gefährten am Prozessverlauf allerdings überraschte, war: Der Anklagepunkt wurde dahingehend präzisiert, dass sieals Christen miteinander über die Zukunft Deutschlands konferiert hatten. Seiner Frau Freya schrieb Moltke: »Und dann wird Dein Wirt (so nannte er sich immer selbstironisch in diesen Kassibern) ausersehen, als Protestant vor allem wegen seiner Freundschaft mit Katholiken attackiert und verurteilt zu werden, und dadurch steht er vor Freisler nicht als Protestant, nicht als Adliger, nicht als Preuße, nicht als Deutscher – das ist alles ausdrücklich in der Hauptverhandlung ausgeschlossen –, sondern als Christ und als gar nichts anderes … Zu welch einer gewaltigen Aufgabe ist Dein Wirt ausersehen gewesen: All die viele Arbeit, die der Herrgott mit ihm gehabt hat, die unendlichen Umwege, die verschrobenen Zickzackkurven, die finden plötzlich in einer Stunde am 10. Januar 1945 ihre Erklärung. Alles bekommt nachträglich einen Sinn, der verborgen war.« Und er fügt in eindrucksvoller Souveränität hinzu: »Das hat den ungeheuren Vorteil, dass wir nun für etwas umgebracht werden, was wir a. gemacht haben, und was b. sich lohnt.«
Ich meditiere diesen Text seit vielen Jahren. Eine »gewaltige Aufgabe« entdeckt Moltke. Es ist nicht mehr die Aufgabe, Deutschland nach dem Krieg wieder aufzubauen, sondern die noch größere, die Konfessionsgrenzen im Martyrium zu überschreiten, letztlich also: Die Kirche neu aufzubauen. Dazu sieht er sich rückblickend »ausersehen«. Das ist biblischer Sprachstil, »passivum divinum«. Moltke deutet sein Todesurteil geschichtstheologisch: Gott handelt in diesem Prozess. Er hat Moltke »ausersehen«. Er gibt den ganzen Jahren vorher bis hin zum Prozessverlauf »nachträglich einen Sinn, der verborgen war.« Dieser Sinn heißt: Ökumene, Einheit, Sieg über Spaltung und Terror. Für Moltke »lohnt« es sich, dafür zu sterben. Das ist der innere Friede, die »Tröstung im Heiligen Geist«, welche die theologische Erkenntnis Moltkes in seinem Herzen bestätigt.