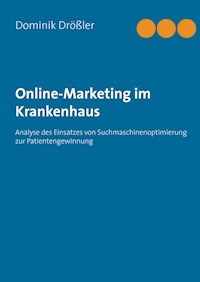
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Online-Marketing im Krankenhaus analysiert zunächst die grundlegenden Rahmenbedingungen des Gesundheits- bzw. Krankenhaussektors. Darüber hinaus gibt das Buch einen professionellen Überblick über das Thema Online-Marketing. Neben der Abgrenzung des Begriffs Online-Marketing werden ebenso die typischen Instrumente analysiert. Der Hauptteil des Buches beschäftigt sich mit Online-Marketing im Krankenhaus im Allgemeinen sowie dem Instrument der Suchmaschinenoptimierung im Speziellen. Mithilfe einer Umfrage wurde der Frage auf den Grund gegangen, ob Krankenhäuser mit Suchmaschinenoptimierung die Patientenzahlen steigern können. Darüber hinaus wird analysiert, welches die vielversprechendsten Werkzeuge sind, um im Ranking der Suchmaschinen langfristig ganz nach oben zu klettern.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 151
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erstprüferin: Prof. Dr. Barbara Kreis-Engelhardt
Zweitprüfer: Prof. Dr. Kurt Maier
Eingereicht von: Dominik Drößler, Dipl. Betriebswirt (BA)
MBA Management & Finance
Eingereicht am: 15.11.2013
Inhaltsverzeichnis
ABBILDUNGSVERZEICHNIS
TABELLENVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1 EINLEITUNG
1.1 Z
IELSETZUNG
1.2 M
OTIVATION
1.3 A
UFBAU UND
V
ORGEHENSWEISE
2 DAS DEUTSCHE GESUNDHEITSSYSTEM
2.1 D
ER
K
RANKENHAUSMARKT
2.2 K
RANKENHAUS
-F
INANZIERUNG
2.2.1 Definition Krankenhaus
2.2.2 Definition Finanzierung und Krankenhausfinanzierung
2.2.3 Freie Krankenhausfinanzierung bis 1936
2.2.4 Die monistische Finanzierung 1936–1972
2.2.5 Die duale Finanzierung ab 1972
2.2.5.1 Betriebskosten-Finanzierung
2.2.5.2 Investitionskostenfinanzierung
2.3 A
KTUELLE
H
ERAUSFORDERUNGEN FÜR DAS
G
ESUNDHEITSSYSTEM
2.3.1 Demographischer Wandel
2.3.2 Ausgabenanstieg und sinkende Beitragseinnahmen
2.3.3 Mündiger Patient
2.4 A
KTUELLE
H
ERAUSFORDERUNGEN FÜR
K
RANKENHÄUSER
2.4.1 Investitionsstau und Finanzierungslücke
2.4.2 Kostendämpfung statt konsistente Qualität
2.4.3 Preissteigerungsraten vs. Steigerung Lohnkosten
2.4.4 OP-Weltmeister Deutschland: Vertrauensverlust
2.4.5 Internationalisierung und Fachkräftemangel
2.5 Ü
BERKAPAZITÄTEN UND
F
ALLZAHL
-M
AXIME
2.6 D
AS
K
RANKENHAUS IM
W
ANDEL
3 ONLINE-MARKETING UND SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG
3.1 D
EFINITION UND
A
BGRENZUNG DER
B
EGRIFFLICHKEITEN
3.1.1 Online-Marketing
3.1.2 Suchmaschinen und Suchmaschinenoptimierung
3.1.3 Weitere Begrifflichkeiten
3.2 B
EDEUTUNG DES
I
NTERNETS IN
D
EUTSCHLAND
3.3 I
NSTRUMENTE DES
O
NLINE
-M
ARKETINGS
3.3.1 Web-Analyse
3.3.2 E-Mail-Marketing
3.3.3 Blogs
3.3.4 Suchmaschinenoptimierung
3.3.4.1 On-Page-Optimierung
3.3.4.2 Off-Page-Optimierung
3.3.4.3 Wirksamkeit von Suchmaschinenoptimierung
3.3.5 Website-Usability
3.3.6 Suchmaschinenwerbung
3.3.7 Social Media Marketing
3.3.8 Social Media Monitoring
3.3.9 Banneranzeigen
3.3.10 Affiliate Marketing
3.3.11 Mobile Marketing
3.4 A
NWENDUNG
O
NLINE
-M
ARKETING UND
Z
UGEHÖRIGE
I
NSTRUMENTE
3.5 E
RGEBNIS DES
K
APITELS
4 ONLINE-MARKETING IM KRANKENHAUS
4.1 G
ESETZLICHE
R
AHMENBEDINGUNGEN
4.2 E
INSATZANALYSE
S
UCHMASCHINENOPTIMIERUNG
4.2.1 Gesetzeskonformität der Suchmaschinenoptimierung
4.2.2 Primärerhebung zum Thema Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung
4.2.2.1 Umfragedesign
4.2.2.2 Die Stichprobenzusammensetzung
4.2.2.3 Einschätzung des Wettbewerbs
4.2.2.4 Gegenwärtiger Einsatz von Online-Marketing Instrumenten
4.2.2.5 Zukünftiger Einsatz von Online-Marketing Instrumenten
4.2.2.6 Relevanz der Online-Marketing Instrumente
4.2.2.7 Gegenwärtiger Einsatz von Suchmaschinenoptimierung
4.2.2.8 Zukünftiger Einsatz von Suchmaschinenoptimierung
4.2.2.9 Messbarkeit von erfolgreichem Online-Marketing
4.2.2.10 Messbarkeit erfolgreicher Suchmaschinenoptimierung
4.2.2.11 Aussichten für die Zukunft
4.3 K
OSTEN
-N
UTZEN
-B
ETRACHTUNG FÜR DIE ORTHOPÄDISCHE
K
LINIK
S
INDELFINGEN
4.4 Z
USAMMENFASSUNG
5 FAZIT UND ERFOLGSKONTROLLE
6 ANHANG
7 LITERATURVERZEICHNIS
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: TOP10 Zukunftstendenzen kommunaler Krankenhäuser
Abbildung 2: TOP5 Chancen für kommunale Krankenhäuser
Abbildung 4: Gliederungskriterien deutscher Krankenhäuser
Abbildung 5: Krankenhäuser nach Trägerschaft (1991–2011)
Abbildung 6: Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner (2000 und 2009)
Abbildung 7: Bettenauslastung in % (2000 und 2009)
Abbildung 8: Duale Finanzierung / Zwei-Säulen-Modell
Abbildung 9: Durchschnittliches Zugangsalter in eine Altersrente, Regelaltersgrenze für eine Altersrente, fernere Lebenserwartung im Alter von 65 Jahren in Deutschland (1960–2010)
Abbildung 10: Zusammengefasste Geburtenziffer in Deutschland (1950–2011)
Abbildung 11: Altersstruktur in Deutschland (1950, 2011 und 2050*)
Abbildung 12: Entwicklung der KHG-Investitionsförderung und der bereinigten Kosten von 1991 bis 2011 (1991=100)
Abbildung 13: Investitionsquote KHs und Volkswirtschaft (1992–2009)
Abbildung 14: Tariflohn-Erlös-Schere der Krankenhäuser
Abbildung 15: Google-Suche "Operationen in Deutschland" 17.09.2013
Abbildung 16: Linkstruktur Website
Abbildung 17: Google-Suche nach "mba stuttgart" (08.10.2013)
Abbildung 18: Das alte Kommunikationsmodell
Abbildung 19: Das neue Kommunikationsmodell
Abbildung 20: Einsatz OM-Instrumente in % 2011 und zukünftig
Abbildung 21: Gesamtaufwendungen Werbemarkt Deutschland 2012 nach Teilbereichen in Prozent
Abbildung 22: Eye-Tracking einer Suchergebnisseite
Abbildung 23: Gegenwärtiger Einsatz von Online-Marketing Instrumenten
Abbildung 24: Gegenwärtiger Einsatz von Online-Marketing Instrumenten in Abhängigkeit von der heutigen und zukünftigen Wettbewerbs-Einschätzung
Abbildung 25: Zukünftiger Einsatz von Online-Marketing Instrumenten
Abbildung 26: Zukünftiger Einsatz von Online-Marketing Instrumenten in Abhängigkeit von der heutigen und zukünftigen Einschätzung des Wettbewerbs
Abbildung 27: Relevanz der Online-Marketing Instrumente für das Krankenhaus-Marketing
Abbildung 28: Gegenwärtiger Einsatz von On- und Off-Page-Instrumenten in %
Abbildung 29: Gegenwärtiger Einsatz von Instrumenten der Suchmaschinenoptimierung in Abhängigkeit von der heutigen und zukünftigen Wettbewerbs-Einschätzung
Abbildung 30: Zukünftiger Einsatz von On- und Off-Page-Instrumenten in %
Abbildung 31: Zukünftiger Einsatz von Instrumenten der Suchmaschinenoptimierung in Abhängigkeit von der heutigen und zukünftigen Wettbewerbs-Einschätzung
Abbildung 32: Messbarkeit von erfolgreichem Online-Marketing
Abbildung 33: Messbarkeit erfolgreicher Suchmaschinenoptimierung
Abbildung 34: Bedeutung von Online-Marketing und Suchmaschinenoptimierung für Krankenhäuser (heute und zukünftig)
Abbildung 35: Klinikstandorte der Klinikverbund Südwest GmbH
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Struktur des Werbemarktes und seine Instrumente
Tabelle 2: Dialogmarketing-Instrumente nach Nutzern und Gesamtaufwendungen für das Jahr 2012
Tabelle 3: Nutzenkalkulation von Suchmaschinenoptimierung
Abkürzungsverzeichnis
AGAktiengesellschaft
ARDArbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland
BIPBrutto-Inlands-Produkt
bspw.beispielsweise
BITKOMBundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V.
CMSContent Management System
DKGDeutsche Krankenhaus Gesellschaft
DKIDeutsches Krankenhaus Institut
DRGDiagnosis Related Groups
etc.et cetera
EUEuropäische Union
FAZFrankfurter Allgemeine Zeitung
GPSGlobal Positioning System
IPInternetprotokoll
KHKrankenhaus
KHGKrankenhausfinanzierungsgesetz
KHsKrankenhäuser
o.ä.oder ähnliche/s
OECDOrganization for Economic Co-operation and Development bzw. Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OMOnline-Marketing
PCPersonal Computer
PRPublic Relations
rd.rund
SEASearch Engine Advertising bzw. Suchmaschinenwerbung
SEMSearch Engine Marketing bzw. Suchmaschinenmarketing
SEOSearch Engine Optimization bzw. Suchmaschinenoptimierung
SMMSocial Media Marketing
SMOSocial Media Optimization bzw. Social Media Optimierung
u.a.unter anderem
URLUniform Resource Locator
z.B.zum Beispiel
1 Einleitung
"Kranke Häuser
-
In Deutschland haben nach derzeitigen Berechnungen etwa die Hälfte aller Krankenhäuser [KHs; Krankenhaus (KH)] im vergangenen Jahr [2012] mit einem Defizit abgeschlossen. Durch gestiegene Personalkosten, Tarifsteigerungen sowie deutlich höhere Energiekosten, machen viele Krankenhäuser, auch wenn sie sich in den vergangenen Jahren zu Klinikverbünden zusammengeschlossen haben, hohe Verluste. Während Personal- und Sachkosten um 15,9 Prozent gestiegen sind, gab es bei den Bezahlungen für Krankenhausleistungen nur einen Zuwachs von 8,7 Prozent. Rationalisierungsreserven sind größtenteils ausgeschöpft."1
Der oben zitierte Artikel aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vom 2. April 2013 verdeutlicht, wie angespannt die wirtschaftliche Situation in den deutschen KHs mittlerweile ist. Demnach schrieben 2012 rd. 50% der deutschen Kliniken rote Zahlen. Wie rasant sich die wirtschaftliche Lage der meisten deutschen KHs verändert und in welche Richtung diese zum Großteil tendiert, veranschaulicht das folgende Beispiel. Noch im Dezember 2011 titelte die FAZ auf ihrer Homepage nämlich, dass jedes fünfte Krankenhaus defizitär arbeite.2 Bereits im Januar 2013 war von jedem dritten Klinikum die Rede.3 Zwei unübersehbare Tendenzen sind hieraus ersichtlich:
1. Die Geschwindigkeit, mit der sich die ökonomische Lage der KHs verändert ist dramatisch hoch und
2. die Entwicklung der wirtschaftlichen Situation der KHs ist negativ.
Bestätigt werden diese Zahlen durch das "Krankenhaus-Barometer", welches jährlich vom Deutschen Krankenhaus Institut (DKI) erhoben wird. Darin wird auch die wirtschaftliche Lage der KHs analysiert, indem dazu Klinik-Manager befragt werden. Bezogen auf das Jahresergebnis 2011, gaben rd. 55,3% der Klinik-Manager an, einen Jahresüberschuss erwirtschaftet haben zu können. Lediglich 14,1% konnten ein ausgeglichenes Ergebnis erzielen und ganze 30,6% wiesen einen Fehlbetrag aus. Im Jahr davor gaben noch 68% an, ein positives Ergebnis, 21% ein negatives und 11% ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht zu haben.4
Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte-Touche hat in seiner 2013 durchgeführten Strategiestudie "Herausforderungen für kommunale Krankenhäuser in Deutschland" 40 Geschäftsführer kommunaler Krankenhäuser dazu befragt, welche zukünftigen strategischen Herausforderungen existieren und wie man diesen zu begegnen denkt. Die Ergebnisse der Umfrage wurden durch Beiträge von Branchenexperten ergänzt. Die dort ermittelten TOP10 der wahrscheinlichsten Zukunftstendenzen stellen sich wie folgt dar:
Abbildung 1: TOP10 Zukunftstendenzen kommunaler Krankenhäuser5
Wie bereits weiter oben festgehalten, kommt auch die Deloitte-Studie zu dem Ergebnis, dass der Kostendruck weiter anhalten wird. Am Zweitwahrscheinlichsten wird der Fortgang des demographischen Wandels gesehen. An dritter Position folgt die Einschätzung, dass kommunale Kliniken in Zukunft ein verstärktes Augenmerk auf das Marketing legen müssen. Dies liegt größtenteils darin begründet, dass Krankenhäuser heutzutage geradezu um ihre Patienten kämpfen müssen, weil ein anhaltender Druck zur Fallzahlsteigerung besteht (siehe Nr. 9 der TOP10).6 Weiterhin wurde untersucht, welche Entwicklungen die Fachleute als Chance (TOP5) für kommunale Krankenhäuser betrachten (siehe Abbildung 2):
Abbildung 2: TOP5 Chancen für kommunale Krankenhäuser7
Die Experten kommen zu dem Ergebnis, dass "Maßnahmen im Bereich Marketing / Öffentlichkeitsarbeit" die größte Chance für kommunale Krankenhäuser darstellen.
1.1 Zielsetzung
Viele deutsche KHs stehen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand und werden durch das Finanzierungssystem dazu getrieben, ihre Fallzahlen zu erhöhen. Welchen Anteil das Marketing eines KH mithilfe der Suchmaschinenoptimierung dazu beitragen kann, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.
Die zugrunde liegende Motivation der Themenauswahl wird in Kapitel 1.2, die dazu angewandte Vorgehensweise und Methodik in Abschnitt 1.3 erläutert.
1.2 Motivation
Wie bereits in der Einleitung dargestellt, sehen die Führungskräfte deutscher KHs eine vielversprechende Chance darin, die eigenen Bemühungen auf dem Sektor des Marketing und der Öffentlichkeitsarbeit zu verstärken. Der anhaltende Kostendruck und der damit verbundene Wettbewerb unter den KHs sind die maßgeblichen Treiber hierfür.
Die Motivation zur Erstellung der vorliegenden Arbeit liegt einerseits darin begründet, zu untersuchen, inwieweit Online-Marketing (OM) allgemein und Suchmaschinenoptimierung speziell für KHs einen Beitrag zur Fallzahlsteigerung leisten können.
Andererseits liegt gerade darin eine Motivation, sich einem Thema zu widmen, das nicht integraler Bestandteil des aktuellen Aufgabenspektrums des Autors ist. Mit der vorliegenden Thesis beendet der Autor sein berufsbegleitendes MBA-Studium, welches das Ziel hatte "...in der Praxis erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten..." zu ergänzen, erweitern und vertiefen.8 Sich mit Themen auseinanderzusetzen, die in erster Linie fremd erscheinen, soll den Autor dabei unterstützen, seinen fachspezifischen Horizont zu erweitern und seine Kenntnisse und Fähigkeiten im Bereich des Marketing zu vertiefen. Ganz getreu dem Motto: "Wer die Perspektive ändert, sieht die Dinge in einem ganz anderen Licht."9
1.3 Aufbau und Vorgehensweise
Das Fundament der vorliegenden Arbeit bilden vier vom Autor aufgestellte Behauptungen, die im Verlauf der Arbeit auf ihre Richtigkeit hin untersucht werden. Nachfolgend werden die einzelnen Thesen dargestellt und es wird aufgezeigt, wie die Behauptungen belegt werden sollen. Die Untersuchungsmethodik basiert in den Kapiteln 2 und 3 primär auf theoretischer Sekundärerhebung und bringt dabei eine Vielfalt unterschiedlicher Literatur zur Anwendung.
Dagegen kommen im vierten Kapitel sowohl theoretisch abgeleitete Erkenntnisse als auch eine Primärerhebung im Rahmen einer Umfrage zur Geltung.
These 1 - Die Definition eines Krankenhauses muss neu überdacht werden: KHs sind heutzutage nicht mehr "nur" soziale Einrichtung. Vielmehr müssen alle Beteiligten erkennen, dass auch KHs Wirtschaftsbetriebe sind, die ökonomisch handeln müssen.
Um These 1 zu beweisen, wird zunächst in Kapitel 2 das deutsche Gesundheitssystem mit seiner geschichtlichen Einordnung dargestellt. Im Anschluss daran wird der Wirtschaftssektor "Gesundheit" kategorisiert. Darin enthalten ist die Analyse ökonomischer Größen zur Klassifizierung des Marktes. Dem Leser wird ein Bild dessen vermittelt, welche Rolle dieser Sektor in der deutschen Wirtschaft spielt.
Im Anschluss daran wird der Krankenhaus-Markt als wesentlicher Teilbereich des Gesundheitssystems analysiert. Hierbei wird untersucht, wie sich maßgebliche Indikatoren im Krankenhaus-Bereich über den Zeitverlauf verändert haben, was die Ursachen hierfür sind bzw. waren und welche Auswirkungen daraus resultieren.
Aufgrund der Tatsache, dass die Systematik der KH-Finanzierung eine besondere ist und deren Prinzipien vielen nicht geläufig sind, werden im Anschluss die Grundsätze der KH-Finanzierung und deren geschichtliche Entwicklung aufgearbeitet.
Nachfolgend werden schließlich die Herausforderungen, die sich im Gesundheitssektor im Allgemeinen und im Krankenhaussektor im Speziellen ergeben, herausgearbeitet. Aufgrund der Tatsache, dass KHs sich einem immer schärferen Wettbewerb ausgesetzt sehen, welcher auch zu einem Wettbewerb um die Patienten führt, schließt das Kapitel mit den Argumenten ab, die These 1 belegen.
These 2 - Online-Marketing ist ein maßgeblicher Erfolgsfaktor von Wirtschaftsunternehmen und These 3 - Mit Suchmaschinenoptimierung lassen sich mehr Kunden gewinnen.
Zu Beginn des dritten Kapitels werden zunächst begriffliche Abgrenzungen und Definitionen vorgenommen. Sie sind notwendig, um daran anschließend die Instrumente des OM zu untersuchen. Dadurch soll das notwendige theoretische Fundament gelegt werden. Aufgrund der thematischen Ausrichtung der Arbeit, liegt der Fokus dabei auf dem Instrument der Suchmaschinenoptimierung. Der Definition des Instruments schließen sich ihre Werkzeuge und deren Wirkungsweise an. Die fokussierte Betrachtung endet mit der Analyse, wie man den Erfolg von Maßnahmen der Suchmaschinenoptimierung messbar machen kann. Im weiteren Verlauf des Kapitels findet mit Hilfe von Studien eine Untersuchung statt, welche OM-Instrumente heute zur Anwendung kommen. Des Weiteren wird der gesamte Werbemarkt Deutschland analysiert. Darauf aufbauend findet eine Untersuchung des Teilbereichs OM statt. Schließlich werden Schlussfolgerungen abgeleitet, welche die Aussagekraft von These 2 stützen sollen. Außerdem wird unter der Berücksichtigung der gefundenen Ergebnisse zur zweiten These und der Analyse weiterer Studien zum Bereich der Suchmaschinenoptimierung These 3 bewiesen.
These 4 - Krankenhäuser können mit Hilfe von Suchmaschinenoptimierung ihre Fallzahlen erhöhen bzw. neue Patienten gewinnen
Es wurde gezeigt, dass KHs sich heute als Wirtschaftsunternehmen verstehen müssen und OM im Allgemeinen und Suchmaschinenoptimierung im Besonderen unternehmerische Erfolgsfaktoren sind. In Kapitel 4 wird schließlich unter Zuhilfenahme weiterer Literatur als auch einer Primärerhebung in Form einer Umfrage gezeigt, dass Suchmaschinenoptimierung dazu beitragen kann, neue Patienten zu gewinnen.
Nach der Darstellung des Untersuchungsdesigns, folgt die detaillierte Analyse der Umfrageergebnisse. Anschließend werden die Erkenntnisse der vorangegangenen Abschnitte mit den Ergebnissen der Umfrage kombiniert. Ergänzend dazu findet eine beispielhafte Kosten-Nutzen-Analyse statt. Im Resultat ergibt sich die Argumentation für These 4.
1 (Soldt, 2013)
2 (Mihm, 2011)
3 Vgl. (o.V. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2013)
4 Vgl. (Janßen, et al., 2012 S. 242f.)
5 (o.V. Deloitte Toche GmbH, 2013 S. 5)
6 Vgl. (o.V. Deloitte Toche GmbH, 2013 S. 5)
7 (o.V. Deloitte Toche GmbH, 2013 S. 9)
8 (o.V. Campus of Finance, 2012)
9 Engelbert Schinkel.
2 Das deutsche Gesundheitssystem
Der Ursprung des deutschen Gesundheitssystems liegt Ende des 19. Jahrhunderts, als unter Kanzler Bismarck 1883 die gesetzliche Krankenversicherung eingeführt wurde. In den darauffolgenden Jahren wurde diese durch weitere Komponenten ergänzt: es folgten die Betriebsunfallversicherung (1884), die Rentenversicherung (1889) und schließlich die Arbeitslosenversicherung (1927), womit das Fundament des deutschen Sozialversicherungssystems bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gelegt worden war. Zur gleichen Zeit entwickelte sich parallel das private Versicherungssystem. 1994 führte man als weitere Ergänzung die Pflegeversicherung ein.10 Dieses System ist auch heute noch weitestgehend in Deutschland etabliert.
Die in 2011 getätigten Ausgaben für Gesundheit11 beziffern sich in Deutschland auf rd. 294 Mrd. €. Dies entspricht einem Anteil von rd. 11,3% am Brutto-Inlands-Produkt (BIP). Obwohl sich das Wachstum der Gesundheitsausgaben in den davorliegenden Jahren abschwächte (2010: 11,5%; 2009: 11,8%)12, stieg die Bedeutung des Gesundheitssektors auf dem Beschäftigungsmarkt. Von 2006–2011 wuchs die Anzahl der Beschäftigten im Gesundheitswesen13 um über 457.000 bzw. 10,2%. Damit waren Ende 2011 insgesamt mehr als 4,9 Mio. Menschen in Deutschland in diesem Bereich tätig. Das bedeutet, dass jeder neunte in diesem Bereich beschäftigt ist. Wie Anlage 1 veranschaulicht, sind die meisten Personen (2011: 2,159 Mio.) in ambulanten Einrichtungen wie z.B. Arztpraxen oder Apotheken beschäftigt. Der Zweitgrößte Anteil entfällt auf die stationären bzw. teilstationären Einrichtungen mit rd. 1,97 Mio. 2011. Davon arbeiten wiederum rd. 1,14 Mio. Menschen in KHs.14
Das Gesundheitssystem spielt demnach eine tragende Rolle in der deutschen Gesellschaft. Nicht nur der Arbeitsmarkt "Gesundheit" (siehe oben), sondern auch die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit aller Beschäftigten in Deutschland ist ein wichtiger Faktor. Der wirtschaftliche Schaden durch Krankheiten und Unfälle ist nicht zu unterschätzen: Im Jahr 2006 gingen dadurch am Arbeitsmarkt je Erwerbstätigem rund 37 Kalendertage verloren. Zusammen waren das rund 4 Millionen verlorene Erwerbstätigkeitsjahre. Arbeitsausfälle durch Arbeitsunfähigkeit, Invalidität und vorzeitigen Tod vor dem 65. Lebensjahr sind darin enthalten.15
2.1 Der Krankenhausmarkt
2011 gab es in ganz Deutschland 2.045 KHs mit insgesamt 502.029 aufgestellten Betten und 18.344.156 vollstationär behandelten Patienten16. Bei 141.676 Tsd. Belegungstagen ergibt sich für das Jahr 2011 eine durchschnittliche Verweildauer (Anzahl der Belegungstage dividiert durch die Anzahl der Fälle) im KH von 7,7 Tagen und eine Bettenauslastung von rd. 77,3%17. Analysiert man die Ergebnisse aus dem Jahr 1991 (Inkrafttreten der bundeseinheitlichen Rechtsgrundlage Krankenhausstatistik-Verordnung), so ergeben sich deutliche Unterschiede. 1991 existierten bundesweit noch 2.411 KHs mit 665.565 aufgestellten Betten. Insgesamt wurden 14.576.613 Fälle mit 204.204 Tsd. Belegungstagen behandelt. Die durchschnittliche Verweildauer lag bei 14,0 Tagen und die Auslastung der Betten bei 84,1%.18
Im direkten Vergleich (2011 vs. 1991) ergeben sich sechs gravierende Veränderungen:
1) eine Reduktion der Anzahl der KHs um rd. 360 bzw. 15,2%,
2) eine Reduktion der aufgestellten Betten von rd. 163.500 bzw. 24,6%,
3) eine Steigerung der Fallzahlen von rd. 3,77 Mio. bzw. 25,8%,
4) eine Reduktion der Belegungstage von rd. 62.500 Tagen bzw. 30,6%,
was gleichbedeutend damit ist,...
5) dass die durchschnittliche Verweildauer um rd. 6,3 Tage bzw. 44,9% und
6) die Bettenauslastung um absolut 6,74% bzw. relativ auf das Jahr 1991 (Basis 100) betrachtet um 8,0% gesunken ist.
Abbildung 3 veranschaulicht fünf der soeben herausgearbeiteten Entwicklungen im Zeitverlauf von 1991–2011.
Das verbliebene sechste Element, die Entwicklung der Anzahl der KHs, wird um ein weiteres Charakteristikum erweitert: deutsche KHs lassen sich nach fünf unterschiedlichen Kriterien gliedern, welche in Abbildung 4 illustriert werden.
Abbildung 4: Gliederungskriterien deutscher Krankenhäuser20
Die markantesten Veränderungen ergeben sich, wenn man als weiteres Unterscheidungskriterium die Art der Trägerschaft21 hinzuzieht.
Demnach gab es 1991 2.411 KHs, von denen 1.110 in öffentlicher, 943 in freigemeinnütziger und 358 in privater Trägerschaft waren. Im Kontrast dazu, haben sich die Zahlen bis zum Jahr 2011 dramatisch verändert. Die KHs mit einem öffentlichen Träger reduzierten sich um 489 bzw. 44,1%. Freigemeinnützig getragene Einrichtungen verringerten sich um 197 bzw. 20,9%. Alleine die privaten Träger konnten im selben Zeitraum einen Zuwachs von 320 KHs verzeichnen, was einem Anstieg von rd. 89,4% entspricht. Insgesamt reduzierte sich die Anzahl der KHs insgesamt demnach um 366 bzw. 15,2%.22 In Abbildung 5 sind die gegenläufigen Tendenzen klar ersichtlich (die Anzahl der KHs insgesamt wird an der Sekundärachse skaliert).
Abbildung 5: Krankenhäuser nach Trägerschaft (1991–2011)23
Die zeitliche Gegenüberstellung zeigt, dass sich auf dem Krankenhaus-Markt in den letzten zwanzig Jahren vieles verändert hat. Nicht nur, dass immer mehr Fälle behandelt werden und dies mit stetig sinkendem Zeitaufwand. Vielmehr muss das Plus an Patienten mit immer weniger werdenden KHs versorgt werden. Darüber hinaus verdrängen die privaten Kliniken immer mehr die seither vorherrschenden Träger auf dem Markt.
Und dennoch weist Deutschland eine der höchsten Bettendichten weltweit auf. Nur Japan (13,7), Russland (9,7) und Korea (8,3) hatten 2009 mehr Betten je 1.000 Einwohner als Deutschland. Mit rd. 8,2 Betten je 1.000 Einwohner liegt Deutschland mit mehr als 3 Betten über dem Durchschnitt der 27 OECD-Staaten24 (siehe Abbildung 6).25
Abbildung 6: Krankenhausbetten je 1.000 Einwohner (2000 und 2009)





























