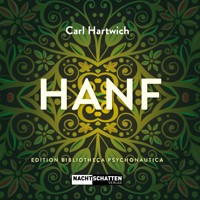11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Nachtschatten Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Carl Hartwich war zu Anfang des 20. Jahrhunderts seiner Zeit weit voraus. Sein Werk "Die menschlichen Genußmittel" von 1911 ist heute nur noch selten antiquarisch und wenn, dann zu horrenden Preisen erhältlich. Der ethnopharmakologische Klassiker dokumentierte früher als alle anderen Bücher psychotrope Pflanzen und Pilze aus der ganzen Welt; zum Teil fragen Fachleute sich bis zum heutigen Tag, wo der Autor all die vielfältigen Informationen ausgegraben hat. Der Nachtschatten Verlag macht mit diesem neu gestalteten Reprint das originale Kapitel zum Thema Opium wieder verfügbar. Mit Informationen zur Abstammung und Geschichte des Schlafmohns, zu Opium in Asien, Afrika, Australien, Amerika und Europa, zu den Inhaltsstoffen und zur Wirkung des Opiums, zum Konsum und der Herstellung von rauchbarem Opium sowie zu den Rauchtechniken dieses medizinisch wertvollen Saftes des Mohns. Ein einzigartiges Dokument der Zeitgeschichte psychoaktiver Drogen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 177
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Carl Hartwich
OPIUM
Edition Bibliotheca Psychonautica
E-Book-Ausgabe
Die Verbreitung dieses Produkts durch Funk, Fernsehen oder Internet, per fotomechanischer Wiedergabe, auf Tonträgern jeder Art, als elektronisches beziehungsweise digitales Medium sowie ein über das Zitier-Recht hinausgehender auszugsweiser Nachdruck sind untersagt. Jegliche öffentliche Nutzung bzw. Wiedergabe setzt die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Nachtschatten Verlag AG voraus.
Diese Publikation enthält versteckte und personalisierte Informationen bezüglich Herstellung, Vertrieb, Verkauf und Käufer. Im Falle von unerlaubter Verbreitung des Inhalts behält sich der Rechteinhaber vor, Missbräuche juristisch zu belangen.
Herstellung:
Bookwire GmbH
Voltastraße 1
60468 Frankfurt am Main
Deutschland
Verlag:
Nachtschatten Verlag AG
Kronengasse 11
4500 Solothurn
Schweiz
Impressum
Carl Hartwich, Opium
Nachtschatten Verlag AGKronengasse 11, CH-4500 SolothurnTel: 0041 32 621 89 49, Fax: 0041 32 621 89 [email protected], www.nachtschatten.ch
© 2022 Nachtschatten Verlag
Reprint des Kapitels OPIUM aus dem KlassikerDie menschlichen Genussmittel von 1911,Leipzig: Chr. Herm. Tauchnitz Verlag
Edition Bibliotheca Psychonautica
Projektbetreuung: Markus Berger, FelsbergTexterfassung: Nina Seiler, ZürichKorrektorat: Jutta Berger, FelsbergGestaltung und Layout: Tobias Strebel, Zürich/MägenwilUmschlaggestaltung: Nina Seiler, ZürichDruck: Bookwire, Frankfurt/M.
ISBN: 978-3-03788-498-0eISBN: 978-3-03788-647-2
Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronische digitale Medien und auszugsweiser Nachdruck sind nur mit Genehmigung des Verlags erlaubt.
Inhalt
Vorwort des Herausgebers
Opium
Abstammung, Geschichte im Altertum, Mittelalter und bis zum 17. Jahrhundert
Opium in China
Opium in Japan, Hinterindien, im malayischen Archipel, Australien, Amerika, Frankreich, England
Opium in Indien und die neueste Entwicklung in China
Bestandteile des Opiums, Herstellung des Rauchopiums, das Rauchen und dabei verwendete Gerätschaften. Gegenmittel gegen den Opiumgenuß
Das Opium in Persien, Klein-Asien, Bulgarien, Ägypten
Wirkung des Opiumgenusses
Anhang
Der Autor Carl Hartwich
Weiterführende Literatur
Vorwort des Herausgebers
In unserer neuen Edition Bibliotheca Psychonautica machen wir vergriffene, seltene und essentielle Werke der Drogenforschung wieder verfügbar, die einen gewichtigen Einfluss auf die ethnopharmakologische Wissenschaft hatten bzw. haben. Wir eröffnen die Reihe mit diesem Band zum Sujet des Opiums, der einem der wichtigsten deutschsprachigen Bücher zum Thema entnommen ist. Die Rede ist vom knapp 900 Seiten starken Titel Die menschlichen Genussmittel — ihre Herkunft, Verbreitung, Geschichte, Anwendung, Bestandteile und Wirkung vom Autor Carl Hartwich, der im Jahr 1911 veröffentlicht worden war. Eine weitere Auflage bzw. Ausgabe dieses Opus‘ ist indessen nie publiziert worden, das Buch ist antiquarisch kaum noch verfügbar und wenn, dann zu annähernd unbezahlbaren Preisen. Daher machen wir mit vorliegendem Druck das Kapitel über Opium und Schlafmohn für die heutige Zeit, in der die Ressentiments und Vorurteile gegenüber psychotropen Substanzen und Organismen allmählich abgebaut werden und auch die Forschung global entsprechend wieder aufgenommen wird, erneut greifbar.
Carl Hartwich war einer der frühesten deutschen Ethnopharmakologen, sein bahnbrechendes umfangreiches Werk ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eines der faszinierendsten Bücher der Psychoaktivaforschung — mitunter fragen sich Fachleute bis zum heutigen Tag, wo der Pharmazeut die vielfältigen Informationen, z.B. zu exotischen und damals kaum bekannten psychotropen Pflanzen wie Mitragyna speciosa, Kanna (Mesembryanthemum tortuosum bzw. Sceletium tortuosum), Tabernanthe iboga etc., ausgegraben hatte.
Wir haben den Text nicht den Regeln der neuen Rechtschreibung angepasst, sondern — wie bei klassischen Reprints üblich — in seiner Originalform belassen. Nur allzu augenscheinliche Fehler, die Autor und Verlag damals entgangen waren, haben wir stillschweigend korrigiert. Auch Seitenverweise, die sich im Originalbuch auf andere Kapitel beziehen, wurden entsprechend entfernt.
Für die gegenwärtige Rezeption erscheint die heute zum Teil durchaus antiquierte Sprache hier und da gewöhnungsbedürftig, zumal auch die Grammatik Anfang des 20. Jahrhunderts noch eine andere gewesen war. Dies ist insbesondere an den Kommaregeln zu sehen, die zuweilen »falsch« anmuten, damals jedoch korrekt gewesen sind. Es lohnt sich aber, sich in den Stil einzulesen, denn die zahlreichen Informationen, die Carl Hartwich zusammengetragen hatte, sind heute in kaum einem modernen Werk zu finden. Auch dies soll sich mit der Edition Bibliotheca Psychonautica zukünftig ändern.
Markus Berger, Mai 2022
OPIUM
Der Charakter des Opiums und seines Genusses, sowie seine Stellung unter den Genußmitteln von weiterer Verbreitung ist eine eigenartige. Die meisten spielen in irgendeiner Weise eine Rolle im religiösen Leben der Völker, indem sie vermöge ihrer eigenartigen Wirkung Vermittler sind zwischen den Menschen und höhereren Mächten, sei es, daß nach der Überlieferung diese die Genußmittel den Menschen geschenkt haben, sei es, daß die Menschen sie benutzen, um sich in Verbindung mit der Gottheit zu setzen. Beim Opium wissen wir nichts von solchen Sachen, es ist nur Genußmittel im engsten oder, wie wir sagen können, im rohesten Sinne. Von dem geheimnisvollen Schleier, der die Entdeckung mancher Genußmittel oder ihren Gebrauch umhüllt und der sie nach mancher Richtung so interessant macht, finden wir keine Spur.1 Kalt und groß steht es vor uns da: ein Völkergift, aber auch segensreich in seinen Heilkräften. Vielleicht keines, auch der Alkohol nicht ausgenommen, wirkt so verderblich, und wenn es hinter diesem auch an Verbreitung auf der Erde weit zurückbleibt, so ist es doch noch jetzt im Vorschreiten begriffen, und bemerkenswert ist es, daß dieses Vorschreiten direkt oder indirekt an ein einziges Volk geknüpft ist: die Chinesen, bei denen sein Gebrauch nicht einmal ursprünglich heimisch ist. Gerade dieses Vorschreiten in neuerer und neuester Zeit ist wieder ganz charakteristisch und ein Beweis, daß die seit längerer Zeit bekannten Reizmittel, Kaffee, Tee, Tabak und selbst der Alkohol dem Bedürfnisse vieler Menschen nach solchen Dingen nicht genügen. Es ist gewiß höchst merkwürdig, daß Völker wie die Engländer und Franzosen bei genauerer Berührung mit den Chinesen das Opium gern aufnehmen, freilich sind das neben Seeleuten und Soldaten, die die Übertragung von Osten her besorgen, anscheinend großenteils Menschen, deren abgestumpften Nerven jedes neue Reizmittel ohne jede Überlegung der möglichen oder wahrscheinlichen Folgen recht ist.
Abstammung, Geschichte im Altertum, Mittelalter und bis zum 17. Jahrhundert.
Die Pflanze, aus der man das Opium gewinnt, ist der »Schlafmohn« (Papaver somniferum L.) (Familie der Papaveraceae). Die ganze Pflanze ist von einem System von Milchsaftschläuchen durchzogen, die an der Außenseite der Gefäßbündel liegen. Ihr Inhalt, den man durch Anschneiden der Kapseln austreten läßt, ist, wenn er getrocknet ist, das Opium. Wie sich noch weiter zeigen wird, verdankt er seine Wirksamkeit einer ganzen Anzahl von Alkaloiden und zwar ist der Milchsaft der unreifen Kapsel daran am reichsten. Während der weiteren Entwicklung der Pflanze werden die Alkaloide wieder verbraucht, daher enthalten reife Mohnkapseln davon höchstens nur noch Spuren und sind so gut wie ungiftig. Die Familie der Papaveraceen ist an Milchsaft führenden Pflanzen reich, ich erinnere an den so auffallend orangerot gefärbten Milchsaft des Schöllkräutes (Chelidonium majus L.).
Der Schlafmohn ist keine wilde Pflanze, sondern sie ist durch Kultur entstanden aus dem im Mittelmeergebiet (Griechenland, Cypern, Sizilien, Korsika, Algerien, Spanien) vorkommenden Papaver setigerum D.C.
Aus dieser Pflanze ist also der Schlafmohn mit seinen zahlreichen Formen, die besonders die Farbe der Samen und der Blüten in starker Abänderung zeigen, entstanden.2
In der Kultur verliert die Kapsel die Fähigkeit, sich zu öffnen und den Samen auszustreuen, eine Eigentümlichkeit, die für den Menschen, der die Samen verwerten wollte, wertvoll war und die wir auch bei anderen Kulturpflanzen, wie dem Lein und den Getreidearten, antreffen. Die kleinen, schwarzen Samen werden allmählich größer und heller, sie werden braun, gelb, fleischfarben, endlich weiß.
Man faßt gegenwärtig die kultivierten Formen mit der wilden zusammen zu einer Art, die man als Papaver somniferum L. bezeichnet und von der man drei Varietäten unterscheidet: α setigerum, die wilde Form, β nigrum D.C. (glabrum Boiss.) mit violetten Blüten, schwarzen Samen und sich öffnender Kapsel und γ album D.C. mit weißen Blüten, weißen Samen und geschlossen bleibenden Kapseln. Die Varietät β steht der wilden Form deutlich näher als Varietät γ.
Man hat den Mohn schon sehr frühzeitig in Kultur genommen.
In mehreren schweizerischen Pfahlbauten (Robenhausen, Moosseedorf, Niederwiel, Steckborn) die der jüngeren Steinzeit angehören und an einigen anderen Orten (Lagozza Prov. Mailand, Bourget in Savoien) hat man Mohnsamen und in Robenhausen eine Mohnkapsel gefunden, von denen ich (l. c.3) nachgewiesen habe, daß sie der wilden Pflanze noch ziemlich nahe standen, sich aber doch durch die Kultur schon merklich von ihr entfernt hatten. Es drängt sich dabei naturgemäß die Frage auf, zu welchem Zweck man den Mohn wohl in Kultur genommen habe und weshalb speziell die schweizerischen Pfahlbauer nördlich der Alpen ihn eingeführt und gebaut haben mögen. Auf den ersten Blick scheint es der Ölgehalt der Samen gewesen zu sein, der die Menschen für den Mohn interessiert hat, aber bei näherem Zusehen ist das doch nicht so sicher, denn den Menschen standen in anderen Pflanzen (Buche, Haselnuß, Linde, Lein, Cruciferen usw.) andere ölliefernde Pflanzen reichlich zu Gebote, deren Material leichter zu verarbeiten war, als die außerordentlich kleinen Samen des Mohn. Man wird also doch wenigstens die Möglichkeit zuzugeben haben, daß man den Mohn in erster Linie nicht als Ölpflanze verwendete und dann liegt es natürlich am nächsten, an eine Verwendung als Genußmittel zu denken. Man wird dabei nicht gleich die Gewinnung von Opium aus ihm annehmen müssen, sondern kann sich ganz gut vorstellen, daß man die Pflanze kaute oder einfach Auszüge aus ihr herstellte. Daß auch Formen wie die der Schweizer Pfahlbauten, die dem wilden Mohn, wie ich schon sagte, noch ziemlich nahe stehen, sich dazu sehr wohl eignen, ist zweifellos. In meinem Laboratorium untersuchtes, in Zürich gewonnenes Papaver setigerum enthielt, auf die trockene Pflanze berechnet 0,318 Proz. Alkaloide, eine für die genannte Verwendung hinreichende Menge. Diese Möglichkeit wird noch dadurch gestützt, daß in den ältesten schriftlichen Nachrichten über den Mohn es die Giftpflanze und nicht die Ölpflanze ist, die man verwendet.
Diese ältesten schriftlichen Nachrichten über das Opium und den Schlafmohn erhalten wir von den Griechen, aus denen bald hervorgeht, daß die schlafmachenden und arzneilichen Kräfte des Mohns und des aus ihm gewonnenen Opiums etwas Bekanntes waren.
In der llias (VIII. 307–308) steht: Teukros, der Bogenschütze, schießt einen Pfeil auf Hektor, verfehlt ihn aber und trifft an seiner Stelle einen anderen der 50 Söhne des Priamos, Gorgythion:
»So wie der Mohn zur Seite das Haupt neigt, welcher im GartenSteht, von Wuchs belastet, im Regenschauer des Frühlings:Also neigt er zur Seite das Haupt, vom Helme beschwert.«
In einer dem HIPPOKRATES zugeschriebenen Schrift, deren Echtheit hier nicht untersucht sei, ist die Rede von der arzneilichen Verwendung des Mekonion (μηκώνιον). Es könnte zweifelhaft sein, ob man hier an Mohnsaft, der freilich, wie man noch sehen wird, ganz allgemein Mekonion heißt, zu denken hat, da mit demselben Namen auch der Saft einer Wolfsmilchart, der Euphorbia peplus L., bezeichnet wird, den man ebenfalls medizinisch verwendet und zwar als Abführmittel. Da nun aber bei HIPPOKRATES Mekon (μηκών) und Mekonion als stopfendes Mittel, also von entgegengesetzter Wirkung vorkommen, so kann es sich nicht um Euphorbia peplus handeln und wir werden gerade um dieser für den Mohn und das Opium so charakteristischen Wirkung willen kein Bedenken tragen, darin den Mohn und Mohnsaft zu erblicken. Ob man den Mohnsaft durch Anritzen der Kapseln gewonnen, wie das für das Opium geschieht oder durch Auspressen des Saftes der ganzen Pflanze, wissen wir nicht, doch kann man sagen, daß in der Folgezeit häufig zwischen dem durch Anritzen der Kapseln gewonnenen Opium und dem durch Auspressen der Pflanze gewonnenen Mekonium unterschieden wird.
Viel besser unterrichtet werden wir durch den größten Botaniker des Altertums, THEOPHRAST von Eresos, den Schüler des ARISTOTELES (etwa 370–287). Er spricht in seiner »Pflanzengeschichte (Lib. IX cap. 8) von den Milchsäften« der Pflanzen: »Das Ausziehen (des Milchsaftes) geschieht entweder aus dem Stengel wie bei der Wolfsmilch (τιθυμαλλος), der Lactuca (θριδαχίνη) und fast den meisten, oder aus der Wurzel oder aus dem Kopfe, wie beim Mohn (ἀπὸ ὥσπερ τῆς κεφαλἧς τῆς μηκώνoς). Bei diesem geschieht es allein und das ist ihm eigentümlich. Bei einigen gerinnt der Milchsaft von selbst tränenartig, wie beim Traganth und bei diesem braucht man keinen Einschnitt zu machen; die meisten aber schneidet man ein. Deren Saft wird sogleich in Gefäßen aufgefangen wie bei der Wolfsmilch oder dem Mekonion, denn mit beiden Namen benannte man es, wie überhaupt bei denjenigen, welche viel Saft geben; die aber weniger Saft geben, bei denen fängt man ihn in Wolle auf, wie bei der Lactuca«. Diese Stelle ist mehrfach sehr interessant: wie ich schon bei HIPPOKRATES andeutete, wird dort auch der Saft der Wolfsmilch als Mekonion bezeichnet, während hier dieser Saft und das Präparat aus dem Mohnkopf auseinandergehalten werden. Dann erfahren wir und das ist das wichtigste, daß man den Milchsaft des Mohnes durch Anschneiden des Kopfes (der Frucht) gewinnt und diese Methode war also schon damals wie noch heutigen Tages nur beim Mohn gebräuchlich und liefert das Opium. Andere Pflanzensekrete werden noch heute wie zu THEOPHRASTS Zeit durch Anschneiden der Wurzel wie die Asa foetida oder der Stengel, wie das Euphorbium oder dicker Stämme, wie die Benzoe, der Copaiva-, Peru-Tolubalsam, von denen THEOPHRAST freilich nichts wußte, gewonnen.
Man hat den Eindruck, daß die Gewinnung des Mohnsaftes durch Anschneiden des Kopfes damals etwas schon Bekanntes war. Interessant ist es endlich, daß hier neben dem Opium das »Lactucarium«, der Milchsaft mehrerer Lactuca-Arten (L. virosa L., L. altissima BIEBERSTEIN, L. sativa L. var. capitata (Salat), L. canadensis L., L. elongata MÜHLENBERG) erscheint, welches von ähnlicher aber viel schwächerer Wirkung wie das Opium ist. Das Lactucarium war bis in die neueste Zeit ein Konkurrent des Opiums, wenn auch ein wenig erfolgreicher. Jetzt wird es nur noch in geringer Menge in dem Städtchen Zell an der Mosel, in Rußland (Poltawa), Niederösterreich (Waidhofen a. d. Thaya), Edingburgh, Frankreich (Clermont- Ferrand) gewonnen.
Noch an einer anderen Stelle seines Buches (lib. IX. cap. 16) spricht THEOPHRAST vom Opium und zwar von seiner Giftigkeit: »THRASYOS von Mantinea wollte ein Gift gefunden haben, wodurch ein leichtes und schmerzloses Ende bewirkt werde, bereitet aus dem Safte des Schierlings, des Mohnes und anderer ähnlicher, dessen Menge so klein und gering ist, daß das Gewicht einer Drachme (3,75 g) ausreichte — «. Der leichte und schmerzlose Tod ist für das Opium charakteristisch.
Daß der Schierling als Gift bei den Griechen besonders beliebt war, ist bekannt, er diente zur Hinrichtung von Staatsverbrechern, ich erinnere an SOKRATES. THRASYOS war »Rhizotom«, was wir vielleicht am besten mit Naturarzt übersetzen, da die genauere Übersetzung »Wurzelgräber« die Tätigkeit dieser Leute nicht erschöpft. Hier erscheint das Opium als Gift.
Aber zur selben Zeit war seine schlafmachende Wirkung dem griechischen Volke offenbar auch schon als etwas Wohltätiges bekannt. Etwa seit dem Ende des vierten Jahrhunders wird der Gott des Schlafes »Hypnos« abgebildet in der einen Hand einen Stengel mit Mohnkopf, mit der anderen, erhobenen, gießt er aus einem hornartigen Gefäß eine Flüssigkeit aus. Daß man sich darunter eine schlafbringende Flüssigkeit, die man aus Mohn machte, vorstellen kann, ist klar5.
Wo man das Opium gewann, sagt uns THEOPHRAST nicht. Vielleicht klärt eine andere, freilich recht sagenhafte Mitteilung darüber auf. AELIANUS (2. Jahrh. n. Chr.) berichtet in seiner Historia animantium (IV. c. p. 41) folgendes:
»In Indien gibt es eine Art Vögel, so groß wie die Eier von Rebhühnern, welche auf den Bergen nisten, von gelber Farbe. Die Inder nennen sie Dikaron (διχαιρον). Wenn jemand von dem Unrat dieser Vögel so viel nimmt als ein Hirsekorn und dieses in Wasser aufgelöst am Morgen trinkt, so fällt er in Schlaf und muß am Abend sterben. Die Inder legen deshalb den größten Wert auf den Besitz desselben, denn sie halten es in der Tat für ein Vergessen des Übels. Daher schickt es auch der König der Inder als eines der kostbarsten Geschenke an den persischen König. Dieser schätzt es vor allen anderen und bewahrt es in seiner Schatzkammer als Gegenmittel und Abwehr unheilbarer Übel, wenn die Not es erfordert. Daher besitzt es auch bei den Persern niemand als der König und die Mutter des Königs.«
Nach HEEREN6 hat AELIAN diese Nachricht aus den »Ἰνδικα« des KTESIAS entlehnt, wie alle anderen Nachrichten über Indien. Das Werk des KTESIAS selbst ist verloren gegangen. Dieser, ein Zeitgenosse des XENOPHON, lebte als Leibarzt am Hofe des ARTAXERXES II.
Jedenfalls handelt es sich hier um einen schlafmachenden, eventuell tödlich wirkenden Stoff, der aus Indien nach Persien gelangte, und daß man dabei zuerst an Opium denkt, liegt sehr nahe. Alles andere ist dunkel und sagenhaft, wie AELIAN solche abenteuerlichen Geschichten überhaupt liebt. HEEREN will in dem Vogel den indischen Schneidervogel oder Tati (Motacilla sutoria L.) erblicken, der hellgelb ist und kleiner wie der Zaunkönig. Der Vergleich nach Farbe und Größe mit den Eiern von Rebhühnern paßt also gar nicht schlecht. Wenn man sich aber vorstellt, daß die gelbe und eiförmige oder auch mehr kuglige Frucht des Mohnes, aus der man das Opium gewann, Veranlassung zu der Vergleichung mit dem Vogel gegeben hat, so kommt man einen Schritt weiter. Diese Nachricht würde also nach Indien weisen, denn, wenn das Opium in Persien selbst gewonnen wäre, so wäre das KTESIAS, der dort als Arzt an wichtiger Stelle lebte, wohl bekannt gewesen. Auch, daß die Angaben bei THEOPHRAST aus Indien stammen, ist ganz wahrscheinlich. Wir wissen besonders durch die Untersuchungen von BRETZL7, daß THEOPHRAST in seiner Pflanzengeschichte Berichte von Naturforschern, die ALEXANDER d. Gr. auf seinem Zuge begleiteten, verarbeitet hat. Diese ältesten Nachrichten weisen also, wenn auch sehr unbestimmt, nach Indien. Das wird noch unbestimmter, da, wie ich DYMOCK8 entnehme, alte Nachrichten über das Opium aus Indien selbst nicht bekannt sind. Sicher dürfen wir aber annehmen, daß die Kunst, aus Mohn Opium zu gewinnen, zugleich mit dem Namen später durch arabische Eroberer in Indien (wieder?) eingeführt wurde. Der Sanskritname »ohiphena«, der Opium bedeuten soll, dürfte sich vom griechischen »opos« (= Saft) und dem arabischem »aphiun« ableiten, womit man die Droge bezeichnet.
In der Zeit nach THEOPHRAST ist an Nachrichten bei den griechischen Schriftstellern kein Mangel und bei einigen gewinnt man den deutlichen Eindruck, daß die Griechen die Gewinnung des Opiums genau gekannt haben, woraus sich wohl schließen läßt, daß man Opium auch in näher gelegenen Gegenden als dem fernen Indien gewann. Ich möchte an Klein-Asien denken, welches die Droge jetzt noch liefert.
NIKANDER von Kolophon (um 150 v. Chr.) verwendet in seinem Buch von den Gegengiften »Alexipharmaka«, »Tränen des im Kopfe Samen tragenden Mohnes«. Auch CELSUS (35 v. Chr.) bezeichnet das Opium als »Tränen des Mohnes«.
DIAGORAS, ein Schüler des DEMOKRITOS, also im 5. Jahrhundert v. Chr. lebend, ist ein Gegner der Anwendung des Opium, ebenso Erasistratos aus Julis (304-257), wogegen der Schüler des MANTIAS, HERAKLIDES aus Tarent (3. Jahrh. v. Chr.), es gerne verwendet. Diese Angaben mögen genügen.
Wir sehen, daß schon vor dem Beginne unserer Zeitrechnung die Bekanntschaft der klassischen Naturforschung und Medizin mit dem Opium eine nicht geringe war.
Eine Menge neuer Einzelheiten, die das Bild abrunden, finden wir bei DIOSKURIDES (1. Jahrh. nach Chr.)9 Ich nehme diejenigen Angaben, die uns interessieren, — auch über den Mohn — heraus: Die Pflanze heißt Mekon hemeros (μηκών ἥμερος) Gartenmohn. Einige nennen sie Chamaisyke (χαμαισύκη), andere Oxytonon (ὀξύτονον), die Römer Papaver, die Ägypter Nanti. — Der Same wird ins Brot gebacken zum Genuß in gesunden Tagen10, mit Honig gebraucht man ihn statt Sesam11. Er heißt Thylakitis (Өυλακίτις)12 und hat ein längliches Köpfchen mit weißen Samen13. Eine andere Art ist die wilde, welche auch ein längliches Köpfchen, aber schwarzen Samen hat, diese heißt auch Pithitis (πιθίτις)14, von einigen wird sie auch Rhoias (ῥοιάς) genannt, weil aus ihr der Milchsaft fließt15. Eine dritte Art ist wilder und arzneilich wichtiger, auch größer als jene mit einem länglichen Köpfchen16. — Von allen dreien ist eine Abkochung der Blätter und der Köpfchen ein Heilmittel gegen Schlaflosigkeit. Ein Präparat aus den Köpfen wirkt schmerzstillend. Einige zerstoßen die Köpfe samt den Blättern und pressen sie in der Presse aus, reiben den Saft dann im Mörser und formen ihn zu Pastillen. Ein solcher heißt Mekonion (μηκώνιον). Er ist schärfer als der (natürliche) Saft17. Diejenigen, welche diesen gewinnen wollen, müssen nach dem Abtrocknen des Taues das Sternchen mit einem Messer umziehen, so daß es nicht in das Innere eindringt und in gerade Richtung die Köpfchen an den Seiten oberflächlich anschneiden18, dann die heraustretenden Tränen mit dem Finger in eine Muschel streichen und nach nicht langer Zeit wieder dazu gehen, denn er findet sich verdickt und auch am folgenden Tage wird er ebenso gefunden. Dann muß man ihn in einem alten (?) Mörser kneten, in Pastillen formen und aufbewahren19.