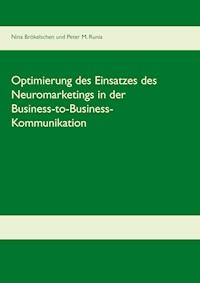
Optimierung des Einsatzes des Neuromarketings in der Business-to-Business-Kommunikation im deutschen Mobilfunkmarkt E-Book
Nina Brökelschen
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Marketing in Theorie und Praxis - Beiträge zur angewandten Marketingforschung und -konzeption
- Sprache: Deutsch
In Band 2 beschäftigen sich die Autoren mit der Thematik des Neuromarketings. Es wird der Fragestellung nachgegangen, ob die gewonnenen Erkenntnisse des Neuro-marketings auch auf den Bereich der Business-to-Business-Kommunikation anzuwen-den sind. Die praktische Relevanz wird exemplarisch an Kommunikationsmaßnahmen der deutschen Mobilfunkanbieter aufgezeigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort der Herausgeber
Mit der Schriftenreihe „Marketing in Theorie und Praxis – Beiträge zur angewandten Marketingforschung und -konzeption“ beleuchten die Herausgeber aktuelle Themenfelder und Forschungsgebiete aus der Marketingdisziplin. Entgegen aller Schlagworte und oft als Paradigmenwechsel titulierten Strömungen im Marketing stellen die Herausgeber das konzeptionelle Marketing im Sinne des Marketingprozesses in den Vordergrund der Diskussion.
Die in dieser Schriftenreihe erscheinenden Beiträge orientieren sich daher an dieser Grundlage. Der Marketingprozess mit seinen Phasen Marketinganalyse, Marketingziele, Marketingstrategien, Marketinginstrumente und Marketingkontrolle bietet eine solide Basis für Fragestellungen in allen institutionellen Bereichen des Marketing: Konsumgütermarketing, Industriegütermarketing, Dienstleistungsmarketing, Handelsmarketing und Non-Profit-Marketing. In der Bearbeitung der jeweiligen Aufgabenstellungen finden sich hier die theoretischen und praktischen Ansätze zur Problemlösung.
In Band 2 beschäftigen sich die Autoren mit der Thematik des Neuromarketings. Es wird der Fragestellung nachgegangen, ob die gewonnenen Erkenntnisse des Neuromarketings auch auf den Bereich der Business-to-Business-Kommunikation anzuwenden sind. Die praktische Relevanz wird exemplarisch an Kommunikationsmaßnahmen der deutschen Mobilfunkanbieter aufgezeigt.
im Oktober 2015
Peter M. Runia & Frank Wahl
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Methodik und Aufbau
2 Grundlagen der Neurowissenschaft
2.1 Biologische Grundlagen
2.1.1 Aufbau des Gehirns
2.1.2 Neurologisch relevante Funktionsweisen des Gehirns
2.2 Technische Grundlagen
2.2.1 Messverfahren von elektrischen Gehirnaktivitäten
2.2.2 Messverfahren von Stoffwechselaktivitäten im Gehirn
3 Theoretische Grundlagen des Neuromarketings
3.1 Entstehung und Begriff
3.2 Einordnung in den wissenschaftlichen Kontext
3.3 Chancen
3.4 Grenzen
4 Modelle des Neuromarketings
4.1 Einfluss des Unbewussten
4.1.1 Autopilot
4.1.2 Pilot
4.2 Motive und Emotionen
4.2.1 Limbic
®
Map
4.2.2 Limbic
®
Types
4.3 Codes
4.3.1 Sprache
4.3.2 Geschichten
4.3.3 Symbole
4.3.4 Sensorik
5 Theoretische Grundlagen der B-to-B-Kommunikation
5.1 Definition
5.2 Abgrenzung und Besonderheiten des Begriffs
5.3 Zielgruppen
5.4 Ausgewählte Kommunikationsinstrumente
6 Mobilfunkmarkt
6.1 Marktstruktur
6.2 Anbieterstruktur
6.3 Kundenstruktur
6.4 E-Plus Mobilfunk GmbH
6.4.1 Entwicklung der E-Plus Mobilfunk GmbH
6.4.2 Einordnung des Unternehmens
6.4.3 Marke BASE Professional
7 Neuromarketing in der B-to-B-Kommunikation auf dem Mobilfunkmarkt
7.1 Limbic
®
Map und Limbic
®
Types im B-to-B-Bereich
7.2 Dreistufige Neuromarketinganalyse
7.3 Analyse Fachzeitschriftenanzeige BASE Professional
7.3.1 Motivanalyse
7.3.2 Codeanalyse
7.3.3 Limbic
®
Type Analyse
7.4 Analyse Fachzeitschriftenanzeigen O
2
Professional
7.4.1 Motivanalyse
7.4.2 Codeanalyse
7.4.3 Limbic
®
Type Analyse
7.5 Zwischenfazit
8 Handlungsempfehlungen
8.1 Motive und Emotionen
8.2 Codes
8.3 Limbic
®
Types
9 Fazit
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abb.
Abbildung
AG
Aktiengesellschaft
AIDA-Modell
Attention-Interest-Desire-Aktion-Modell
BCM
Brand Code Management
Bio.
Billionen
bspw.
beispielsweise
B-to-B
Business-to-Business
B-to-C
Business-to-Consumer
ca.
circa
Co.
Compagnie
DVZ
Deutsche Verkehrs-Zeitung
e.V.
eingetragener Verein
ebd.
ebenda
EEG
Elektroenzephalografie
EHI
Wissenschaftliches Institut des Handels
et al.
et alii
etc.
et cetera
f.
folgende
ff.
fortfolgende
fMRT
funktionelle Magnetresonanztomografie
GmbH
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GSM
Global System for Mobile Communication
Hrsg.
Herausgeber
i. e. S.
im engeren Sinne
i. w. S.
im weiteren Sinne
IMK
Institut für Marketing und Kommunikation
IOT
Internet of Things
Jg.
Jahrgang
KG
Kommanditgesesellschaft
LNCS
Lecture Notes in Computer Science
MEG
Magnetenzephalografie
Mio.
Million
Mrd.
Milliarde
M-to-M
Machine-to-Machine
NMSBA
Neuromarketing Science and Business Association
No.
Numero
Nr.
Nummer
o. V.
ohne Verfasser
OHG
Offene Handelsgesellschaft
PET
Positronenemissionstomografie
Q
Quartal
s.
siehe
S.
Seite
S.A.
Sociedad Anónima
SIM-Karte
Subscriber Identity Module-Karte
SME
Small and Medium-sized Enterprises
sog.
sogenannte
SoHo
Small Office, Home Office
S-O-R-Modell
Stimulus-Organismus-Response-Modell
Vgl.
vergleiche
Vol.
Volume
ZAW
Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V.
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Anatomische Unterteilung des menschlichen Gehirns
Abbildung 2: Limbisches System
Abbildung 3: Einordnung des Neuromarketings in die Wissenschaft
Abbildung 4: System des Piloten und Autopiloten
Abbildung 5: Limbic® Map
Abbildung 6: Limbic® Types: Verteilung in Deutschland
Abbildung 7: Vier Codes: Zugänge zum Kundengehirn
Abbildung 8: Fünf Sinne des Menschen
Abbildung 9: Teilnehmer-Marktanteile der Mobilfunkanbieter
Abbildung 10: Strategie „ONE“ von Vodafone
Abbildung 11: Limbic® Map für den B-to-B-Bereich
Abbildung 12: Vier B-to-B Limbic® Types
Abbildung 13: Dreistufige Neuromarketinganalyse
Abbildung 14: Fachzeitschriftenanzeige BASE Professional
Abbildung 15: Motivraum BASE Professional
Abbildung 16: Limbic® Types Soll-Zielgruppe BASE Professional
Abbildung 17: Limbic® Types Ist-Zielgruppe BASE Professional
Abbildung 18: Fachzeitschriftenanzeige O2 Professional
Abbildung 19: Motivraum O2 Professional
Abbildung 20: Limbic® Types Soll-Zielgruppe O2 Professional
Abbildung 21: Limbic® Types Ist-Zielgruppe O2 Professional
Abbildung 22: Optimierte Fachzeitschriftenanzeige BASE Professional
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Vergleich der Verfahren zur Messung von elektrischen Gehirnaktivitäten
Tabelle 2: Vergleich der Verfahren zur Messung von Stoffwechselaktivitäten im Gehirn
Tabelle 3: Einflussfaktoren auf Kaufentscheidungen
Tabelle 4: Kaufverhalten der Limbic® Types
Tabelle 5: Besonderheiten der B-to-B-Kommunikation
Tabelle 6: Zusatzleistungen der E-Plus Mobilfunk GmbH
1 Einleitung
Laut einer Studie des IMK aus dem Jahr 2004 sind Konsumenten täglich mehr als 6.000 Werbebotschaften ausgesetzt1. Weiter verdeutlicht wird die Thematik des „Information Overload“ anhand der folgenden Zahlen:
Im Jahr 2012 wurden national rund 60.000 neue Marken eingetragen
2
.
Konsumenten konnten 2011 zwischen durchschnittlich 25.000 Artikeln in einem Supermarkt wählen
3
.
Bis zum 01.01.2013 wurden über 15 Mio. Internetseiten mit der Domain „.de“ registriert
4
.
Ca. 3,6 Mio. Werbespots wurden 2011 im deutschen Fernsehen ausgestrahlt
5
. Diese Zahlen zeigen, dass täglich viele Produktinformationen auf Konsumenten einwirken.
1.1 Problemstellung
Der wachsenden Zahl an Informationen steht die unveränderte Verarbeitungskapazität der Konsumenten gegenüber. So werden maximal 2 Prozent aller aufgenommenen Informationen bewusst wahrgenommen6. Zudem empfinden Konsumenten die Produkte als immer austauschbarer, was Studien der Stiftung Warentest belegen. Dabei werden 85 Prozent der bewerteten Produkte als gleichwertig eingestuft7. Ergänzend zu diesen beiden Aspekten lässt sich eine erhöhte Floprate von Produktneueinführungen von mittlerweile 70 bis 90 Prozent feststellen, bei gleichzeitig steigenden Werbeausgaben8, 9. Diese Entwicklung ist auch für den Business-to-Business-Bereich (B-to-B) erkennbar10. Anhand dieser Zahlen wird ersichtlich, dass die klassische Marktforschung an ihre Grenzen stößt11. Es müssen neue Wege gefunden werden, um die Bedürfnisse der Konsumenten besser zu verstehen und dadurch befriedigen zu können. Einen möglichen Weg stellt das Neuromarketing dar, das aufgrund der dargelegten Problemstellung stark an Bedeutung gewonnen hat.
Diese geänderten Marktbedingungen zwingen auch die Mobilfunkanbieter zu einem Umdenken. Die gesättigte Marktlage12 zeigt sich u.a. daran, dass die Marktanteile der beiden größten Mobilfunkanbieter, die Telekom Deutschland GmbH und die Vodafone GmbH, nur 4 Prozent auseinander liegen13. Daher stellt sich die Frage, ob die Mobilfunkanbieter Neuromarketing in ihren Kommunikationskampagnen einsetzen sollten, um sich gegenüber den Wettbewerbsmarken zu differenzieren.
1.2 Zielsetzung
Ausgehend von der Problemstellung und der derzeitigen Marktsituation ist die Zielsetzung dieser Ausarbeitung, folgende handlungsleitende Frage zu beantworten:
Welche Empfehlungen lassen sich aus den Ergebnissen dieser beiden Fragestellungen für die wirkungsvollere Werbemittelgestaltung der E-Plus Marke BASE Professional ableiten? Um diese Frage beantworten zu können, müssen zuvor folgende offene Punkte geklärt werden:
Lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse des Neuromarketings auch auf den Bereich der Business-to-Business-Kommunikation anwenden? Werden die Methoden des Neuromarketings in der Kommunikation der deutschen Mobilfunkanbieter eingesetzt?
Insgesamt orientieren sich die Handlungsempfehlungen stark an der bestehenden Positionierung der Marke BASE Professional, um eine bessere Vergleichbarkeit des Veränderungsprozesses geben zu können.
1.3 Methodik und Aufbau
Die Ausarbeitung unterteilt sich in zwei Arbeitsschwerpunkte. Dabei dient das Kapitel 2 der Schaffung von theoretischen Grundlagen bezogen auf die biologische und technische Detailbetrachtung der Neurowissenschaft. Anschließend wird im Kapitel 3 näher auf die theoretischen Grundlagen des Neuromarketings eingegangen, was die Definition des Begriffs Neuromarketing, eine Einordnung sowie die Chancen und Grenzen des Neuromarketings beinhaltet. Daran angrenzend widmet sich Kapitel 4 den Modellen des Neuromarketings, wozu der Einfluss des Unbewussten, die Motive und Emotionen und die Codes gehören. Die Darstellung der theoretischen Grundlagen der B-to-B-Kommunikation bildet Kapitel 5, worin auf die Definition und Abgrenzung des Begriffs B-to-B sowie auf die spezielle Zielgruppe und Kommunikationsinstrumente dieses Bereichs eingegangen wird.
Der zweite Arbeitsschwerpunkt stellt den praktischen Teil der Ausarbeitung dar. Dazu wird der Mobilfunkmarkt vorgestellt, was die Markt-, Anbieter- und Nachfragerstruktur umfasst sowie die Unternehmensdarstellung der E-Plus Mobilfunk GmbH mit der Marke BASE Professional. Nachfolgend wird der Einsatz der vorgestellten Neuromarketingmodelle bei den deutschen Mobilfunkanbietern analysiert, um nach einem Zwischenfazit Handlungsempfehlungen für die Werbemittelgestaltung der E-Plus Marke BASE Professional zu geben. Den Abschluss bildet das Fazit im Kapitel 9 zu den eingangs gestellten handlungsleitenden Fragen.
1 Vgl. Handelsblatt (2004), o. S.
2 Vgl. Deutsches Patent- und Markenamt (2013), S. 2.
3 Vgl. EHI Retail Institute (2013), o. S.
4 Vgl. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2013), o. S.
5 Vgl. Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft e.V. (2011), o. S.
6 Vgl. Munziger/Musiol (2009), S. 21.
7 Vgl. Scheier/Held (2012a), S. 21.
8 Vgl. Hoffmann (2006), S. 62; Lindstrøm (2009), S. 30; Scheier/Held (2012a), S. 18.
9 Im Jahr 2012 betrugen die Bruttowerbeausgaben 26,2 Mrd. Euro. Das entspricht einer Steigerung von 0,9 Prozent im Vergleich zum Jahr 2011. Vgl. Bauer (2013), o. S.
10 Vgl. Backhaus/Voeth (2010), S. 207 f.; Masciadri/Zupanic (2010), S. 10.
11 Vgl. Raab et al. (2009), S. 14.
12 Darunter ist ein Markt zu verstehen, dessen Absatzvolumen erschöpft ist. Vgl. Meffert (2012), S. 54.
13 Vgl. Bundesnetzagentur (2013), o. S.
2 Grundlagen der Neurowissenschaft
Um ein besseres Verständnis für das Thema Neurowissenschaft14 zu erhalten, wird zunächst auf den Aufbau und die Funktionsweise des menschlichen Gehirns eingegangen. Diese beiden Aspekte spielen auch für das Neuromarketing eine bedeutende Rolle, wie später gezeigt wird.
2.1 Biologische Grundlagen
Das leistungsfähigste Organ und somit die Zentrale des menschlichen Körpers stellt das Gehirn dar15. Die Hauptaufgaben liegen dabei in der Informationsverarbeitung und -speicherung, der Steuerung der Gefühle und im Lernprozess16. Es besteht aus 100 Mrd. Nervenzellen17, die untereinander verknüpft sind. So entstehen insgesamt über 100 Bio. Kontaktpunkte18. Dieser Sachverhalt zeigt die hohe Komplexität des Gehirns.
2.1.1 Aufbau des Gehirns
Das menschliche Gehirn lässt sich in die folgenden vier Hauptbereiche unterteilen: Großhirn, Zwischenhirn, Stammhirn und Kleinhirn19. Alle vier Bestandteile sowie deren weitere Untergliederung sind in der Abbildung 1 dargestellt.
Das Stammhirn als ältester Bestandteil des menschlichen Gehirns ist verantwortlich für die lebenswichtigen Grundfunktionen. Dazu zählen z. B. die Atmung, das Herzkreislaufsystem, die Körpertemperatur, der Blutkreislauf, das Verdauungssystem und der Schlaf-Wach-Rhythmus20. Als weiterer Teil des Gehirns führt das Kleinhirn Informationen aus dem Rückenmark zusammen und steuert damit den menschlichen Bewegungsablauf. Darunter fällt neben der Koordination einzelner Bewegungen auch die Steuerung des Gleichgewichts sowie der Sprach- und der Augenmotorik21.
Abbildung 1: Anatomische Unterteilung des menschlichen Gehirns
In Anlehnung an: Derouiche (2011), S. 23 f.; Raab et al. (2009), S. 96-103; Roth (2003), S. 97206; Schandry (2003), S. 110-120; Schröger (2010), S. 82-85.
Allgemein lässt sich sagen, dass das Zwischenhirn für die komplexe Informationsverarbeitung zuständig ist22. Als größter Teil des Zwischenhirns ist der Thalamus zu identifizieren23. Dort werden mit Ausnahme des Riechens alle Sinneseindrücke aufgenommen, mit Inputs des zentralen Nervensystems verknüpft und an das Großhirn weitergeleitet24. Zudem werden hier die Eindrücke vorsortiert, weshalb der Thalamus auch das „Tor zum Bewusstsein“ genannt wird25. Das Großhirn, auch Neocortex genannt, ist evolutionsbiologisch gesehen ein junger Bestandteil des menschlichen Gehirns26. In diesem „Sitz des Bewusstseins“ werden alle Umwelteinflüsse erfasst und verarbeitet. Zusätzlich ist in diesem Bereich die Fähigkeit angesiedelt, reflektiert auf äußere Reize zu reagieren27. Das Großhirn unterteilt sich in die beiden Hemisphären, die Großhirnrinde und das Großhirnmark sowie das limbische System28, 29. Im Großhirnmark befinden sich die Basalganglien30, 31. Die Großhirnrinde32 gliedert sich weiter in den Isocortex und den Allocortex, der aus dem Riechhirn und dem Hippocampus besteht33, 34. Dieser lässt sich dem limbischen System zuordnen, wobei eine einheitliche Zuordnung des Hippocampus in der medizinischen Fachliteratur nicht stattfindet, da das Gehirn des Menschen bislang nicht vollständig erforscht ist. Weiter zählen zum limbischen System u. a. die Amygdala, die Mamillarkörper, der Gyrus Cinguli, der Fornix und der präfrontale Cortex35, 36.
Eine genaue Funktionsbeschreibung der einzelnen dieser komplexen und nicht gänzlich erforschten Bestandteile sprengt den Rahmen dieser Ausarbeitung. Die für das Neuromarketing wichtigen Funktionen werden im nächsten Abschnitt genauer betrachtet.
2.1.2 Neurologisch relevante Funktionsweisen des Gehirns
Für das Neuromarketing von Bedeutung ist die Funktionsweise der folgenden Bereiche: die beiden Hemisphären, das limbische System und der Nucleus Accumbens.
Seit den siebziger Jahren wurde angenommen, dass die rechte und linke Hemisphäre unterschiedliche Funktionen besitzen. Während die rechte Hälfte visuelle Stimuli in emotionale Denkweisen umsetzt, nimmt die linke Gehirnhälfte verbale Reize auf und ist somit für das logische und rationale Denken zuständig37. Diese Sichtweise gilt aktuell als überholt38. Laut Häusel39 übernimmt die rechte Hemisphäre die Aufgabe, in der Umwelt nach Regeln und Zusammenhängen zu suchen, Gesichter und Bilder zu verarbeiten sowie Mimik und Gestik des Gegenübers zu erkennen. Sie gilt als pessimistisch, warnt bei unbekannten Situationen und tritt somit bei Problemstellungen in Aktion40.
Die in der rechten Gehirnhälfte erkannten Regeln werden in der linken abgespeichert41. Dort findet demnach auch die Verarbeitung der Grammatik und Semantik statt. Sie treibt den Ehrgeiz an und lässt sich daher als optimistisch charakterisieren42. Lange Zeit wurde davon ausgegangen, dass das limbische System nur im Neocortex beheimatet ist. Der aktuelle Forschungsstand zeigt jedoch, dass daran Bestandteile des Neocortex, des Cortex und des Zwischenhirns beteiligt sind43.
Die Elemente des limbischen Systems wurden bereits unter dem vorangegangenen Punkt erläutert. An dieser Stelle sollen nur die für das Neuromarketing wichtigsten Vertreter näher beleuchtet werden. Die folgende Abbildung (Abbildung 2) zeigt eine Übersicht aller Bereiche des limbischen Systems.
Abbildung 2: Limbisches System
In Anlehnung an: Pispers/Dabrowski (2012), S. 69.
Laut Roth laufen im limbischen System alle Vorgänge ab, „die mit emotional-affektiven Zuständen in Verbindung mit Vorstellungen, Gedächtnisleistung, Bewertung, Auswahl und Steuerung von Handlungen zu tun haben und zwar unabhängig davon, ob diese … bewusst oder unbewusst ablaufen.“44. Somit ist dieser Teil für die Verarbeitung von Emotionen und die Entstehung von Kaufwünschen und -entscheidungen zuständig45. Als Zentrale des emotionalen Speichers spielt sich in der Amygdala (Mandelkern) das emotionale Lernen ab46. Die emotionalen Bewertungen der Amygdala werden vom Hypothalamus in körperliche Aktionen umgesetzt, wie bspw. durch die Freigabe von Hormonen, die den Herzschlag oder den Blutdruck erhöhen47. Zusätzlich sitzt hier die Steuerzentrale für die Vitalbedürfnisse48. Der Hippocampus ermöglicht eine räumliche Orientierung, organisiert das Wissensgedächtnis und entscheidet über den Neuigkeitsgrad einer Situation49. Zudem werden hier Objekte und Situationen mit Emotionen verbunden50. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der präfrontale Cortex, wobei nur die emotionale Einheit (orbifrontaler und ventromedialer präfrontaler Cortex) zum limbischen System gezählt wird. In diesem Bereich werden die durch die Amygdala bewerteten Reize korrigiert51. Durch die zweite Einheit (funktional-kognitiv) findet eine Verbindung zwischen der Emotion und der tatsächlichen Handlung statt52.
Zum limbischen System zählt auch der Nucleus Accumbens, der Sitz des Belohnungssystems53. Durch nicht erwartete positive Ereignisse wird ein Netzwerk im Gehirn aktiviert, das dadurch über Nervenzellen Dopamin ausschüttet. Dieses führt zur Freigabe von Opiaten, die den Menschen in den Zustand des Wohlbefindens versetzen. Die starke Aktivierung entsteht bspw. durch attraktive Gesichter, Geld oder Marken. Tritt eine Belohnung nicht ein, ergibt sich eine starke Deaktivierung des Belohnungssystems54. Dabei konnte bisher durch Messungen nur gezeigt werden, dass und wie stark das Belohnungszentrum in Aktion tritt, nicht aber wodurch es stimuliert wird55.
Die Ausführungen des Kapitels 2.1 zeigen, dass keiner der Bestandteile des menschlichen Gehirns getrennt voneinander betrachtet werden kann, da die Systeme durch die enge Verknüpfung einander bedingen. Weiter wurde verdeutlicht, dass das Gehirn aufgrund der Komplexität bisher nicht vollständig erforscht wurde.
2.2 Technische Grundlagen
In diesem Kapitel werden verschiedene Methoden der Hirnforschung sowie deren Vor-und Nachteile vorgestellt, die in der Neuromarketingliteratur am häufigsten erläutert werden. Generell findet ein Einsatz dieser Untersuchungsmethoden statt, um die Anatomie des Gehirns, die physiologischen Funktionen und Gehirnaktivitäten zu erforschen und das menschliche Verhalten zu analysieren56. Der Schwerpunkt dieses Abschnitts liegt dabei auf den bildgebenden Verfahren, d. h. dass die erhobenen Daten der Gehirnaktivitäten in Bilder umgewandelt werden57. Psychophysiologische Verfahren, wie bspw. die Hautwiderstandmessung oder die Blickaufzeichnung werden hier nicht weiter behandelt, da sie nur begleitend innerhalb von Neuromarketingstudien eingesetzt werden58.
2.2.1 Messverfahren von elektrischen Gehirnaktivitäten
Zu den Messverfahren von elektrischen Gehirnaktivitäten zählen die Elektroencephalografie (EEG) und die Magnetencephalografie (MEG). Die EEG misst die elektronischen Veränderungen im Gehirn anhand von Ionenströmen59. Dazu werden am Kopf der Versuchspersonen Elektroden angebracht, die die schwankende Spannung der Gehirnoberfläche erfassen60. Aufgrund der guten zeitlichen Auflösung ist eine genaue Aussage über die Reihenfolge der Aktivitäten möglich. Wegen der oberflächennahen Messung lassen sich jedoch die räumlichen Abläufe nur mäßig darstellen61. Weitere Vor- und Nachteile der EEG sowie der MEG werden in der Tabelle 1 aufgezählt.
Zusammenfassend lässt sich zu der Methode der EEG sagen, dass diese für die Beurteilung des Werts einer bspw. Werbeanzeige hilfreich ist, jedoch nicht ausreichend, um zu verstehen, welche kognitiven Prozesse für die Auslösung von Gehirnaktivitäten verantwortlich sind62.
Tabelle 1: Vergleich der Verfahren zur Messung von elektrischen Gehirnaktivitäten
In Anlehnung an: Kenning et al. (2007), S. 59; Morin (2011), S. 133 f.; Weber (2011), S. 45 ff.
Im Gegensatz zu der EEG erfasst die MEG magnetische Aktivitäten des Gehirns, die durch Vorgänge in Nervenzellen entstehen63 und durch 100 bis 300 Elektroden am Kopf der Probanden aufgezeichnet werden64. Das Verfahren besitzt genau wie die EEG eine hohe zeitliche Auflösung und ist bezogen auf die räumliche Darstellung besser als die EEG65. Trotzdem werden die Aktivitäten nur oberflächlich betrachtet, womit tiefer liegende Areale, wie bspw. das limbische System, nicht wiedergegeben werden können66. Entsprechend dieser Ausführungen und der Übersicht der Vor- und Nachteile aus der Tabelle 1 ist festzustellen, dass sich diese Verfahren dazu eignen, Experimente durchzuführen, in denen die zu aktivierenden Gehirnregionen bekannt sind. Ergebnisse von Untersuchungen, mit denen Aktivierungen unbekannter Areale erklärt werden sollen, lassen sich mit diesen Vorgängen nicht dokumentieren. Zudem können komplexe kognitive und emotionale Funktionen mit diesen Methoden nicht nachgewiesen werden67.
2.2.2 Messverfahren von Stoffwechselaktivitäten im Gehirn
Anders als bei den Messverfahren von elektrischen Gehirnaktivitäten, werden bei den in diesem Abschnitt vorgestellten Methoden – die funktionelle Magnetresonanztomografie (fMRT) und die Positronenemissionstomografie (PET) – die Veränderungen des Stoffwechsels aufgrund erhöhter Durchblutung und Sauerstoffbedarfs im menschlichen Gehirn gemessen68.
Die fMRT, als eine Weiterentwicklung der Magnetresonanztomografie, macht sich die Eigenschaft der unterschiedlichen magnetischen Felder des Blutes zu Nutze69. Da diese Methode in der Literatur als die klassische Forschungsmethode des Neuromarketings betitelt wird70, erfolgt an dieser Stelle eine genauere Betrachtungsweise. Aktivierte Gehirnbereiche haben einen erhöhten Bedarf an Sauerstoff und Glucose. Dieses Mehr an Sauerstoff wird durch die roten, eisenhaltigen Blutkörperchen zu dem entsprechenden Areal transportiert. Das durch das Eisen veränderte Magnetfeld dieser Region lässt sich dann im Tomografen erkennen71. Dabei werden die erhobenen Daten über ein Spezialprogramm in Abbildungen umgesetzt72





























