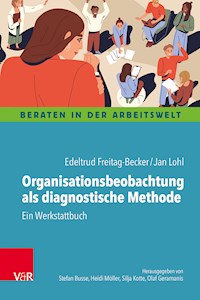
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Organisationsstruktur und -kultur erkennen, Prozesse einschätzen, Widerstände verstehen! Organisationsbeobachtung als psychoanalytisches Diagnoseinstrument kann sich auf die Arbeitsfähigkeit von Berater:innen positiv auswirken. Neben der vollständigen Darstellung der Geschichte und Theorie der Organisationsbeobachtung zeigen zahlreiche branchenübergreifende Praxisbeispiele das Potential dieses qualitativen Diagnoseinstruments für die Organisationsberatung. So lassen sich unbewusste und konflikthafte Dynamiken verstehen und mögliche Lösungsansätze entwickeln.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben vonStefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Edeltrud Freitag-Becker/Jan Lohl
Organisationsbeobachtung als diagnostische Methode
Ein Werkstattbuch
Vandenhoeck & Ruprecht
FürRose Redding Mersky undBurkhard Sievers
Mit 2 Abbildungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2022 Vandenhoeck & Ruprecht, Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen, ein Imprint der Brill-Gruppe
(Koninklijke Brill NV, Leiden, Niederlande; Brill USA Inc., Boston MA, USA; Brill Asia Pte Ltd, Singapore; Brill Deutschland GmbH, Paderborn, Deutschland; Brill Österreich GmbH, Wien, Österreich)
Koninklijke Brill NV umfasst die Imprints Brill, Brill Nijhoff, Brill Hotei, Brill Schöningh, Brill Fink, Brill mentis, Vandenhoeck & Ruprecht, Böhlau, V&R unipress.
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: GoodStudio/shutterstock.com Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-99403-1
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Einleitung
1Zur Entwicklung der Organisationsbeobachtung
2Organisationsbeobachtung – Überblick über die Methode
2.1Organisationen beobachten
2.2Von der Kunst die eigene Beobachtung zu verschriftlichen Das Protokollieren
2.3Reinszenierung der Organisation zwischen den Zeilen und in der Gruppe. Über die Auswertung und Elemente psychoanalytischen Verstehens
2.4Dem Metaphernstrang folgen. Rückmeldung an die Organisation
3Organisationsbeobachtungen in der Praxis
3.1Christiane Overkamp: Der Duft des Bioladens
3.2Florian Sebastian Ehlert: Wie der Vater, so der Sohn Organisationsbeobachtung in einer Stadtbibliothek
3.3Maria Sohr: Globuli zwischen Sterilität und Affekt Beobachtung in einem homöopathischen Labor
3.4Gerda Reiff: Das Klo in der Mitte – Beobachtungen in einem Architekturbüro
4Ausblick und Perspektive
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Berater/-innen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforscher/-innen, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mit gestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leser/-innen, die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe werden Themen bearbeiten, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So werden die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen nochmals offerieren und aufbereiten, sondern sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt bewegen. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und Schulen übergreifend, in der nicht einzelne Positionen prämiert werden, sondern zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene anregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Heidi Möller, Silja Kotte und Olaf Geramanis
Einleitung
Die Methode der Organisationsbeobachtung ist aus der Säuglingsforschung abgeleitet. Dort wurde u. a. von Daniel Stern (1985) mit Hilfe des »Baby Watching« ein Zugang zu emotionalen Prozessen des noch nicht sprachfähigen Säuglings eröffnet, die sich nicht beobachten, aber mit geeigneten Methoden erschließen lassen: hinsehen, hinhören, hin spüren. Dieser Zugang wurde von Robert D. Hinshelwood und Wilhelm Skogstadt (Hinshelwood u. Skogstadt, 2003, 2006) auf die Beobachtung von Organisationen übertragen und fördert Einsichten in unbewusste Prozesse, Konflikte und Widerstände. Wie diese die Kultur der Organisationen prägen und sich auf die Mitarbeitenden auswirken, lässt die Organisationsbeobachtung erahnen. Burkhard Sievers (2006) griff diesen Ansatz auf, machte ihn der deutschsprachigen Leserschaft zugänglich und entwickelte zusammen mit Rose Redding Mersky Weiterbildungsangebote für Supervisor:innen, Coaches und Organisationsberater:innen (vgl. zur Entwicklung der Methode Kapitel 2).
Die durch die Organisationsbeobachtung gewonnenen Einsichten sind für uns (Edeltrud Freitag-Becker und Jan Lohl) eine wertvolle Unterstützung des Verstehens organisationaler Dynamiken sowie eine Hilfe für die Gestaltung von Organisationsberatungsprozessen. Ab 2013 boten wir bei inscape (Institut für Fortbildung und Beratung, Köln) Weiterbildungen zur Organisationsbeobachtung an. Äußere Umstände (Sicherheitsmaßnahmen in öffentlichen Einrichtungen, veränderte Datenschutzregeln) und diverse gesellschaftliche Dynamiken (z. B. Beobachtung in einer beobachteten Welt) und unsere Arbeit mit der Methode veranlassten uns, das Basiskonzept von Hinshelwood und Skogstadt zu verändern. Wir wollten die Organisationen aktiver am Beobachtungsprozess beteiligen. Während Sievers Beobachtungen in öffentlichen Einrichtungen verdeckt durchgeführt hat, haben wir die Beobachtung mit den Verantwortlichen in Organisationen der Arbeitswelt abgesprochen und ein Feedbackgespräch als Teil der Organisationsbeobachtung mit kontraktiert. Die Organisationen sollten unsere Diagnose als Erkenntnisgewinn und für einen möglicherweise angedachten Veränderungsprozesses nutzen können. Zudem arbeiteten wir die Methode theoretisch aus und begründeten das Vorgehen methodologisch.
Neben dem kulturanalytischen Ansatz von Alfred Lorenzer beschäftigte uns das Konzept von Scharmer, der in seiner »Theorie U« verdeutlicht, dass Veränderungen in Zukunft nur vollzogen werden können, wenn sich eine veränderte Qualität der Wahrnehmung, des Denkens und Handelns entwickelt, die dem Sicht- und Unsichtbaren nebeneinander einen berechtigten Platz einräumt. Es bedarf »einer neuen Qualität von Bewusstsein und Aufmerksamkeit« (Scharmer, 2015, S. 229): Was sehe ich, wenn ich neu, genau und mit anderen Augen hinschaue? Auch Rosa (2016) stand uns mit seinem Resonanzkonzept Pate: Wenn Beschleunigung in vielen Organisationen zu Problemen führt, kann eine resonante Beobachtung dann die Lösung sein oder zumindest zu einer Lösung beitragen?
Die Konzeptveränderung warf Fragen auf: Würde die Transparenz über das Vorgehen zu Aufträgen an die Beobachter:innen führen? Können Distanz und Abstinenz weiterhin aufrecht gehalten werden? Welche Einladungen zu Interaktionen könnte dadurch signalisiert werden? Würde dieses Vorgehen den psychodynamischen Ansatz verwässern?
Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Umgang mit diversen Krisen, deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt und einem nicht zu überhörenden Ruf nach »schnellem Erfassen«, »raschen Lösungen« und »lückenloser Transparenz«, schien es uns wichtig, den Kontakt mit den Organisationen zu suchen und sie zu einem Prozess des Innehaltens einzuladen. Auch wenn davon auszugehen war, dass psychodynamische Perspektiven in der Arbeitswelt angekommen sind und Organisationsstrukturen einerseits und unbewusste Prozesse in Organisationen andererseits sich nicht mehr wie zwei Fremde gegenüberstehen, benötigten diese Prozesse doch eine Übersetzung: Berater:innen sind aufgefordert diese Übersetzungsleistung zu erbringen. Hier bietet die Organisationsbeobachtung eine gute Möglichkeit, anhand des Beobachteten in eine gemeinsame Reflexion der Organisationskultur und -dynamik einzusteigen.
Unser Dank gilt Burkard Sievers und Rose Mary Mersky, die uns an die Organisationsbeobachtung herangeführt haben und dem Beratungs- und Fortbildungsinstitut inscape in Köln, das uns die Möglichkeit gegeben hat, die Organisationsbeobachtung im Rahmen seiner Fortbildungsangebote (und uns) weiterzuentwickeln. Die Organisationsbeobachtung ist inzwischen fest in die Weiterbildung für Supervisor:innen am Institut verankert.
Bedanken möchten wir uns auch bei den Teilnehmer:innen der Fortbildungen, die ihre Organisationsbeobachtungen zur Verfügung stellten und so gemeinsames Lernen ermöglichten. Insbesondere danken wir Florian-Sebastian Ehlert, Christiane Overkamp, Gerda Reiff und Maria Sohr für die Veröffentlichung ihrer Beobachtungen.
1Zur Entwicklung der Organisationsbeobachtung
Aufmerksam wandert der Blick durch den Raum. »Ich sehe was, was Du nicht siehst und das ist blau!« Es ist ein altes Kinderspiel, das ohne Lust am Verbergen und am aufmerksamen Wahrnehmen, am Suchen und Finden nicht gut zu spielen ist. Der Eine sieht etwas – ein blaues Buch im Regal vielleicht – und die Andere lässt den Blick durch den Raum schweifen, um eben dieses Buch zu entdecken. Etwas wahrnehmen, das andere nicht wahrnehmen – noch nicht –, daran entzündet sich ein Teil der Freude, die mit diesem Spiel einhergeht.
Auch Psychoanalytiker:innen und psychoanalytisch geschulte Supervisor:innen haben im Laufe oft langer Ausbildungsprozesse Methoden erlernt, etwas wahrzunehmen, dass sich dem ersten und oft auch noch dem zweiten Blick ihren Patient:innen oder Klient:innen aber auch Gruppen und Organisationen entzieht: etwas Latentes, ein Affekt, ein noch nicht gedachter Gedanke oder ein Konflikt, wie bei einem Eisberg wo das unter der Wasseroberfläche liegende der unmittelbaren Wahrnehmung nicht zugänglich ist. Szenisch betrachtet, hinterlässt das Ungesehene und Unbewusste jedoch wirksame Spuren und es lohnt diese aufzuspüren.
In den Feldern, in denen die Psychoanalyse jenseits der Couch Anwendung gefunden hat, sind verschiedene Methoden des Aufspürens unbewusster Prozesse und Dynamiken entwickelt worden. Eine Methode, die für sich in Anspruch nimmt, eben diese Prozesse und Dynamiken in Organisationen zu diagnostizieren, ist die Organisationsbeobachtung.
In den 1980er und 1990er Jahren haben die britischen Psychoanalytiker Robert D. Hinshelwood (1987) und Wilhelm Skogstadt (2002) medizinische Einrichtungen des National Health Service aus einer psychoanalytischen Haltung heraus beobachtet.
Abb. 1 Das Verborgene des Eisbergs unter der Wasseroberfläche; Quelle: Inscape
Wie ist es dazu gekommen? Als Ausgangspunkt der Entwicklung dieser Methode nennen Skogstadt und Hinshelwood eine Gefühllosigkeit von Ärzt:innen in psychiatrischen Einrichtungen im Umgang mit Patient:innen: Diese wurden »oft wie eine Ansammlung von Organen und nicht wie leidende menschliche Wesen behandelt« (Hinshelwood u. Skogstadt, 2006, S. 17). Wie lässt sich dieses Phänomen verstehen?
Hinshelwood erzählt in einem Interview von seiner Beobachtung, dass sich das emotionale Verhältnis der Ärzt:innen zu ihren Patient:innen veränderte, wenn diese auf eine andere Station oder in ein anderes Team wechselten. Die Frage nach der Gefühllosigkeit von Ärzt:innen gegenüber ihren Patient:innen ließ sich also als sozialpsychologische Frage stellen. Sie schien weniger mit bestimmten Menschen und ihrer Persönlichkeit zu tun haben, sondern mit der Organisation und ihren (Sub-)Systemen, ihren Strukturen, Dynamiken und Kulturen, vor allem aber mit der beruflichen Sozialisation: Junge Ärzt:innen durchliefen im klinischen Alltag eine »typische Veränderung«. »Unter dem Druck der Arbeit, der psychiatrischen Kultur und der Struktur ihrer Laufbahn schienen ihre menschlichen Reaktionen gegenüber leidenden Patienten oft in fortschreitendem Maße gefühllos zu werden. »Ich kannte viele Trainees noch von der Zeit als sie Medizinstudenten waren und hatte oft den Eindruck, dass es die gefühlvollsten und menschlichsten unter ihnen waren, die sich entschlossen Psychiater zu werden. Aber am Ende ihrer langen Reise der Ausbildung schienen sie unempfindlich geworden zu sein.« (Hinshelwood u. Skogstadt, S. 17 f.)
Diese Einsicht gewannen Hinshelwood und Skogstadt, indem sie – zunächst unsystematisch – Situationen auf psychiatrischen Stationen beobachteten. Aus der methodischen und theoretischen Systematisierung dieser Beobachtungen heraus entwickelten beide ein Ausbildungsprojekt für angehende Ärzte und Ärztinnen, das es ermöglichte, eine Sensibilität für den organisationalen Kontext der eigenen beruflichen Rolle zu entwickeln.
Dieses Programm greift drei theoretische und methodische Aspekte auf:
1.Methodisch orientieren sich Hinshelwood und Skogstadt an ihren Erfahrungen aus sog. Leicester- oder Tavisstock-Konferenzen (Miller, 1989), in denen organisationale Dynamiken simuliert und diese durch die Teilnehmenden erforscht werden. Die Erfahrungen, die Hinshelwood und Skogstadt hierbei machten, sind deshalb besonders bedeutsam für die Entwicklung der Organisationsbeobachtung, weil sie mit der Erfahrung verbunden sind, dass Organisationen einen starken Einfluss auf das Fühlen, Handeln und Denken ihrer Mitglieder ausüben.
2.Hinshelwood und Skogstadt greifen Elemente ihrer eigenen psychoanalytischen Ausbildung auf, zu der die Beobachtung von Interaktionen zwischen Eltern und Babys gehört (vgl. Bick, 1964). Ein Vorbild für die Organisationsbeobachtung ist hierbei vor allem die Rolle der beobachtenden Person, die keine Verantwortung für die beobachtete Interaktion übernehmen soll, sondern als »nicht aktiver Beobachter« an der Eltern-Baby-Interaktion teilnimmt und die Aufgabe hat, eine emotionale Sensibilität für diese Interaktion zu entwickeln (Hinshelwood u. Skogstadt, 2006, S. 19). Diese Rolle ist zentral für die Methode der Organisationsbeobachtung.
3.Diese Einsicht freilich, sich mit Hilfe der Psychoanalyse Organisationen anzunähern, ist in den 1980er und 1990er Jahren nicht neu gewesen. Zu nennen ist hier vor allem der Group-Relations-Ansatz, der am Tavisstock-Institut of Human Relations ab den 1950er Jahren in London von Bion, Jaques, Menzies-Lyth und anderen entwickelt wurde (Kinzel, 2002, S. 190–320). Bahnbrechend war hierbei die Verbindung von psychoanalytischen Zugängen zu unbewussten Prozessen und Dynamiken mit systemischen Ansätzen über Rollen, Aufgaben und Führung.
Diese drei Elemente verbinden Hinshelwood und Skogstadt zu einem neuen psychoanalytischen Ansatz, um Organisationen im Gesundheitswesen empirisch zu beobachten. Als einen wissenschaftlichen Ansatz oder eine neue Forschungsaktivität begreifen sie die Organisationsbeobachtung jedoch zunächst nicht: Dass die Organisationsbeobachtung eine eigenständige Forschungsaktivität ist, wird beiden erst allmählich deutlich, so dass die Organisationsbeobachtung in ihren Anfängen als ein Ausbildungsprogramm zu verstehen ist, dass auf organisationale Selbsterfahrung von jungen Mediziner:innen zielt.





























