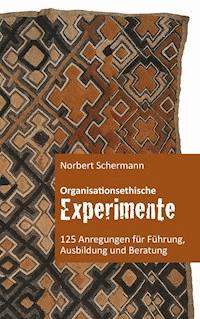
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Organisationsethischen Experimente wurden zur Unterstützung in der selbständigen oder angeleiteten Reflexion ethisch bedeutsamer Fragestellungen entwickelt und können von daher vielfältig eingesetzt werden wie etwa: -Zur Selbstreflexion als Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder Führungskraft im Unternehmen, in der Organisation oder in der öffentlichen Verwaltung -Als Anregung für ein Gespräch oder eine Diskussion im Team oder im Freundeskreis -In Ausbildung und Beratung (Coaching oder Supervision) als Impuls am Beginn, während oder am Ende einer Sequenz.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 126
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Ich halte es für sicher wichtig, daß man all dem Geschwätz über Ethik – ob es eine Erkenntnis gebe, ob es Werte gebe, ob sich das Gute definieren lasse etc. – ein Ende macht.“
(Ludwig Wittgenstein)
„Die Ethik hat nie recht begriffen, dass es zu ihren Aufgaben gehören könnte, vor der Moral zu warnen.“
(Niklas Luhmann)
Inhalt
Anstatt eines Vorwortes
Organisationen, Ethik und Experimente
Wovon wir sprechen, wenn wir von Organisation sprechen
Wovon wir sprechen, wenn wir von Organisationsethik sprechen
Wovon wir sprechen, wenn wir von Experimenten sprechen
125 Organisationsethische Experimente
SYSTEME BEOBACHTEN
INTERAGIEREN
EINSTELLEN&UMSTELLEN
ENTSCHEIDEND STEUERN
SELBST BEOBACHTEN
VIER FRAGEBÖGEN (#122-#125)
Regelverletzung
Liebesbeziehungen
Macht
Ängste und Befürchtungen
Literatur
Anstatt eines Vorwortes: Eine Leseanleitung.
Dieses Buch verschafft ihnen Zeit.
Die organisationsethischen Experimente, die hier versammelt sind, dienen dem Unterbrechen der Alltags- und Denkroutinen. Deshalb sind die wenigsten darauf ausgelegt, im Vorbeigehen gelesen oder schnell einmal durchprobiert zu werden. Sie sind sehr kompakt formuliert, enthalten oft viel theoretisches Hintergrundwissen und fordern auch immer wieder auf, sich dafür Zeit zu nehmen. Manche benötigen einige Vorarbeit, manche einige Zeit für die Durchführung. Viele Experimente setzen einen Impuls, der lange Zeit nachwirken kann und andere sind gemacht, um daran zu scheitern. Nicht jedes Experiment ist für jede Person vermutlich gleichermaßen zugänglich. Vielleicht versuchen sie, sich beim Durchblättern des Buches von einem Experiment wie zufällig finden zu lassen anstatt nach einem bestimmten zu suchen. Gleichzeitig ist das Buch für jene, die gezielt suchen wollen systematisch in mehrere Kapiteln eingeteilt. Grundsätzlich gilt jedoch: Man muss sich die Experimente durchaus erarbeiten.
Einige Möglichkeiten, wie sie mit den Experimenten umgehen können: Lassen sie sich das eine oder andere Experiment von jemandem vorlesen oder lesen, besprechen und bearbeiten sie das eine oder andere gemeinsam. Gehen sie durchaus kreativ damit um. Übrigens wird die Perspektive, aus der ein Experiment durchgeführt wird, mit jedem Versuch neu entschieden. Begeben sie sich doch auch in die Sichtweise anderer Personen und lassen sie sich von den Erkenntnissen überraschen!
Sie können die hier enthaltenen Texte kopieren und weitergeben, was – bitte mit Angabe der Quelle – ausdrücklich erwünscht ist. Sie können diese einfach an ihrem Arbeitsplatz herumliegen lassen oder im öffentlichen Raum platzieren. Vielleicht entwickeln sie sogar ihre eigenen Experimente?
Stellen sie sich vor, dass ihnen jemand, dem sie in einer bestimmten Frage vielleicht näher oder etwas weiter entfernt stehen, den jeweiligen Text mit ihrer, seiner Stimme vorliest. Hören sie sich die Anleitung dann auf eine zweite Art an, wenn sie diese bewusst mit ihrer eigenen Stimme lesen. Wie hört und fühlt sich ein Experiment an, wenn es von einer Kinderstimme vorgelesen wird im Vergleich zu einer Stimme, die sie von ihrer schulischen oder beruflichen Ausbildung her kennen? Wie hört es sich an und was verändert sich, wenn es von ihrer, ihrem Vorgesetzten oder einer Kollegin gelesen wird?
Das gedankliche Hören verschiedenster Sprachmelodien ist übrigens eine jener vielen Fähigkeiten, über die wir verfügen, ohne dass sich unsere Aufmerksamkeit permanent darauf richten müsste. Aus dieser Perspektive betrachtet, verbringen wir den größeren Teil unseres Lebens mit unseren inneren Monologen, sei es dass wir in unsere(n) eigenen Gedanken versunken sind, sei es dass wir gedanklich die Kommentare unserer Umgebung kommentieren.
Die vorliegenden Experimente wollen sie anregen, solche Gedanken auch nach außen hin zur Sprache zu bringen.
(1) Organisationen, Ethik und Experimente
Modernes Leben spielt sich in Organisationen ab. Wir alle werden von der Wiege bis zur Bahre durchorganisiert und haben es permanent mit Organisationen zu tun. „Ich muss mir das noch schnell organisieren!“ ist ein Stehsatz aus unserer Alltagssprache, der so etwas wie Machbarkeit und Berechenbarkeit suggeriert. Organisation – darunter stellt man sich etwas Größeres, Geordnetes und ein Gebilde vor, das etwas verlässlich ermöglicht oder erzeugt. Wenn wir irgendwie davon betroffen sind, nehmen wir jeweils eine von zwei möglichen Positionen ein: Jene als Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, als Repräsentantin, Repräsentant der jeweiligen Organisation (des Unternehmens, des Vereins usw.) oder jene als Kundinnen, Kunden im weitesten Sinn. Diesen Positionen können wir nicht entgehen.
Je nachdem erzeugen und verkaufen wir etwas, stellen Waren oder Dienstleistungen bereit, sorgen für jemanden oder etwas oder wir erwerben etwas, bewerben uns um etwas, nehmen eine Dienstleistung in Anspruch, liefern etwas oder werden zu Zielgruppen gemacht. Der Prozess des Organisierens, wie der Sozialpsychologe und Organisationsforscher Karl Weick zu sagen pflegt, hat beinahe alle Bereiche des Lebens erfasst und reicht damit immer mehr ins Private hinein. Dies wird dann deutlich, wenn man sich vor Augen führt, dass die Versuche von Geheimdiensten eine weltweit möglichst lückenlose Datenerfassung zu betreiben, Kennzeichen klassischer Organisation aufweisen. Sich entziehen zu wollen gleicht dem Versuch, sich als schwarzer Schwan mitten unter den weißen Schwänen zu verstecken.
Organisationen sind Ausdruck der vielfältigen Arbeitseilung von Funktionen einer Gesellschaft, die zu ihrem Erhalt beitragen. Die Gesellschaft hat sich derart ausdifferenziert und tut das noch weiter, dass man durchaus behaupten kann, der Organisationsgrad einer Gesellschaft sei direkt an das Ausmaß ihrer Unüberschaubarkeit gebunden. Auf diese Weise entsteht eine Vielfalt von unterschiedlichen und teilweise gegensätzlichen Perspektiven, mit denen der Verlust von Eindeutigkeit (falls es so etwas jemals gegeben hat) einhergeht. Der Soziologe Armin Nassehi nennt das Perspektivendifferenz. Kurz gesagt: Gesellschaften werden nicht mehr über gemeinsam geteilte Grundsätze für das Handeln, über Moral, integriert. Im Zuge dieser Einsicht erodieren auch unsere klassischen Vorstellungen von Organisationen, wonach diese berechenbar seien, wie Maschinen funktionierten und in denen die „richtigen“ anstatt „falscher“ Entscheidungen getroffen würden, um die angepeilten Ziele zu erreichen.
Organisationsethik thematisiert diese Perspektivendifferenz im Kontext von Organisationen. Deshalb ist es entscheidend, wie wir Organisationen betrachten und wie wir in diesem Zusammenhang das betrachten, was gemeinhin unter Ethik verstanden wird. Denn die Funktionsweisen von Organisationen sind im Prinzip die gleichen, egal ob sie Prozesse des Tötens oder Kindergeburtstage organisieren. Organisationsethisches Denken wie es für dieses Buch die Grundlage bildet, nimmt daher drei Schlüsselbegriffe in den Blick, die zugleich die wesentlichen Aspekte des Buchtitels darstellen: Organisation, Ethik (kombiniert als Organisationsethik) und den Begriff des Experiments.
Wovon wir sprechen, wenn wir von Organisation sprechen – oder: Das Organisieren organisieren
Die ursprünglich griechische und lateinische Bedeutung von Organon bzw. Organum bezeichnete allgemein ein Werkzeug. Daraus trat dann der Begriff Organ im Sinne eines Teiles eines lebendigen Ganzen, hervor und führte zum Begriff des Organismus als selbständiges Lebewesen oder als einheitlich gegliedertes Ganzes1.
Den modernen Begriff der Organisation verdanken wir indirekt der Französischen Revolution, in deren Kontext die Bedeutung vom körperlichen und seelischen Zustand des Menschen auf staatliche Einrichtungen, wirtschaftliche und politische Gebilde übertragen wurde. Später kam zum Organisationsbegriff noch die Bedeutung der systematischen Vorbereitung zusammenwirkender Abläufe bzw. Arbeitsprozesse hinzu, um schließlich im 20. Jahrhundert damit auch den einheitlichen Zusammenschluss von Personen als Verband oder als Partei als Organisationen zu bezeichnen.
Die Etymologie des Organisationsbegriffes zeigt, dass hier zwei Perspektiven verbunden wurden, nämlich die des einzelnen Menschen und die des Zusammenwirkens von Menschen. Diese doppelte Aufladung lässt unterschiedliche Blicke zu, worauf sich unsere Aufmerksamkeit richtet, wenn wir an Organisation denken: Auf die jeweils einzelnen oder auf den Zusammenschluss dieser Personen. Darin spiegeln sich auch die vielfältigen Ansätze in der organisationstheoretischen Diskussion wider.
Wir alle kennen Organisationen in Gestalt von produzierenden Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Sozialen Organisationen, Krankenhäusern, Medienunternehmen, Universitäten, Schulen, dem Wiener Prater, Banken, der Katholischen Kirche, Bundesministerien und deren nachgelagerte Verwaltungen und so weiter. Viele von ihnen bestehen seit geraumer Zeit und das, obwohl die Menschen, die für diese Organisationen arbeiten, immer wieder ausgewechselt werden. Organisationen überdauern die Lebensspanne einzelner Menschen. Dennoch bleiben sie bestehen und brechen nicht zusammen, wenn manche sie verlassen und andere hinzukommen.
Eine wesentliche Betrachtungsweise sogenannter systemischer Annahmen nimmt daher im Zusammenhang mit Organisationen (oder Teilen von ihnen wie z.B. Teams) weniger die einzelnen Personen in den Blick, als vielmehr die Beziehungen, die zwischen ihnen dadurch entstehen, dass sie ihre jeweiligen Aufgaben verrichten. Damit rücken die funktions- und tätigkeitsbezogene Kommunikation bzw. die Tätigkeiten selbst in den Blickpunkt. Natürlich sind damit die Menschen nicht ausgeschlossen, sondern sie werden in dieser Betrachtungsweise zu denjenigen, die die Organisation gleichsam bedienen. So könnte man sie im engeren Sinn als Teil der Umgebung der Organisation und zugleich als Schnittstelle in alle anderen Bereiche der Gesellschaft betrachten. Denn niemand richtet – hoffentlich – 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr die eigene Aufmerksamkeit ausschließlich auf die Organisation, für die er oder sie tätig ist.
Einige typische Kennzeichen dieser besonderen Betrachtungsweise Sozialer Systeme beschreiben wir kurz etwas näher. Erstens verfolgen Organisationen einen bestimmten Hauptzweck, in dem sich deren Sinn erschließt (etwas herstellen, bestimmte Dienstleistungen anbieten, für ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen eintreten…). Damit unterscheiden sie sich jedoch von allen anderen gleichartigen Organisationen, Unternehmen, Verwaltungen, die als Mitbewerber damit zu Teilen ihrer Umwelten werden, die für sie je nach Branche besonders bedeutsam sind (zu denen natürlich auch etwa Kundinnen, Kunden, Geldgeber, Lieferanten,…gehören). Vor dem Hauptzweck steht jedoch die Entscheidung für diesen, also die Entscheidung gegen alle anderen Optionen. Was so trivial klingt, macht jedoch einen weiteren zentral wichtigen Wesenszug einer Organisation aus, nämlich, dass sie über ihren jeweiligen Rahmen (Ausrichtung, Struktur, Mitteleinsatz…) autonom entscheiden kann und muss. So konnte der Begründer der modernen Systemtheorie, Niklas Luhmann, behaupten, dass Organisationen Entscheidungen sind, die aus Entscheidungen bestehen (die aus Entscheidungen bestehen).
Zweitens basieren Organisationen in hohem Maße darauf, als wiederkehrende Prozesse zu funktionieren. Sie weisen nach innen die Affinität auf, das meiste von dem, was getan wird, an Routinen, also an wiederholbaren Vorgehensweisen (Arbeitsprozessen) auszurichten. Denn nur so kann effizient und effektiv gearbeitet und daher als Organisation überlebt werden. Was einmal festgelegt wurde, ist zu stabilisieren, also möglichst unveränderbar zu halten. Denn die jeweils aktuelle Dienstleistung, die erbracht wird, die jeweils aktuellen Produkte, die auf dem Markt angeboten werden, müssen immer wieder in gleicher Weise erbracht werden, damit sie verkauft werden können. Informations-, Kommunikations-, Planungs- und Entscheidungsprozesse werden sinnvoller Weise standardisiert. Dazu haben Organisationen Funktionen zu vergeben, die (mehr oder weniger deutlich) schriftlich festgelegt sind und deren Zusammenwirken in mehr oder weniger genau geregelten, zumeist hierarchisierten Beziehungen stehen, weil alle Funktionen im Fall des Falles zu Steuerungszwecken schnell erreichbar sein müssen.
Drittens benötigen sie dafür einigermaßen berechenbare Personen, die diese Funktionen mit einer gewissen Verbindlichkeit (gegen Bezahlung und aus bestimmten weiteren Motiven heraus) ausüben. Diese Verbindlichkeit wird über Mitgliedschaft hergestellt. In der Regel durch Arbeitsverträge, in denen die wesentlichsten rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen (Funktion, Rechte, Pflichten, Bezahlung…) festgelegt sind. Ehrenamtlich wahrgenommene Funktionen werden zumindest in losen Absprachen vertragsähnlich vereinbart. Durch die so geregelte Mitgliedschaft verzichten die Personen auf Teile ihre Rechte (z.B. freie Meinungsäußerung), die ihnen gesellschaftlich ansonsten zustehen. Die Organisation wird damit zu einer spezifischen Form der Kommunikation und des Zusammenwirkens ihrer Mitglieder unabhängig davon, ob alle gleichzeitig anwesend sind. Auch dadurch wird eine Grenze zu ihren Umwelten hergestellt.
Viertens ergeben sich damit einige minimale ergänzende Perspektiven auf Organisationen: So ist es lange nicht gesagt, dass sich der Sinn des Unternehmens, das was als Werte hochgehalten wird, auch mit dem vollständig kompatibel sein muss, was die einzelnen Personen für wichtig und wertvoll erachten.
Die tagtäglich erlebte Hierarchie in der Organisation als Über- und Unterordnung bildet manchmal eine Kontrasterfahrung zu einer demokratisierten Gesellschaft, in der Freiheit oder Individualität hohe Werte darstellen. Die Grenze einer Organisation wird immer wieder als zu durchlässig erlebt, wenn Gesetzgeber oder Geldgeber mit ihren Vorgaben oder Shareholder mit ihren Forderungen massiven Einfluss auf die inneren Gestaltungsmöglichkeiten nehmen.
Dazu kommt mit der jeweiligen Organisationskultur jenseits der herausgeputzten nach außen gezeigten Oberfläche, alles das, was im Arbeitsalltag als normal oder selbstverständlich angenommen wird, ohne dass es weiter auffällt. In jeder Organisation werden, so Karl Weick, Übereinkünfte darüber getroffen, was als Wirklichkeit und was als Illusion zu gelten hat. Die als selbstredend geltende Voraussetzung, dass in einer Organisation aufgestellte Regeln, welche die wichtigsten Routinen sichern sollen, auch tatsächlich immer befolgt werden, erweist sich eher als frommer Wunsch, denn als ein empirisch gesichertes Faktum.
Über diese Betrachtungsweisen wird letztlich auch deutlich, dass die Personen immer nur mit einem begrenzten Ausschnitt ihres Lebens in der Organisation vertreten sind. Jeder Mensch verfügt über eigene, unverwechselbare Merkmale, die ihn oder sie von allen anderen unterscheiden. Dazu zählen insbesondere die eigenen Einstellungen, Wertesets und Ziele, wie sie mit Konfliktsituationen umzugehen gelernt haben oder welchen Stellenwert die regelmäßige Reflexion einnimmt. Mit diesen Unterschiedlichkeiten wird die Organisation zugleich durch die für sie tätigen Personen in ihre jeweiligen gesellschaftlichen Umwelten eingebettet (wie der Systemtheoretiker Dirk Baecker Diversität versteht) – oder mit dem Komplexitätsforscher Günter Ortmann gesprochen: „In Organisationen tobt das Leben!“
Zum Weiterlesen:
Baecker, Dirk (1999): Organisation als System. Suhrkamp
Kühl, Stefan (2014): Ganz normale Organisationen. Suhrkamp
Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Suhrkamp
Luhmann, Niklas (2000): Organisation und Entscheidung. Westdeutscher Verlag
Nassehi, Armin (2010): Mit dem Taxi durch die Gesellschaft. Soziologische Storys. Murmann
Ortmann, Günther (2003): Regel und Ausnahme. Paradoxien sozialer Ordnung. Suhrkamp
Ortmann, Günther (2004): Als Ob. Fiktionen und Organisationen. VS Verlag
Weick, Karl (1985): Der Prozess des Organisierens. Suhrkamp
1 Alle folgenden etymologischen Bemerkungen aus: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, dtv
Wovon wir sprechen, wenn wir von Organisationsethik sprechen – oder: Vor der Moral warnen
Ein kurzer Blick in die Etymologien von Moral und Ethik zeigt ebenfalls Interessantes: Das lateinische mos bezeichnet den „zur Regel gewordenen Willen“ oder auch eine „auf innerer Gesinnung beruhende gewohnheitsmäßige Tätigkeit“. Der Plural mores bedeutet „Anstand, Benehmen, Lebensart“. Moral bezeichnete ab dem 18. Jahrhundert das „gesellschaftlich bedingte System geltender Normen und Regeln sittlichen Verhaltens“.
Ethos bezeichnet im Griechischen, ausgehend von den Bedeutungen als Wohnort oder gewöhnlicher Aufenthalt, die sittliche Haltung des Menschen, die sein Handeln bestimmende Gesinnung, was mit Begriffen wie Charakter, Wesensart oder Gewohnheit einherging. Ethik wurde als „philosophische Lehre vom Sittlichen, vom moralischen Bewusstsein und Verhalten der Menschen“ oder auch „als Triebkraft für das eigene Handeln akzeptierte Moralnormen der Mitglieder einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe“ definiert. Ähnlich wie bei der Begriffsentwicklung der Organisation zeigt sich auch hier die Ausweitung des ursprünglichen Bezuges der Begriffe Moral und Ethik von der Einzelperson auf das Soziale System insgesamt.
Natürlich sind mit diesen kurzen Bemerkungen die vielschichtigen über Jahrtausende andauernden Ethikdiskurse nur gestreift – intensiver daran Interessierte finden am Ende des Kapitels entsprechende Literaturhinweise. Wir wenden uns in weiterer Folge dem sehr pointierten Zugang zu Ethik und Moral zu, den Niklas Luhmann im Rahmen seiner soziologischen Systemtheorie entwickelte. Er definierte Moral als Kommunikation über Achtungsbedingungen und Ethik als die Reflexionstheorie der Moral. Zudem sei es Aufgabe der Ethik vor der Moral zu warnen. So einfach diese Sätze klingen mögen, so unverständlich mögen sie sein. Dazu braucht es einige Erläuterung. Die oben kursiv gesetzten Begriffe werden zur Verdeutlichung nachfolgend kurz umrissen.
Kommunikation meint einerseits die alltagssprachliche Bedeutung der vielfältigen Formen gegenseitiger Verständigung und andererseits die damit verbundenen Handlungen von Personen. Im Begriff der Achtungsbedingungen sind zwei Perspektiven (Achtung und Bedingung) miteinander verschränkt, die in vielen wissenschaftlichen Diskursen die fachsprachliche Grundlage bilden. So wurden Achtung und Bedingung zu Schlüsselbegriffen im philosophischen Denken, die etwa auch in das naturwissenschaftliche Denken Eingang gefunden haben. Achtung wurde von Immanuel Kant im 18. Jahrhundert als moralisches Gefühl im Sinne einer respektvollen Haltung anderen gegenüber in den philosophischen Diskurs aufgenommen. In etymologischer Sichtweise zeigt sich Achtung als vielschichtiger Begriff, der ein Bedeutungsspektrum von „beachten, Aufmerksamkeit, Wertschätzung, Ansehen, wachsam sein, behutsam sein, berücksichtigen, erwägen“ umfasst. Für den Zusammenhang mit Organisation, so wie er im vorhergehenden Abschnitt dargestellt wurde, treten die Begriffe Aufmerksamkeit und





























