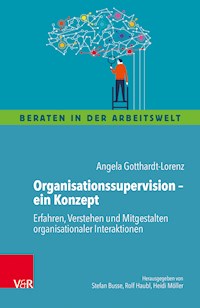
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Vandenhoeck & Ruprecht
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Beraten in der Arbeitswelt
- Sprache: Deutsch
Organisationssupervision bezieht sich auf organisationale Interaktionen und ist selbst zeitweise Teil von ihr. Welche aktuelle Bedeutung dieser Interaktionen in der Arbeitswelt haben – sowohl im Rahmen von adressatenbezogener Arbeit als auch im Bereich organisationaler Koordination – zeigt Angela Gotthardt-Lorenz auf Basis von Systematiken und Forschungen der neueren Arbeitssoziologie. Organisationssupervision basiert auf einer konzeptionellen Rahmung, die den Strukturen, Dynamiken und Aufgaben in Organisationen Rechnung trägt. Die Entwicklung und Begleitung von Supervisionsprojekten ist getragen durch den Anspruch, professionelles Handeln und menschenwürdige Arbeit zu unterstützen und die Supervision selbst einem fortlaufenden Reflexionsprozess zu unterziehen. In den damit gegebenen Spannungsfeldern liefert das Rollengestaltungsmodell der Organisationssupervision eine Verstehensmatrix und konzeptiv begründbare Ansatzpunkte für supervisorische Interventionen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BERATEN IN DER ARBEITSWELT
Herausgegeben von Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Angela Gotthardt-Lorenz
Organisationssupervision –ein Konzept
Erfahren, Verstehen und Mitgestaltenorganisationaler Interaktionen
Mit 6 Abbildungen und einer Tabelle
Vandenhoeck & Ruprecht
Gewidmet Brigitte Hausinger (1964–2016),Vorreiterin für die ZusammenschauArbeit-Organisation-Supervisionim Rahmen gesellschaftlicher Veränderungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
© 2020, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG,
Theaterstraße 13, D-37073 Göttingen
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk und seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung des Verlages.
Umschlagabbildung: kmlmtz66/shutterstock.com
Satz: SchwabScantechnik, GöttingenEPUB-Produktion: Lumina Datamatics, Griesheim
Vandenhoeck & Ruprecht Verlage | www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com
ISSN 2625-6061
ISBN 978-3-647-99922-7
Inhalt
Zu dieser Buchreihe
Ausgangspunkt und Anliegen
Organisationssupervision trifft Arbeitssoziologie
Zum bisherigen Konzept der Organisationssupervision
Zum Supervisionsverständnis und zu meiner Schwerpunktsetzung
Das Drei-Ebenen-Modell der Organisationssupervision
1Ausgangspunkt Organisation: Konstituierende Faktoren des Konzepts Organisationssupervision (Ebene 1)
1.1Bestimmungsort allgemein: Organisationsstruktur – Organisationsaufgaben – Organisationsdynamik
1.2Bestimmungsort speziell: Personenbezogene Dienstleistungen
1.3Anforderungen: Fachlichkeit versus Gewinn bzw. begrenzte Ressourcen
1.4Organisationales Angebot: Soziale Zugehörigkeit und ihre Begrenzung
Praxissequenz 1: Fakten und Einschätzungen zur Organisation – der Beginn von Organisationssupervision
2Reflexions- und handlungsrelevante Konzepte: Ansatzpunkte für Organisationssupervision (Ebene 2)
2.1Interaktionistisches Rollenkonzept/Konzept Soziale Erwartungsstrukturen
2.2Konzept Interaktionsarbeit
2.3Professionelles Handeln
2.4Konzept Organisationale Achtsamkeit
Praxissequenz 2: Organisationale Interaktionen als zentrale Supervisionsthemen
3Methodisch-didaktische Konzipierung von Organisationssupervision (Ebene 3)
3.1Auseinandersetzung mit Erwartungsstrukturen: Entwicklung adäquater Beratungssysteme
3.2Supervisorischer Interaktionsraum für sozioemotionale Interaktionsthemen
3.3Fokussierung auf die Unterstützung professionellen Handelns
3.4Supervisorische Position und Haltung: Nähe-Distanz-Bestimmung
3.5Systematik zum Rollenangebot der Organisationssupervision
Praxissequenz 3: Ein Supervisionsprojekt
Literatur
Zu dieser Buchreihe
Die Reihe wendet sich an erfahrene Beratende und Personalverantwortliche, die Beratung beauftragen, die Lust haben, scheinbar vertraute Positionen neu zu entdecken, neue Positionen kennenzulernen, und die auch angeregt werden wollen, eigene zu beziehen. Wir denken aber auch an Kolleginnen und Kollegen in der Aus- und Weiterbildung, die neben dem Bedürfnis, sich Beratungsexpertise anzueignen, verfolgen wollen, was in der Community praktisch, theoretisch und diskursiv en vogue ist. Als weitere Zielgruppe haben wir mit dieser Reihe Beratungsforschende, die den Dialog mit einer theoretisch aufgeklärten Praxis und einer praxisaffinen Theorie verfolgen und mitgestalten wollen, im Blick.
Theoretische wie konzeptuelle Basics als auch aktuelle Trends werden pointiert, kompakt, aber auch kritisch und kontrovers dargestellt und besprochen. Komprimierende Darstellungen »verstreuten« Wissens als auch theoretische wie konzeptuelle Weiterentwicklungen von Beratungsansätzen sollen hier Platz haben. Die Bände wollen auf je rund 90 Seiten den Leserinnen und Lesern die Option eröffnen, sich mit den Themen intensiver vertraut zu machen, als dies bei der Lektüre kleinerer Formate wie Zeitschriftenaufsätzen oder Hand- oder Lehrbuchartikeln möglich ist.
Die Autorinnen und Autoren der Reihe bearbeiten Themen, die sie aktuell selbst beschäftigen und umtreiben, die aber auch in der Beratungscommunity Virulenz haben und Aufmerksamkeit finden. So offerieren die Texte nicht einfach abgehangenes Beratungswissen, sondern bewegen sich an den vordersten Linien aktueller und brisanter Themen und Fragestellungen von Beratung in der Arbeitswelt. Der gemeinsame Fokus liegt dabei auf einer handwerklich fundierten, theoretisch verankerten und gesellschaftlich verantwortlichen Beratung. Die Reihe versteht sich dabei als methoden- und schulenübergreifend, in der zu einem transdisziplinären und interprofessionellen Dialog in der Beratungsszene angeregt wird.
Wir laden Sie als Leserinnen und Leser dazu ein, sich von der Themenauswahl und der kompakten Qualität der Texte für Ihren Arbeitsalltag in den Feldern Supervision, Coaching und Organisationsberatung inspirieren zu lassen.
Stefan Busse, Rolf Haubl und Heidi Möller
Ausgangspunkt und Anliegen
Wegen oder auch trotz der vielen Veränderungen, die die Arbeit und das professionelle Arbeiten in Organisationen betreffen, werde ich – 25 Jahre nach meiner ersten Auseinandersetzung mit dem Begriff und Inhalt von Organisationssupervision – in diesem Band den Versuch unternehmen, eine erweiterte Sicht auf Organisationssupervision als Konzept zu beschreiben. Ergänzend zu den schon früher dargelegten Grundstrukturen zur Konzeptionalisierung von Supervision in Organisationen werde ich theoretische Grundlagen einbeziehen, welche die Plausibilität dieses Ansatzes unterstützen und gleichzeitig dezidierte Ansatzpunkte für Organisationssupervision verdeutlichen können. So möchte ich eine gegenstandsadäquate, weil arbeits- und organisationsbezogene, theoretische und praxisrelevante Fundierung aufzeigen, die das Konzept Organisationssupervision solide und in ihrem Aufbau charakteristisch darstellt.
Ich beziehe mich dabei im Wesentlichen auf arbeitssoziologische Systematiken und Forschungen, die im bisherigen Diskurs zu Supervision relativ wenig genutzt wurden. Organisationssupervision, die per Definition eng an Arbeitsprozesse angebunden ist, kann von arbeitssoziologischer bzw. arbeitswissenschaftlicher Seite eine entsprechende Fundierung erhalten. Dabei geht es nicht nur um die Sicht auf Veränderungen der Arbeitswelt in ihren großen Entwicklungen, sondern um die dezidierte Bestimmung, welche arbeits- und professionssoziologisch zu verstehenden Ansatzpunkte für Organisationssupervision konzeptionell evident sind.
In meinen Ausführungen werde ich – wenn das Geschlecht von Personen(gruppen) unbekannt ist – sowohl die weibliche als auch die männliche Form wählen, die weibliche bevorzugend.
Danken möchte ich Andrea Sanz, Stefan Busse, Guido Becke und Erhard Tietel, die mich in unterschiedlichen Phasen der Manuskripterstellung durch Kommentierungen und Einschätzungen hilfreich herausgefordert haben.
Organisationssupervision trifft Arbeitssoziologie
Mit meinen Überlegungen schließe ich an die Arbeiten von Brigitte Hausinger (2008) an, die erstmals in der Schriftenreihe zur Subjektorientierten Soziologie der Arbeit und der Arbeitsgesellschaft, herausgegeben von G. Günter Voß, Supervision im Kontext der bedeutsamen Bezugsgrößen Organisation, Arbeit und Ökonomisierung dargestellt hat. Intensiv haben mich die arbeitssoziologischen und angrenzenden wissenschaftlichen Perspektiven seit dem Sommer 2016 beschäftigt, als an der Universität Bremen – veranstaltet von Guido Becke, Eva Senghaas-Knobloch und Erhard Tietel – arbeitswissenschaftliche Systematiken in Auseinandersetzung mit Organisationssupervision gesetzt wurden. Die Themen der in den folgenden Jahren dazu geführten Diskussionen fließen hier mit ein.
Was mir auf diesem Wege immer mehr bewusst geworden ist: Arbeitssoziologen und Arbeitssoziologinnen, die eher »subjektorientiert« ausgerichtet sind, beschreiben Arbeitsprozesse und Arbeitsanforderungen und deren Wirkungen so, dass sie eine hohe Kompatibilität zeigen zu dem, was Supervisorinnen und Coaches in ihrer Beratungsarbeit und auch an sich selbst erleben. Das von Böhle, Voß und Wachtler herausgegebene zweibändige »Handbuch Arbeitssoziologie« (2018) bietet einen umfangreichen Überblick und Einblick zu aktuellen Forschungsbereichen und Diskursen zur Soziologie der Arbeit und ist eine Fundgrube für Supervisorinnen, die sich intensiver mit dem Thema Arbeit – eben auch im Rahmen von Organisationen – beschäftigen möchten.
Arbeitswissenschaftliche, insbesondere arbeitssoziologische Überlegungen und Forschungen können helfen – wie ich zeigen werde – die Grundstruktur der Organisationssupervision zu differenzieren und diese gleichzeitig in ihrer arbeitsweltlichen »Bodenhaftung« zu unterstützen. Die Methodik und Praxis der Organisationssupervision hat eine eigene Entstehung und Charakteristik. Das Konzept der Organisationssupervision kann jedoch verdichtet werden, wenn es gelingt, bis in die Methodik hinein eine beschreibbare Verbindung zu arbeitsweltlichen und organisationalen Anforderungen zu verdeutlichen. Dies wird im Folgenden versucht.
Zum bisherigen Konzept der Organisationssupervision
Diskurse dazu, wie Supervision in den organisationalen Kontext zu stellen ist, wurden im Rahmen unterschiedlich begründeter konzeptioneller Überlegungen durch viele Kolleginnen und Kollegen, Praktiker, Wissenschaftler und Ausbildner für Supervision und Coaching in den letzten vierzig Jahren im deutschsprachigen und europäischen Raum durchgeführt. Der für die Organisationssupervision entscheidende Einschnitt erfolgte dort, wo Supervision nicht mehr als einem einzelnen Organisationsmitglied oder einem Team zugehörig gesehen wurde (»meine/unsere« Supervisorin), sondern die organisationale Aufgabe und die organisationale Beauftragung des Supervisors in den Fokus der supervisorischen Betrachtung und Handlung kam (erstmalig Weigand, 1990).
Seitdem ich mit dem Begriff Organisationssupervision operiere, bemühe ich mich, zum Ausdruck zu bringen, dass das größte Unterscheidungsmerkmal in dem an sich breit angelegten Angebotsrepertoire der Supervision die Organisationsnähe ist, also die Frage, ob diese Supervisionen im Kontext einer organisationalen Beauftragung stehen oder nicht. Findet die Supervision im Rahmen einer Organisation statt, war es mir immer schon wichtig, das Beratungssystem Supervision in seiner (jeweils zu befragenden) Konstellation und Funktion zu beschreiben. Weiterhin ist in jedem Fall der Diskurs zur Position, zur Rollengestaltung und zum daran orientierten Vorgehen der Supervisorinnen und Supervisoren von Bedeutung. In dieser Hinsicht wurden schon zu Beginn konzeptuelle Grundmerkmale der Organisationssupervision festgelegt.
Beschrieben habe ich bisher, dass es in dem Konzept der Organisationssupervision speziell um die Beachtung, Reflexion, Bedeutungssuche und Bearbeitung aller organisationalen Strukturen und Prozesse geht, die für die dortigen Aufgabenstellungen und Arbeitsbeziehungen relevant sind. Die Gestaltung der jeweiligen Beratungssysteme, ihre Entwicklung und jede einzelne Supervisionssequenz sind konsequent im Kontext aller Erwartungs-, Identifikations- und Konfliktdynamiken, die sich aus der Aufgabe und den zugehörigen Adressaten, aus der Organisation selbst (Strukturen, Kulturen, Professionen) und aus den betreffenden gesellschaftlichen Einschätzungen ergeben können, zu entwickeln und durchzuführen. Methodisch geht es darum, persönlich und professionell motivierte Fragestellungen von Mitarbeiterinnen und Führungskräften im Sinne der Kontextualisierung in diesem organisationalen Rahmen und deren Beeinflussungen zu verstehen und über Interventionen zur Verfügung zu stellen. Aufgezeigt habe ich, wie die den Supervisorinnen und Supervisoren in Organisationen zugeschriebenen Rollen auf unterschiedlichen Ebenen Kristallisationspunkte für organisationale Realitäten darstellen (z. B. 1994, 2009a). Diese einerseits zu erkennen, aber auch andererseits aktiv zu gestalten, war von Anfang an ein Spezifikum der Organisationssupervision und ein zentrales Handwerkszeug.
Über weite Strecken steht Organisationssupervision im Gleichklang mit dem Verständnis zu organisationsbezogener Supervision im Mainstream von deutschsprachigen Supervisorinnen. Was mir – wie eben auch vielen anderen Autorinnen und Autoren – immer wichtig war, sind Systematiken, in deren Rahmen organisationsbezogenes Verstehen und Handeln von Supervisoren einzuordnen ist. Dies erscheint mir hilfreich, um in immer wieder verwirrenden Praxissequenzen »Geländer« zu haben, die Orientierung für die eigene Reflexion geben können. Eine aktualisierte Systematik zur Organisationssupervision – unter Einbeziehung arbeits- und professionssoziologischer Konzepte – werde ich hier darstellen.
Anregende Auseinandersetzungen im Kollegium des Instituts für Supervision und Organisationsentwicklung Wien haben gezeigt, wie schwierig eine konzeptionelle Zuordnung des eigenen supervisorischen Handelns in Organisationen oft ist. Diese Herausforderung möchte ich auch den Leserinnen und Lesern zumuten, verbunden mit der Hoffnung, dass die Auseinandersetzung mit Konzeptüberlegungen und deren Zuordnungen zum Weiterdenken animieren.
Zum Supervisionsverständnis und zu meiner Schwerpunktsetzung
In meinem Supervisionsverständnis lehne ich mich an bereits veröffentlichte Formulierungen an, zu denen ich in der Supervisionscommunity eine große Übereinstimmung vermute: Als arbeitsweltlich bezogene Beratungsform bietet Supervision Anleitung zur arbeitsbezogenen Selbstreflexion. Die konkrete Supervisionsarbeit gestaltet sich als Rückkoppelungsschleife. Beobachtete Phänomene und Anlassfälle aus dem Supervisions- bzw. Beratungsgeschehen, die ihrerseits in der Regel mit emotionalen Verwicklungen einhergehen, werden in Zusammenhang gebracht mit den für die Supervision relevanten Kontexten, die im Außen liegen, aber unmittelbar die persönlich erlebten Arbeits- und damit zusammenhängenden Kommunikationsprozesse betreffen. Das Supervisionsgeschehen im Hier und Jetzt des Beratungssystems auf der einen Ebene und die kontextreiche Arbeitsrealität der Teilnehmenden an dem Beratungssystem auf der anderen Ebene können durch Herstellen von Zusammenhängen in der Reflexion Verstehen, Distanz und Entlastung bringen (GotthardtLorenz, 2000, S. 59–62).
Die Arbeit als Supervisor(in) benötigt für die jeweilige Zusammenarbeit in den Supervisionsprojekten viele unterschiedliche Verstehens- und Handlungsmodelle, die – je nach Vorverständnis – unterschiedlich geprägt sind. Eine wesentliche Grundlage für die arbeitsbeziehungsorientierte Supervision sind psychodynamisch orientierte Konzepte. Im Rahmen des Spektrums dieser meist psychoanalytisch geprägten Sichtweisen und Arbeitskonzepte definieren verschiedene Autorinnen und Autoren ihren Beratungsansatz für Organisationen (z. B. Steinhardt u. Datler, 2004; Lohmer, 2017), getragen von dem Bemühen, Dynamikprozesse in Organisationen – auch im Kontext der eigenen Erfahrungen – zu erkennen. Arbeitskonzepte und unterschiedliche Beratungsansätze in einem Überblick haben Giernalczyk und Möller (2019) unter dem Titel »Entwicklungsraum. Psychodynamische Beratung in Organisationen« veröffentlicht.
In meinen Überlegungen beziehe ich mich auch auf nahe stehende Verständnisansätze, vor allem im Zusammenhang mit der Supervisionsmethodik, wenn es darum geht, die eigenen Involvierungen als Supervisorin zu erkennen und zu nutzen. Allerdings werde ich mich im Folgenden zuallererst auf arbeitssoziologische, auch organisations- und professionssoziologische Denkstrukturen und Forschungen, auf deren differenzierende Sichtweisen zu Arbeit und Organisation konzentrieren. Die dort in verschiedenen Arbeiten aufgezeigten Ansätze zum Verständnis der Entwicklungen, Strukturen und Dynamik von Arbeit, Arbeitsprozessen und Organisationen werde ich nutzen, um aufzuzeigen, auf was Supervision in der Arbeitswelt trifft. Durchgehend relevant in dieser Betrachtung sind die jeweils stattfindenden organisationalen Interaktionen und die damit zusammenhängenden Emotionen und Zuschreibungen, denen entsprechende konzeptionelle und methodische Ansatzpunkte der Organisationssupervision als sozioemotionaler Ansatz zugeordnet werden. Stärker als bisher werde ich mich auf das Skriptum der Supervision, professionelles Handeln zu unterstützen, beziehen. Wie dieses Primat in das Konzept der Organisationssupervision aufgenommen werden kann und was es heute angesichts der bekannten Herausforderungen der Arbeitswelt bedeutet, dem werde ich genauer nachgehen.
Insgesamt möchte ich deutlich machen, wie sich Supervision – hier im Konzept der Organisationssupervision – in der Arbeitswelt und ihren organisationalen Bezugssystemen legitimiert und wie diese arbeitsweltlichen Anforderungen in der Supervision aufgenommen werden können. Mein Vorgehen besteht darin, dies über ein Drei-Ebenen-Modell zu demonstrieren, das einige für die Supervision relevante Organisationsbeschreibungen und Organisationsfunktionen mit elaborierten Reflexions- und Handlungskonzepten zur Arbeitswelt verbindet. Diesen kann auf der dritten Ebene die methodischdidaktische Ausrichtung der Organisationssupervision zugeordnet werden, die auf dem Weg dann auch präziser zu erfassen ist.
Das Drei-Ebenen-Modell der Organisationssupervision
Mit dem folgenden Drei-Ebenen-Modell (siehe Abbildung 1) beschreibe und begründe ich Organisationssupervision im Sinne Buers (2017) über präskriptive Strukturen. Dazu zunächst ein Überblick:
Auf der ersten Ebene wird zunächst die bisher schon vertretene Grundannahme beschrieben, dass organisationale Arbeitsfelder und Arbeitsgebiete, ausgerichtet an spezifischen Kernaufgaben, immer eingebettet sind in ein Spannungsfeld zwischen Organisationsstruktur und Organisationsdynamik. Ergänzend zu diesem allgemeinen und bekannten Bestimmungsort für Organisationssupervision wird anschließend der Blick auf personale Dienstleistungsorganisationen als spezifischer Bestimmungsort gerichtet. Drittens geht es um das inhaltliche Spannungsfeld von geforderter Fachlichkeit und begrenzten Ressourcen als organisationale Anforderung und zum Vierten um das Angebot der Zugehörigkeit und deren Begrenzung. Alle Aspekte werden durch entsprechende Forschungen und Analysen untermauert.
Auf der zweiten Ebene werden – jeweils in Bezug zu diesen vier Punkten – reflexions- und handlungsrelevante Konzepte herangezogen, die in der Beobachtung, Beforschung und Analyse von Arbeitsprozessen, auch speziell in Bezug auf professionelles Arbeiten, entstanden sind: das Konzept Soziale Erwartungsstrukturen (Becke) im Anschluss an die bekannte Rollenthematik (Goffman u. a.), das Konzept Interaktionsarbeit (Böhle, Stöger, Weihrich, Dunkel), die Grundmaximen zur Professionalität nach Schütze, aber auch das Konzept Subjektivierte Professionalität von Demszky und Voß und das Konzept Organisationale Achtsamkeit (Becke im Anschluss an Weick und Sutcliffe).
Abbildung 1: Organisationssupervision – Drei-Ebenen-Modell
Auf der drittenEbene können – aufbauend auf dem skizzierten Unterbau – Verbindungen hergestellt werden zur methodisch-didaktischen Konzipierung von Organisationssupervision. Die anschließenden methodisch-didaktischen Überlegungen sind einerseits als Konsequenz der dargestellten Konzepte zu sehen, andererseits können bisherige konzeptionelle Überlegungen begründet werden:
–





























