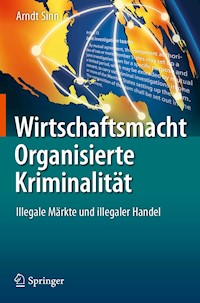18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Frag doch einfach!
- Sprache: Deutsch
Mafia-Clans, Drogenhandel, illegale Waffen – das sind nur einige der Vorstellungen, die sich mit dem Begriff Organisierte Kriminalität verbinden. Doch das organisierte Verbrechen hat viele Gesichter. Arndt Sinn geht mit seinem Forschungsteam dem Phänomen auf den Grund. Im Frage-Antwort-Stil präsentieren sie neueste Erkenntnisse zu Geschichte, Organisationsformen und der rechtlichen Erfassung. Zudem diskutieren sie Bedrohungspotenziale und geben Handlungsempfehlungen zur Prävention. Ein Buch für Studium und Praxis in den Bereichen Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Kriminologie, Kriminalistik und Polizeiwissenschaft. Frag doch einfach! Die utb-Reihe geht zahlreichen spannenden Themen im Frage-Antwort-Stil auf den Grund. Ein Must-have für alle, die mehr wissen und verstehen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Arndt Sinn
Organisierte Kriminalität? Frag doch einfach!
Klare Antworten aus erster Handunter Mitarbeit von Lars Bojen, Yari Dennhardt, Marcel P. Iden, Patrick Pörtner
Umschlagabbildung und Kapiteleinstiegsseiten: © bgblue, iStock
Icons im Innenteil: Figur, Lupe, Glühbirne: © Die Illustrationsagentur
Autorenfotos: © privat
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838561004
© UVK Verlag 2023
‒ ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Covergestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6100
ISBN 978-3-8252-6100-9 (Print)
ISBN 978-3-8385-6100-4 (ePDF)
ISBN 978-3-8463-6100-9 (ePub)
ISBN 978-3-8252-6100-9 (Print)
ISBN 978-3-8463-6100-4 (ePub)
Inhalt
Vorwort
„Organisierte Kriminalität“ (OK) ist ein komplexes Kriminalitätsphänomen, mit dem sich viele Vorstellungen über deren Erscheinungsformen verbinden. Sie reichen von verklärend-romantischen Bildern des Mafia-Paten über Motorrad-Rocker- und Clan-Zusammenschlüssen, Verschwörungen in Wirtschaftsunternehmen bis hin zu gesichtslosen Netzwerken, in denen Personen ihre Fähigkeiten einbringen, um gemeinsam kriminell Profit zu erzielen. Die Tätigkeiten reichen von Drogen-, Waffen- und Menschenhandel, Manipulation von Sportveranstaltungen, Betrug, Fälschung, Cybercrime und Produktpiraterie bis zur Geldwäsche. Trotz der Präsenz von OK in der täglichen Berichterstattung, in kriminalpolitischen Diskussionen und der medialen Rezeption ist OK scheinbar mangels individuell spürbarer Verletzung eine opferlose Kriminalitätsform, sieht man von Gewaltexzessen ab. Dabei erwirtschaftet die OK weltweit jährlich Milliardenbeträge, die durch Geldwäsche in die legale Wirtschaft reinvestiert und dadurch Wirtschaft und Gesellschaft unterminiert werden, was letztendlich zu einem großen gesamtgesellschaftlichen Schaden führt. Die Herausforderungen im Zusammenhang mit dieser Kriminalitätsform sind vielfältig und enorm, weil die Gesichter der OK so mannigfaltig und wandelbar sind. Ohne Klärung der Merkmale von OK, ihren Aktivitäten und Methoden, kann keine Gegenstrategie und letztendlich kein rechtliches und kriminalpolitisches Konzept, das in Ressourcen und Organisationsstrukturen mündet und von Präventionskonzepten begleitet wird, erfolgreich sein. Dabei spielen Forschung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis eine ganz bedeutende Rolle. Die OK-Forschung ist allerdings in Deutschland nicht gut aufgestellt, was sicherlich auch daran liegt, dass der interdisziplinäre Zugang zu dem OK-Problem nicht einfach zu bewältigen ist. Auch die Ausbildung an den Universitäten und Hochschulen zum OK-Phänomen und zu dessen rechtlicher Einordnung sowie die Aus- und Fortbildung in Polizei und Justiz spielen eine wichtige Rolle. Nur mit einem ganzheitlichen Ansatz lässt sich OK erfassen und auf dieser Grundlage können Gegenkonzeptionen erarbeitet werden.
Die Idee zu diesem Buch hat das Autorenteam gerne aufgenommen. Denn wie bei vielen anderen sehr komplexen Themen ist es auch bei Beschreibung, Einordnung, Konzeptionierung und Bewältigung des OK-Phänomens wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Die Antworten auf diese Fragen wurden in jahrelanger Forschung gewonnen. Viele Fragen verdienten es, ausführlicher beantwortet zu werden, was aus konzeptionellen Gründen unmöglich war. Die Antworten beruhen auf hinreichendem wissenschaftlichen Hintergrund, den sich die geneigte Leserschaft durch die Verweise auf weiterführende Literatur erschließen mag.
Das Werk entstand während der Zusammenarbeit der Autoren in einem von Prof. Dr. Prof. h.c. Arndt Sinn initiierten und geleiteten interdisziplinären Forschungsverbund „Organisierte Kriminalität 3.0“, der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Programms „Forschung für die zivile Sicherheit“ in den Jahren 2020–2023 gefördert wurde (🔗 https://www.jura.uni-osnabrueck.de/forschung/forschungsprojekte/ok_30.html zuletzt 10.07.2023). Die Autorenschaft für die jeweiligen Abschnitte in diesem Buch wird jeweils am Beginn eines Fragenkomplexes genannt.
Ich danke „meinem OK-Team“, namentlich Lars Bojen, Yari Dennhardt, Marcel P. Iden und Patrick Pörtner für ihr Mitwirken an diesem Buch und die gemeinsame Forschung. Das Autorenteam dankt Frau stud. iur. Fiona Willeke sowie Frau Petra Heidemeyer für die umsichtige Begleitung des Manuskipts und Herrn Rainer Berger vom UVK Verlag für die Unterstützung bis zur Drucklegung.
Was die verwendeten Symbole bedeuten
Toni gibt dir spannende Literatur- und Onlinetipps und er geht auf Beispiele ein.
Die Glühbirne zeigt eine Schlüsselfrage an. Das ist eine der Fragen zum Thema, deren Antwort du unbedingt lesen solltest.
Die Lupe weist dich auf eine Expert:innenfrage hin. Hier geht die Antwort ziemlich in die Tiefe. Sie richtet sich an alle, die es ganz genau wissen wollen.
Abschnitt 1: Organisierte Kriminalität: Begriffsbestimmung | Patrick Pörtner
Den Begriff „Organisierte Kriminalität“ (abgekürzt „OK“) zu bestimmen, ist nicht einfach. Ein Blick in die Historie ist aufschlussreich. Dieser Blick hilft dabei, die Entwicklung der unterschiedlichen Definitionsversuche und -ansätze national, international und auf europäischer Ebene zu verstehen. Er zeigt allerdings auch, dass die Begriffsbestimmung nie statisch ist und eine Anpassung der Definition im zeitlichen Verlauf notwendig sein kann.
Was versteht man unter dem Begriff der Organisierten Kriminalität (OK)?
Vor etwa 50 Jahren äußerte der damalige Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), dass es wohl kein Gebiet im Bereich der Kriminalität gebe, dass „der Begriffsbestimmung so sehr bedarf wie das sogenannte organisierte Verbrechen“ (Herold 1975, S. 5). Ungehindert dieser Aussage mangelt es bis heute an einer eindeutigen Klärung und allgemeingültigen DefinitionDefinition des OK-Begriffes.
Bei dem OK-Begriff handelt es sich um einen historisch gewachsenen Begriff, welcher strafrechtliche, strafprozessuale, kriminologische, politische, soziologische und psychologische Aspekte beinhaltet. Der Begriff setzt sich aus den beiden Wörtern „organisiert“ und „Kriminalität“ zusammen. Bereits diese Wortkombination lässt vermuten, dass es sich bei der OK um eine besondere Erscheinungsform von Kriminalität handelt. Die OK zeichnet sich im Vergleich zu anderen Erscheinungsformen von Kriminalität gerade dadurch aus, dass sie organisiert begangen wird. Die mit der Organisation einhergehende Regelhaftigkeit, Arbeitsteilung, gemeinsame Zielverfolgung, Machtbündelung und Kontinuität ist es, was diese Erscheinungsform von Kriminalität so gefährlich macht. In der Organisation ist das hohe Potenzial einer Straftatbegehung durch Mitglieder einer OK-Gruppierung verankert, welches sich durch eine wiederholende, planmäßig strukturierte und auch für die Zukunft erwartbare Tatbegehung auszeichnet. Aus dem geschilderten Bedrohungspotenzial der OK lässt sich ableiten, dass der OK-Begriff mehrere Begriffselemente umfasst. Üblicherweise werden vier die OK kennzeichnende BegriffselementeBegriffselemente unterschieden, namentlich ein personales, zeitliches, organisatorisches und voluntatives Element. Auch wenn die konkreten Anforderungen an die einzelnen Begriffselemente teilweise bis heute umstritten sind, so dürfte jedenfalls dahingehend Einigkeit bestehen, dass unter OK der Zusammenschluss von mehreren Personen für eine gewisse Dauer zu verstehen ist, welcher zur Verfolgung eines gemeinsamen Interesses in organisierter Weise Straftaten begeht.
Die konkreten Anforderungen an die einzelnen Begriffselemente werden hingegen nicht einheitlich beurteilt. Es wird beispielweise über die notwendige Personenanzahl für den Zusammenschluss diskutiert. Also, ob der Zusammenschluss mindestens zwei, drei oder noch mehr Personen voraussetzt. Umstritten ist auch die Frage, ob neben dem mit dem OK-Phänomen richtigerweise assoziierten Profitinteresse noch weitere subjektive Interessen anerkannt werden sollten. Wenig überraschend bereitet die Ausfüllung des organisatorischen Begriffselements die größten Schwierigkeiten, da dieses die OK in ganz erheblicher Weise kennzeichnet.
Woher stammt der Begriff der OK?
Der OK-Begriff stammt ursprünglich aus den Vereinigten Staaten (USA). Dort wurde der Begriff des organized crimeorganized crime erstmals verwendet und entscheidend geprägt. In den USA war der Begriff des organized crime bereits fester Bestandteil in der kriminalpolitischen Diskussion, als dieser mit Beginn der 1960er-Jahre auch in der Bundesrepublik zunehmend übernommen wurde. Vermutlich im Jahr 1896 wurde der Begriff des organized crime zum ersten Mal fachlichkundig in dem jährlichen Jahresbericht der New Yorker Gesellschaft für Verbrechensbekämpfung (Woodiwiss 2003, S. 5) ewähnt. Mit einer inhaltlichen Bedeutung wurde der Begriff sodann im Jahr 1919 in Chicago versehen, als die „Chicago Crime Commission“ über die damaligen kriminellen Entwicklungen in der Stadt im Zusammenhang mit der Prohibition (näher hierzu → S. 52f.) sprach (von Lampe 1999, S. 26f.). Zu dieser Zeit hatte der Begriff des organized crime allerdings noch mehrere Bedeutungen und wurde zumeist als Synonym für den Begriff racketeeringrecketeering und damit für Gaunereien bzw. Gangstertum verwendet (Paoli/Vander Beken 2014, S. 14). Beginnend mit den 1920er- und 1930er-Jahren setzte man sich im Rahmen der beiden Studien von Trasher (1927) und Ledesco (1929) auch erstmalig von wissenschaftlicher Seite aus mit dem Phänomen auseinander. Das bis heute in den USA überwiegend vorherrschende OK-Begriffsverständnis, von einem hierarchisch organisierten italo-amerikanischen Mafia-Syndikat, welches durch illegale Geschäfte das organized crime dominiere und die lautere amerikanische Gesellschaft unterwandere, wurde im Wesentlichen ab den 1950er-Jahren von der US-Regierung geprägt. Dieses Bild eines Mafia-Mythos wurde durch zahlreiche künstlerische Inszenierung in Büchern und Filmen auch fest in der Gesellschaft verankert. In den 1980er-Jahren wurde die ausschließliche Fokussierung auf italienische Staatsangehörige allerdings aufgegeben, da man zu der Erkennntis gelangt war, dass „Gangster“ jeder ethnischen Herkunft in systematische kriminelle Aktivitäten verwickelt sind (von Lampe 2016, S. 23).
Literaturtipp
Ausführlich zum Begriff des organized crime: von Lampe, K. 1999.
Ist eine Begriffsbestimmung der OK erforderlich?
Für ein Erfordernis einer OK-Begriffsbestimmung lassen sich mehrere Gründe anführen. Eine OK-DefinitionDefinition ist bereits aus rechtsstaatlichen Gesichtspunkten geboten. Dies gilt jedenfalls, solange der Gesetzgeber den OK-Begriff weiterhin zur Grundlage und Intention („legitimer Zweck“ im Kontext der Verhältnismäßigkeit von Gesetzen) seiner gesetzgeberischen Aktivitäten macht. In der Vergangenheit hat der Bundesgesetzgeber das OK-Phänomen mehrfach zum Anlass für Anpassungen im materiellen StrafrechtStrafrecht insbesondere im Strafgesetzbuch (StGB) genommen. Auf das Argument der erforderlichen effektiveren OK-Bekämpfung gestützt, wurden bestehende Straftatbestände verschärft sowie neue Straftatbestände eingeführt, ohne dass diese gesetzlichen Maßnahmen in ihrer konkreten Ausgestaltung auf die OK-Verfolgung beschränkt wurden. Dieses Vorgehen des Gesetzgebers lässt sich in gleicher Weise auch für das StrafverfahrensrechtStrafverfahrensrecht feststellen. In der StrafprozessordnungStrafprozessordnung (StPO) wurden ebenfalls neue besondere Ermittlungsmaßnahmen mit dem Argument der effektiveren OK-Verfolgung geschaffen, ohne dass die neuen Maßnahmen auf die Verfolgung von OK beschränkt wurden. Das Ergebnis ist eine allgemeine Verschärfung des Straf- und Strafprozessrechts, welche maßgeblich durch das Fehlen einer klaren und allgemeingültigen OK-Definition gefördert wird. Prominentestes Beispiel für derartige gesetzgeberische Aktivitäten, ist das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität (OrgKGOrgKG) aus dem Jahr 1992 (BGBl. 1992, S. 1302), welches vor diesem Hintergund durchaus kritisch meinend als Musterbeispiel modernen Strafrechts bezeichnet wurde (Hassemer 1992, S. 64). Die Gefahr der Ausweitung von Tatbeständen, welche ausdrücklich von dem Gesetzgeber mit dem Ziel der OK-Verfolgung eingeführt werden, auf Bereiche außerhalb der OK könnte dadurch vermieden werden, dass die OK und ihre Grenzen klar und eindeutig durch eine Definition bestimmt werden.
Losgelöst von diesen rechtsstaatlichen Erwägungen ist eine OK-Definition bereits aus rein kriminalpraktischen wie auch kriminalpolitischen Gründen angezeigt. Für eine Vorbeugung (PräventionPrävention) und Verfolgung (RepressionRepression) von OK werden Merkmale vorausgesetzt, welche sich in einer DefinitionDefinition zusammenfassen lassen, um die OK für eine wirksame und nachhaltige Verfolgungsstrategie sichtbar zu machen. Wenn deutlich wird, dass von der OK ein erhöhtes Bedrohungspotenzial und besonders hohe Schäden für die Gesellschaft ausgehen, so können auch besondere Präventions- und Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt werden (Sinn/Storbeck 2022, S. 3). Daneben ermöglicht eine Definition die Einordnung eines Ermittlungskomplexes als OK, was Einfluss auf die Organisation bei den Strafverfolgungsbehörden hat. Wird ein Kriminalitätsphänomen als OK eingeordnet, so sind hieran heute in einigen Bundesländern Zuständigkeiten von SchwerpunktstaatsanwaltschaftSchwerpunktstaatsanwaltschaften wie auch im polizeilichen Bereich (OK-DezernateOK-Derzernate) geknüpft. Um die Frage nach deren Zuständigkeiten klar zu regeln und dadurch nicht zuletzt einen effektiven und nachhaltigen Einsatz der Ressourcen dieser Spezialabteilungen sicherzustellen, bedarf es ebenfalls einer OK-Definition.
Worin bestehen die (weiteren) Vorteile einer OK-Definition?
Darüber hinaus sprechen weitere Vorteile für eine OK-DefinitionDefinition. Bei der OK handelt es sich um ein internationales und transnationales Kriminalitätsphänomen, welches nicht an Ländergrenzen Halt macht. OK-Gruppierungen sind regelmäßig grenzüberschreitend aktiv. Von zentraler Bedeutung ist daher, dass die OK gemeinsam international verfolgt wird. Zwar folgt ein Definitionserfordernis auf Ebene der Europäischen Union (EU) nicht aus Art. 83 Abs. 1 AEUV und somit aus dem europäischen Primärrecht, da es sich hierbei lediglich um eine Kompetenzvorschrift handelt. Ein gemeinsames europäisches OK-Verständnis ist aber dennoch überaus sinnvoll. Damit alle 27 Mitgliedsstaaten dasselbe Kriminalitätsphänomen vor Augen haben, um dieses geschlossen und effektiv bekämpfen zu können, bedarf es eines übereinstimmenden OK-Verständnisses, welches idealwerweise durch eine DefinitionDefinition abgesichert wird. Konsequenterweise wird deshalb auch in den SOCTASOCTA-Berichten von Europol zur EU-weiten OK-Erfassung auf die Definition der „kriminellen Vereinigung“ aus dem Rahmenbeschluss zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität vom 24.10.2008 zurückgegriffen (vgl. Rat der EU, Dok. 9992/2/12 Rev 2 ENFOPOL 137, Annex S. 8).
Auch aus wissenschaftlicher Perspektive ist eine einheitliche OK-DefinitionDefinition wünschenswert. Dies gilt insbesondere für die KriminologieKriminologie. Ein wesentliches Forschungsfeld der Kriminologie ist die Kriminalphänomenologie, welche die verschiedenen Erscheinungsformen von Kriminalität untersucht und zu beschreiben versucht (Schwind/Schwind 2021, S. 11). Diese Forschungen sind aber nur dann möglich, wenn es gelingt, den konkreten Forschungsgegenstand – hier die Erforschung des OK-Phänomens – zu definieren oder zumindest ansatzweise zu bestimmen und einzugrenzen. Daneben ist eine Empirie innerhalb der kriminalwissenschaftlichen Forschung ohne eine OK-Definition nicht möglich. Selbstverständlich liegt deshalb auch dem jährlich vom BKA herausgegebenen Bundeslagebild zur Organisierten Kriminalität eine OK-Definition zugrunde, auch wenn diese nicht als allgemeingültig bezeichnet werden kann (→ S. 41ff.). Folglich ist für das Gelingen jeglicher Form von OK-Forschungen eine OK-DefinitionDefinition durchaus sinnvoll und hilfreich.
Gibt es weltweit eine allgemein anerkannte Begriffsbestimmung der OK?
Aufgrund der Komplexität des Phänomens, welches nicht zuletzt in den verschiedensten Ausprägungen von Organisationsformen und den unterschiedlichsten kriminellen Geschäftsmodellen ihren Ausdruck findet, hat sich bis heute keine allgemein anerkannte Definition der OK etablieren können. Es fällt überaus schwer, die verschiedenen und sich ständig wandelnden Gesichter der OK in ein starres definitorisches Korsett zu zwingen. Dieser Schwierigkeit ist es geschuldet, dass weltweit wohl über 200 verschiedene Definitionsansätze (eine Auflistung ist zu finden unter: 🔗http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm Stand 10.07.2023) existieren. Viele Staaten arbeiten im Rahmen der begrifflichen Erfassung und Aufarbeitung des Phänomens mit eigenen und zum Teil voneinander abweichenden Phänomenbeschreibungen, auch wenn viele Merkmale sich oftmals in ähnlicher Form in den einzelnen Beschreibungen wiederfinden. Im Jahr 2000 haben sich durch die Unterzeichnung des Palermo-ÜbereinkommenPalermo-Übereinkommens der Vereinten Nationen (UNTOCUnited Nations Convention against Transnational Organized Crime) die Vertragsstaaten für ein angeglichenes OK-Verständnis entschieden. Die UNTOCUNTOC beschreibt die Merkmale einer „organisierten kriminellen Gruppe“. Zwar haben die Vertragsstaaten bei der rechtlichen Implementierung der Merkmale in die nationalen Strafrechtssysteme einen weiten Spielraum. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass die internationalen Vorgabeninternationale Vorgaben Einfluss auf das weltweite OK-Verständnis genommen haben, was sowohl zu (begrifflichen) Anpassungen auf europäischer wie auch nationaler Ebene geführt hat. Näher zum OK-Verständnis der Vereinten Nationen und der EU siehe unten.
Wie verlief die innerdeutsche Begriffsdebatte?
In den USA erreichte in den 1960er-Jahren die Debatte um das organized crime ihren vorläufigen Höhepunkt. Dies führte dazu, dass man zu dieser Zeit in Deutschland die Frage aufwarf, ob dieses Kriminalitätsphänomen auch in der Bundesrepublik existent und ob dieses für die eigene Sicherheitslage relevant sei. In Polizeikreisen war man sich zwar Ende der 1960er-Jahre noch überwiegend dahingehend einig, dass die Situation nicht mit der auf der anderen Seite des Atlantiks vergleichbar sei, nichtsdestoweniger wurde teils offen die Sorge geäußert, dass sich in der Bundesrepublik bald eine Kriminalitätslage wie in den USA entwickeln könne (Mätzler 1968, S. 405; von Lampe 2019, S. 25 m.w.N.) Die Folge war, dass sich das organisierte Verbrechen bzw. die organisierte Kriminalität allmählich zu einem festen Bestandteil der nationalen kriminalpolitischen Diskussion entwickelte. Auch wenn weitestgehend darin Einigkeit bestand, dass in Deutschland kein organized crime nach amerikanischem Vorbild herrsche (Göppinger1971, S. 383; Kerner1973, S. 294), sprach man sich dennoch dafür aus, den OK-Begriff auch in der Bundesrepublik etablieren zu wollen. Man müsse sich dabei von dem amerikanischen Begriff des organized crime lösen und zu einem originären deutschen OK-Verständnis für die hiesigen Kriminalitätsphänomene gelangen (Kollmar 1974, S. 1). Dies führte dazu, dass sich ab Mitte der 70er-Jahre des 20. Jarhunderts die OK-Existenzdebatte hin zu einer OK-Begriffsdebatte entwickelte.
Noch im Jahr 1973 wurde von der Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Landeskriminalämter mit dem Bundeskriminalamt (AG KripoAG Kripo) eine Fachkommission „Organisierte Kriminalität“ eingesetzt, welche den Auftrag erhielt, eine OK-Definition zu erarbeiten. Die Kommission erhielt die Vorgabe, eine Definition zu entwickeln, welche eine Abgrenzung zum amerikanischen organized crime und zur allgemeinen BandeBanden- und Gruppenkriminalität ermöglichen würde (Boettcher 1975, S. 185). Im Jahr 1974 wurde das Ergebnis präsentiert. Die erste deutsche OK-DefinitionDefinition lautete:
„Der Begriff der organisierten Kriminalität umfaßt Straftaten, die von mehr als zweistufig gegliederten Verbindungen oder von mehreren Gruppen in nicht nur vorübergehendem arbeitsteiligem Zusammenwirken begangen werden, um materielle Gewinne zu erzielen oder Einfluß im öffentlichen Leben zu nehmen“ (Boettcher 1975, S. 186).
Da man der Auffassung war, dass die Definition die an sie vorab gestellten Vorgaben nicht hinreichend erfüllen würde, wurde sie allerdings nicht offiziell verabschiedet. Im Anschluss herrschte dann fast zehn Jahre Ruhe in der deutschen OK-Begriffsdebatte. Ein wesentlicher Grund dafür liegt in den terroristischen Aktivitäten der RAF und der daran anschließenden priorisierten kriminalpolitischen Diskussion. Erst im Jahr 1983 unterbreitete ein Ad-hoc-Ausschuss des Arbeitskreises II. der InnenministerkonferenzAd-hoc-Ausschuss des Arbeitskreises II. der Innenministerkonferenz (IMK) einen neuen Definitionsvorschlag, ohne dass hierzu ein entsprechender Auftrag vorgelegen hätte. Die DefinitionDefinition lautete:
„Dabei ist unter organisierter Kriminalität (OK) nicht nur eine mafiaähnliche Parallelgesellschaft i.S. des organized crime zu verstehen, sondern ein arbeitsteiliges, bewußtes und gewolltes auf Dauer angelegtes Zusammenwirken mehrerer Personen zur Begehung strafbarer Handlungen – häufig unter Ausnutzung moderner Infrastrukturen – mit dem Ziel, möglichst schnell hohe finanzielle Gewinne zu erreichen“ (abgedruckt in Bürgerrecht&/Polizei/Cilip 1984, S. 77f.).
Die Reaktionen auf diese Definition waren ebenfalls verhalten. Sie ist deutlich weiter formuliert als die Definition von 1974 und wurde vor diesem Hintergrund auch kritisiert (Busch1992, S. 381f.). Trotz der geäußerten Kritik galt diese Definition insbesondere in Ermittlerkreisen – mangels eines offiziellen Definitionserarbeitungsauftrages – zunächst als semi-offizielle Definition. In Polizeikreisen war man ohnehin Mitte der 1980er-Jahre der Begriffsdiskussion müde und vielmehr der Auffassung, dass endlich gehandelt werden müsse. Ambivalent hierzu war hingegen das Meinungsbild auf der obersten politischen Ebene, welche zu dieser Zeit die OK-Thematik erst für sich zu entdecken schien. Im Jahr 1989 setzte die Justiz- und Innenministerkonferenz eine „Gemeinsame Arbeitsgruppe Justiz/Polizei zur Strafverfolgung Organisierter Kriminalität“ (GAG Justiz/PolizeiGAG Justiz/Polizei) ein, welche unter anderem den Themenkomplex des OK-Begriffes bearbeiten sollte. Hierzu bildete die GAG Justiz/Polizei eine eigene Unterarbeitsgruppe mit dem Namen „Lagebild der Organisierten Kriminalität; Begriff der Organisierten Kriminalität; Indikatoren für Organisierte Kriminalität“. Diese Unterarbeitsgruppe erarbeitete innerhalb kürzester Zeit einen neuen OK-Definitionsvorschlag, welcher im Mai 1990 von der GAG Justiz/Polizei verabschiedet wurde. Die Definition wurde in die ebenfalls von der GAG Justiz/Polizei ausgearbeiteten Gemeinsame Richtlinien der Justizminister/-senatoren und der Innenminister/-senatoren der Länder über die Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei der Verfolgung der Organisierten Kriminalität (im Folgenden: Gemeinsame RichtlinienGemeinsame Richtlinien) integriert und durch zahlreiche Erlasse der Bundesländer auf Landesebene in Kraft gesetzt. Damit gab es sie nun endlich, die offizielle deutsche OK-Definition, welche seit mittlerweile über 30 Jahren unverändert Bestand hat.
Wie lautet die derzeitige deutsche OK-Definition?
Die aktuelle deutsche OK-DefinitionDefinition ist unter der Ziffer 2.1 der Gemeinsamen Richtlinien zu finden und lautet:
„Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- oder Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind, wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig
a) unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen,
b) unter Verwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel oder
c) unter Einflußnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft
zusammenwirken.
Der Begriff umfasst nicht Straftaten des TerrorismusTerrorismus.“
In den Gemeinsamen Richtlinien wird die Definition noch von zwei Auflistungen bzw. Katalogen ergänzt. Diese sollen bei der Erkennung OK-relevanter Sachverhalte in der Strafverfolgungspraxis helfen. Unter der Ziffer 2.3 der Gemeinsamen Richtlinien findet sich eine Liste von Kriminalitätsbereichen, in denen die OK „zurzeit vorwiegend“ festgestellt wird. Die hier genannten KriminalitätsbereicheKriminalitätsbereiche reichen vom Rauschgifthandel und -schmuggel sowie Waffenhandel und -schmuggel über Kriminalität im Zusammenhang mit dem Nachtleben (vor allem Zuhälterei, Prostitution, Menschenhandel, illegales Glücks- und Falschspiel) bis hin zum Kapitalanlagebetrug. Zusätzlich enthält die Anlage zu den Gemeinsamen Richtlinien, auf diese die Ziffer 2.4 der Gemeinsamen Richtlinien ausdrücklich Bezug nimmt, noch einen 50 Indikatoren umfassenden Katalog mit „[g]enerellen Indikatoren zur Erkennung OK-relevanter Sachverhalte“. Die aufgelisteten Indikatoren werden hierbei in elf Gruppen eingeordnet, welche von der „Vorbereitung und Planung der Tat“ über die „Ausführung der Tat“, bis hin zur „Verwertung der Beute“ oder „Hilfe für Gruppenmitglieder“ reichen.
Was kennzeichnet die OK-Definition von 1990?
Die OK-DefinitionDefinition in den Gemeinsamen Richtlinien hat die Rechtsnatur einer Verwaltungsrichtlinie. Es handelt sich damit um bloßes Verwaltungsinnenrecht ohne Außenwirkung. Die Definition zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass diese äußerst variabel und flexibel in ihrer praktischen Anwendung ist. Besonders deutlich wird dies bei der Betrachtung des Aufbaus, der Struktur und der Funktionsweise der Definition. Die Definition lässt sich zunächst in drei (Satz-)Teile untergliedern. Im ersten Teil sind die so genannten generellen Merkmalegenerelle Merkmale aufgeführt. Es handelt sich hierbei um sechs Merkmale, welche zwingend sind, also kumulativ vorliegen müssen. An die generellen Merkmale schließen sich drei spezielle OK-Merkmalespezielle OK-Merkmale an, welche innerhalb der Definition mit den Kleinbuchstaben a), b) und c) gekennzeichnet sind. Die speziellen Merkmale stehen lediglich in einem Alternativverhältnis zueinander. Deutlich wird dies an dem Wort „oder“ am Ende der Variante b). Im dritten und letzten Teil der Definition wird der „Terrorismus“ über eine Negation von der Definition ausgeklammert. Hierbei handelt es sich also um kein die OK kennzeichnendes Merkmal, sondern vielmehr um einen reinen definitorischen Ausschluss. Andernfalls wären Fälle des TerrorismusTerrorismus durchaus unter die Merkmale der Definition subsumierbar. Es ist also von OK im Sinne der Definition auszugehen, wenn die sechs generellen Merkmale gegeben sind, sobald eines der drei speziellen Merkmale hinzutritt und kein Fall des Terrorismus vorliegt. Mathematisch ausgedrückt
Werden die zwingenden generellen Merkmale näher in den Blick genommen, dann wird sichtbar, dass hier nur bei der Hälfte der genannten Merkmale eine tatsächliche definitorische Einzelbindung besteht. Bereits im ersten (Satz-)Teil der Definition ist das Wort oder drei Mal enthalten. Zwingend im Sinne einer Merkmalseinzelbindung wird allein vorgegeben, dass mehr als zwei Beteiligte arbeitsteilig und planmäßig Straftaten (von erheblicher Bedeutung) begehen müssen. Innerhalb der übrigen drei Merkmale besteht hingegen jeweils eine Wahlmöglichkeit. So muss zwar zwingend ein subjektives Ziel bei dem gemeinsamen Zusammenwirken verfolgt werden, dieses Ziel kann aber sowohl in einem Gewinnstreben als auch in einem Machtstreben liegen. Der Zusammenschluss muss daneben zur Verfolgung des subjektiven Ziels des Gewinn- oder Machstrebens Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen. Die Ermittlung der „erheblichen Bedeutung“ der begangenen Straftaten wird hingegen erneut mit einer Wahlmöglichkeit verknüpft. So kann eine Straftat bereits für sich genommen von erheblicher Bedeutung sein oder die erhebliche Bedeutung wird über einen Summierungseffekt erreicht, indem mehrere Straftaten in ihrer Gesamtheit als von erheblicher Bedeutung zu bewerten sind. Eine solche Wahlmöglichkeit besteht daneben auch beim zeitlichen Kriterium der Dauer. Die Beziehungen zwischen der Erst- und Zweitnennung innerhalb der generellen Definitionsmerkmale und die damit einhergehende definitorische Flexibilität wird in der folgenden Tabelle ersichtlich:
Erstnennung
in der Definition
Beziehung
Zweitnennung
in der Definition
Straftaten einzeln von erheblicher Bedeutung
oder
Straftaten in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung
Gewinnstreben
oder
Machtstreben
längere Dauer
oder
unbestimmte Dauer
arbeitsteilig
Einzelbindung
mehr als zwei Personen
Einzelbindung
planmäßig
Einzelbindung
Generelle Merkmale der OK-Definition. Angelehnt an Liebl 2009, S. 66.
Noch flexibler ist die Handhabung der speziellen Merkmale innerhalb der Definition ausgestaltet, welche lediglich in einem Alternativverhältnis zueinanderstehen. Innerhalb dieser drei speziellen Merkmale gibt es sodann keine Einzelbindung von Merkmalen mehr. Dies wird in der nachfolgenden Übersicht gut sichtbar:
Nennung
Beziehung
Nennung
Beziehung
gewerbliche Strukturen
oder
geschäftsähnliche Strukturen
Gewaltanwendung
oder
Einschüchterung
Einflussnahme auf Politik
Einflussnahme auf öffentliche Verwaltung
Einflussnahme auf Wirtschaft
oder
oder
Einflussnahme auf Medien
Einflussnahme auf Justiz
oder
oder
Spezielle Merkmale der OK-Definition. Angelehnt an Liebl 2009, S. 67.
Wird die Definition in ihrer Gesamtheit betrachtet, so ist in dieser OK-Begriffsbestimmung sieben Mal das Wort oder enthalten. Diese Oder-Verknüpfungen stehen sinnbildlich für das mit der Definition verfolgte Flexibilitätskonzept in der OK-Erfassung. Die Definition wird häufig als Arbeitsdefinition bezeichnet, weil sie die Grundlage für die Erhebung der relevanten Ermittlungsverfahren für das Bundeslagebild OK bildet und sie strategisch-polizeilichen Zwecken dient. Im Kern ist die Definition ein Legitimationsgrund für:
neue Rechtsgrundlagen,
Zuständigkeitsregelungen,
die Ressourcenverteilung,
nationale und internationale Kooperationen und
die Informationssammlung, -analyse, -verarbeitung, -verwertung
(vgl. Pütter 1998, S. 285f.; Sinn 2016, S. 8; Ulrich 2022, S. 76; Kinzig 2004, S.60).
Hingegen ist die OK-Definition in der Gerichtspraxis und für das Strafverfahren nahezu bedeutungslos (Wigand/Büchler 2002, S. 17; Sinn 2016, S.6).