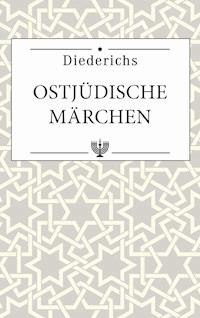
Ostjüdische Märchen E-Book
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diederichs
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
In den hier versammelten 54 märchenhaften ostjüdischen Geschichten, den Maises, Powetschij und Kaskalim, wird ein wichtiges menschliches Bedürfnis sichtbar: In einer farblos und leer wirkenden Zeit wird die alltägliche Welt durch Fantasie und Fiktion so gestaltet, dass sie bewältigt werden kann und ein freundliches Angesicht erhält.
Die Diederichs-Reihe »Märchen der Weltliteratur« ist die umfassendste Sammlung ursprünglicher Erzählliteratur aller Völker und Zeiten. Sie versammelt das Schönste, was sich die Menschen je erzählt haben: Mythen und Legenden, Göttersagen und Dämonengeschichten, Feen- und Zaubermärchen, gewitzte Tierfabeln und herrliche Schwänke. Wer die Eigenart anderer Völker verstehen will, wird hier Wege abseits des Mainstreams finden. Eine moderne Märchenbibliothek für eBook-Leser.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
EDITORISCHE NOTIZ
Der Herausgeber, Dr. Claus Stephani, Gründer und Vorsitzender der Kommission für Ostjüdische Volkskunde (KOJV i. d. DGV e.V.) veröffentlichte bisher 16 Bücher zur deutschen und ostjüdischen Erzählforschung, Volksmythologie und zur vergleichenden osteuropäischen Volkskunde. Diese märchenhaften Geschichten (Maises) wurden, als wissenschaftliches Vorhaben der KOJV, ursprünglich in verschiedenen Idiomen der karpatischen Landschaften aufgezeichnet; sie stammen aus dem jiddischen, rumänischen, ungarischen und zipser-jiddischen Sprachbereich.
In der Endfassung bzw. bei der Übertragung ins Deutsche wurden charakteristische dialektale Ausdrücke, Redewendungen und regionale Wortprägungen beibehalten, um Erzählweise und landschaftliches Sprachkolorit zu dokumentieren. Die Angleichung an die deutsche Rechtschreibung soll Leserinnen und Lesern die Lektüre der eingestreuten Wörter und Sätze in Jiddisch bzw. in deutschen karpatischen Dialekten erleichtern.
1. Der Hirte Hersch
Das war einmal vor sehr langer Zeit, vielleicht noch damals, als im Wassertal und in den jüdischen Gemeinden an der Wischau noch keine Menschen lebten; es war einmal, und wenn es nicht gewesen wäre, würde man es nicht erzählen, und meine selige Bobe, die Rochele vom Schneider Zurowitsch, hätte die Geschichte nicht gehört, und dann hätte auch ich sie nicht gehört, »fun der Bobe mejne«, und auch du, mein Hawerle, hättest diese Geschichte nicht aufschreiben können.
Es ist die Geschichte vom Hirten Hersch – »a Kaskale, a jiddisches, fun wie es is gewejn«.
Ich hab gesagt, daß diese Geschichte sich vor sehr langer Zeit zugetragen hat, also, das könnte vor einigen tausend Jahren gewesen sein; und ich hab gesagt, daß damals hier in der Gegend noch keine Menschen lebten. Das ist richtig. Aber einen Menschen gab es damals doch, und das war der Hirte Hersch. Ob er nun der einzige Mensch war, der hier auf den Bergen lebte – ich weiß?
Von anderen Menschen hab ich nichts gehört, und auch meine Bobe hat davon nichts erwähnt, als sie dies Kaskale erzählte.
Also: Oben auf dem hohen Berg, der dort drüben steht, neben dem Pjetroß, etwas weiter nach Norden hin, am Rande der Bukowina, man nennt ihn Tschorna Hora, den Schwarzen Berg; dort oben also wohnte einst ein Hirte, und der hieß Hersch, einfach Hersch, denn den Namen seines Vaters wußte man nicht.
Dieser Hersch hatte dort eine Styna, und in der kleinen Kulibn wohnte er den ganzen Sommer hindurch. Erst wenn der erste Schnee fiel, das war meist schon Anfang Oktober, zog er mit seinen vielen Schafen ins Tal hinunter, an die Goldene Bistritz, und dort verbrachte er dann die Wintermonate – immer ganz allein, nur er mit seinen Hunden und den Schafen, etwa hundert Stück.
Wie das so ist, auch heute noch, die Menschen hier im Tal können alle Ski laufen, die kleinen Kinder lernen es bereits, wenn sie kaum noch richtig gehen können, und die Alten können es noch, wenn sie sich beinahe schon auf Krücken fortbewegen müssen.
Auch der Hersch konnte Ski laufen, und er konnte es sehr gut; denn wie hätte er sich sonst fortbewegt, wenn der Schnee zwei Meter hoch steht? No na, nur mit Skiern, wie sonst?!
Da hat es einmal mehrere Tage immerzu geschneit. Und als sich am Himmel noch mehr Schneewolken übereinander türmten, konnte eines Abends der Mond nicht mehr aus seinem Haus treten, und da war es furchtbar dunkel, und es schneite weiter.
Am zweiten Abend stemmte sich der Mond gegen die Tür seiner Kulibn und versuchte, die schweren Schneewolken wegzuschieben, denn er wollte ja seinen Weg gehen, oben am Himmel, um dem armen Hersch, der unten im Tal wohnte, ein wenig zu leuchten.
Der Mond war ja nicht besonders stark, er hatte nicht die Kraft eines Hirten oder Bauern, und so stemmte er sich immer wieder gegen die klumpigen, nassen Schneewolken, er stemmte sich so lange dagegen, bis ihm beinahe der Atem ausging. Aber dann hatte er es doch geschafft.
Mühsam kroch er aus seiner Kulibn heraus und stieg auf die Schneewolke, die ihm den Ausgang versperrt hatte.
Die aber schüttelte sich vor Ärger, weil der Mond nun so auf ihr herumtrampelte, sie schüttelte sich so stark, daß er in ihren kalten großen Bauch hineinrutschte. Jetzt war der Mond gefangen, und es blieb weiterhin dunkel.
Als Hersch merkte, daß da oben am Himmel etwas geschehen war, nahm er seine Ski, schnallte sie an, legte einen kleinen Brinsn und ein gutes Stickele von der Mamaliga in seine Trajsta, und stieg so auf den Tschorna Hora.
Als er oben auf dem Berg angekommen war, sah er, daß die Wolken so nah waren, wie du, mein Hawerl, jetzt hier sitzt. Also, er hätte ihnen eine Tetschen geben können. Und wie er staunte und sich wunderte, hörte er auch eine leise Stimme: »Hilf mir, Hersch, hilf mir, daß ich herauskommen kann, weil da drinnen ist es so naß und kalt!« Tjuh, wer war das? Das war der Mond, der in der Wolke steckte und mit den Zähnen klapperte.
»Lua-te-ar naiba!« sagte der Hersch auf walachisch, weil er wußte, daß die Wolken kein Jiddisch verstehen. Dann holte er Streichhölzer hervor und verbrannte seine Trajsta (schade drum, aber er konnte sich ja nachher eine andere weben, Wolle hatte er ja genug von den vielen Schafen).
Das Feuerchen von der Trajsta aber war stark genug, und an einer Stelle begann die Schneewolke zu schmelzen; das genügte, denn nun half der Mond mit seinen feinen weißen Händen etwas nach, und schließlich konnte er aus der nassen kalten Schneewolke herauskriechen.
Er bedankte sich beim Hersch, denn der hatte ihm ja das Leben gerettet (der Mond wäre vielleicht schon in den nächsten Tagen erfroren, und dann hätten wir auch heute nur noch stockdunkle Nächte). Dann aber machte sich der Mond sogleich auf den Weg, um all den Lebewesen, die es damals auf der Erde gab, zu leuchten.
Der Hirte Hersch aber fuhr auf seinen alten Ski wie der Wind den hohen Berg hinunter und war sehr bald wieder bei seinen Schafen.
Lange danach, als Menschen von überall ins Tal zogen und der Hirte Hersch längst nicht mehr lebte, fragte einmal ein Kind seinen Großvater, was das für ein weißer Weg ist, der nachts über den Himmel führt. Und da sagte ihm der Großvater das, was er von anderen Leuten gehört hatte, und denen wiederum hatten es auch andere Leute erzählt: »Das ist die Spur von den Skiern des Hirten Hersch, als er oben am Himmel war.«
2. Wie ein armer Fischer sehr reich wurde
Diese Maise ist sehr alt, die hab ich noch von meinem Großvater gehört, und er stammte aus einem kleinen jüdischen Dorf bei Ungvár. Wer es nicht weiß: Ungvár liegt in der Karpatenukraine, also weit oben im Norden, früher aber gehörte alles zu Ungarn, zu Österreich-Ungarn, und Ungarn war damals noch ein großes Königreich.
Mein Großvater aber hat diese Maise von seiner Mutter gehört, und die hat sie sicher von ihrer Mutter oder vielleicht auch von ihrem Großvater gehört, und so weiter und so fort. Die Maises haben, sagte man früher, ein sehr langes Leben, niemand weiß, wann es begonnen hat oder wann es aufhören wird.
Bei Ungvár gibt es auch einen großen Fluß, aber wie der heißt, weiß ich nicht (mein Großvater hat mir das damals sicher gesagt, aber gemerkt hab ich es mir nicht, weil mir das nicht so wichtig schien), und darum will ich diese Maise einfach erzählen, als wäre sie von hier und nicht aus dem kleinen Dorf bei Ungvár.
Einst lebte ein armer Fischer in einem Dorf an einem großen Fluß, ein Fluß wie der Somesch, nicht größer, aber vielleicht mit mehr Fischen drin; denn der Fischer, von dem hier die Rede ist, ging jeden Tag am frühen Morgen mit einem großen Korb aus geflochtenen Weidenruten – so, wie man das in alten Zeiten machte – eben an diesen Fluß, wo er nach einigen Stunden vielleicht ein Dutzend von den fetten Schtjuka gefangen hatte. Die kamen dann in einen Buckelkorb, und wenn der voll war, ging unser Fischer in die nahe Stadt.
Wie in jeder Stadt, die an einem großen Wasser liegt, gab es auch hier den Fischmarkt, und dort verkaufte der Fischer seine Fische für ein Pengö das Stück. Das war natürlich nicht viel, aber mehr bekam er nicht, und oft versuchten die reichen ungarischen Frauen, die mit ihren Mägden einkaufen kamen, diesen jämmerlichen Preis auch noch hinunterzudrücken, etwa drei Fische für nur zwei Pengö und so ähnlich. Und dann mußte der Jud handeln und betteln und auf die Käuferin einreden wie auf ein störrisches Pferd, damit sie nicht vielleicht weiterging und er mit seinen Fischen blieb.
Ja, der Fischer war natürlich ein armer Jud, und solche Fischhändler hat es noch zu meiner Zeit sehr viele hier gegeben, ein ganzes Heer von Fischhändlern überschwemmte besonders Freitagmorgen den Markt von Sathmar, und manch einer hatte nur zwei Fische, schöne fette Schtjuka anzubieten, und das war sein kleines Geschäft am Tag vor Schabbes.
Also, ein Pengö für einen Fisch, und ein Brot kostete damals, wenn ich mich richtig erinnere, vier Pengö. Butter, Eier, Käse waren auch nicht billig (nicht billig für die armen Leute), und der Fischer war wie alle armen Menschen reich an Nachwuchs (und da gibt es keinen Unterschied zwischen Juden und Gojim; bei Madjaren, Slowaken, Walachen oder Rußnaken, es ist immer dasselbe: Je ärmer die Leute sind, um so mehr Kinder haben sie). Drei Söhne und vier Töchter hatte ihm seine geplagte Frau geschenkt.
Wie oft mußte er nun mit Fischen auf den Markt laufen, um ein paar Brote einzuhandeln – nur damit er die vielen hungrigen Mäuler stopfen konnte. Ich will da keine Rechnungen anstellen, denn jeder kann sich das leicht ausdenken, wieviel man braucht, um eine so zahlreiche Familie satt zu kriegen: Damals wie heute, die Armen haben es immer schwerer als die Reichen, das ist nun mal so auf dieser Welt, und da wird sich auch wohl nie etwas ändern, und ich glaube, das einzige, was man tun kann, ist zu versuchen, dem Schlamassel zu entkommen.
Das dachte auch unser Jud, der Fischer vom Somesch, wenn er in aller Früh im Schilf hockte und mit dem Rutenkorb nach fetten Schtjuka schöpfte. Aber denken ist eines, träumen, wollte ich sagen: Träume kosten nichts, sie sind die Nahrung des kleinen hungrigen Mannes. Der träumt so lang von einer Fleischbrühe, von geflochtenem Brot, bis er schließlich meint, er hätte tatsächlich eine Schüssel Tscholent mit Challe gegessen. Aber lang bleibt man so nicht satt. Träume sind wie Bratengeruch: Der eine ißt den Braten, der andere riecht ihn. Der eine ist satt vom Essen, der andere vom Riechen. Na bitte. Welcher von den beiden möchtest du sein?
Also viele Kinder hatte der Jud. Und immer war das Essen knapp. Vom Geld gar nicht zu reden; obwohl auch seine Frau, muß man sagen, eine fleißige Person war und zu den reichen Familien Wäsche waschen ging und so als Wäscherin auch noch etwas hinzuverdiente, freilich nicht viel, aber immerhin. (Solche jüdische Wäscherinnen hat es noch zu meiner Zeit gegeben. Das waren wohl die Ärmsten hier in der Gegend. Manch eine brachte ihre kleine Tochter mit, und die half ihr dann beim Auswringen.)
So vergingen die Jahre. Der Fischer fing Fische, verkaufte sie auf dem Markt und ernährte schlecht und recht seine Familie. Nichts änderte sich. Bis er eines Tages einen Schtjuka fing, dessen Bauch einen merkwürdigen Höcker hatte, so, als wäre da etwas drin, was da nicht hineingehört, was aber auch nicht verdaut werden kann. Kurz entschlossen nahm der Jud sein Bitschka und schlitzte dem Fisch den Bauch auf. Da mußte er aber staunen! Denn zum Vorschein kam ein dicker schwerer Goldring mit einem grünen Stein.
Was sollte er nun tun? Einen solchen wertvollen Ring zu besitzen war gefährlich. Man konnte deswegen umgebracht werden, denn böse Menschen und Räuber gab es auch damals schon mehr, als man ertragen kann. So überlegte er hin und her. Seine Frau meinte, er solle in die Stadt gehen und den Ring einem jüdischen Juwelier verkaufen, denn dafür würde er, auch wenn der Käufer ihn – wie kann es auch anders sein? – ein wenig oder ein wenig viel übers Ohr haute, schönes Geld bekommen. Dazu aber meinte der Fischer, daß der Juwelier ihn sicher fragen würde, woher der Ring stammt – eine verständliche Frage, denn er könnte ja gestohlen worden sein –, und wenn er dann die Geschichte vom Schtjuka erzählen würde, käme sicher der Tschender, um ihn einzusperren. Und dann hätte er weder Ring noch Geld noch den Frieden des armen Mannes. Denn wer glaubt schon einem Jud, der behauptet, in einem Fisch einen Goldring gefunden zu haben.
Er überlegte etliche Tage, und dann entschloß er sich, den Ring zu verschenken, denn ein Geschenk bringt oft mehr Zinsen, als eine Summe Geld, die man ausleiht und dann möglicherweise nie mehr zurückbekommt. Er ging also eines Tages hinüber in einen schönen Marktflecken (so, wie unser Nagykároly hier, wo einst die Grafen Károly residiert haben, wer sich an sie erinnert, weiß, daß das großzügige Herren waren), und da stand eben auch ein wunderbares Schloß, umgeben von hohen alten Bäumen und einem großen schattigen Park.
Erst wollten ihn die Diener nicht vorlassen, sie meinten, ein armer Jud hat am Hof des Grafen nichts zu suchen. Doch er ließ sich nicht so ohne weiteres abweisen, und er gab auch kein Bakschisch, wie das damals auch schon üblich war, um vorgelassen zu werden. Er versuchte es eben nach unserer Art mit der Kunst des Bittens und des überzeugenden Redens. Das konnte er als Fischverkäufer, das hatte er sozusagen geerbt, das steckte ihm im Blut. Schließlich gaben die Diener nach und ließen ihn vortreten.
Der Graf saß gerade an einem schönen vergoldeten Tisch, rauchte Pfeife und trank aus einem feinen Kristallbecher Wein. Ein bißchen verwundert blickte er auf, als der Fischer vor ihm stand. Doch noch größer war seine Verwunderung, als dieser ihm den Goldring als Geschenk überreichte: das Geschenk eines armen Mannes... (die Reichen sind meist geizig, und wenn sie etwas verschenken, dann nur das, was ihnen selbst nichts mehr nützt, was sie sowieso wegwerfen würden; beim Geschenk eines Reichen muß du immer sehr vorsichtig sein und dreimal überlegen, bevor du die Hand ausstreckst, um das Geschenk zu nehmen, denn der Reiche schenkt dir oft nur dann etwas, wenn er von dir dafür einen viel teureren Gegendienst fordern kann; Vorsicht erspart dir Ärger und Sorgen).
Der Graf war sehr beeindruckt, von einem Fischer ein so kostbares Geschenk mir nichts, dir nichts zu erhalten. Aber er nahm es an, denn obwohl er ein Goj war, ein Ungar, kannte auch er das jüdische Sprichele: Wunn man dir gebt, nemm; wunn man dir nemmt, schraj. Er nahm. Dann aber rief er seine Diener herbei und sagte ihnen, daß sie diesem Mann einem Wagen mit zwei Pferden, zwei Milchkühe, eine große Truhe mit Kleidern für die Frau und die sieben Kinder, na, außerdem auch allerlei Hausrat und eine Nähmaschine (für die Frau, damit sie sich als Näherin Geld verdienen kann) geben sollten. Alles das als Gegengeschenk. So hatte der Fischer eigentlich einen recht guten Tausch gemacht, denn er hatte den Gegenwert des Ringes erhalten, ohne ihn dem Juwelier verkaufen zu müssen.
Man kann sich vorstellen, wie froh seine arme Frau war und wie gut sich die Kinder in den neuen Kleidern fühlten. Der Fischer aber wurde nun Fuhrmann, und damit verdient man bekanntlich viel besser als mit Fischfang.
Da gab es aber einen Nachbarn (ich will jetzt nicht sagen, ob er ein Madjare, ein Walach oder ein Slowake war, denn das ist in diesem Fall eigentlich ohne Bedeutung), und dieser Nachbar, ein Goj, sah nicht ohne Neid, daß es dem Jud so von einem Tag auf den anderen plötzlich sehr gutging, der war ja richtig wohlhabend geworden, und es juckte ihn, als hätte er Läuse unter dem Hemd, und eines Tages fragte er, woher der Reichtum komme.
Na, da erinnerte sich der Jud, wie oft der Nachbar ihn gedemütigt hatte, als er noch ein armer Fischer war, und er meinte, daß nun der Augenblick gekommen sei, sich ein bißchen zu rächen (das sollte man eigentlich nicht tun, aber immer nachgeben, vergessen und so tun, als wäre nichts gewesen, das geht auf die Dauer auch nicht, und so wollen wir es dem Fischer nicht verübeln, wenn er einen kleinen Rachegedanken hegte, eigentlich mehr ein Spaß, nichts Böses, was dem andern Leid bringen könnte). Er sagte dem Goj, daß er dem Grafen eine Katze geschenkt habe, und dafür hätte der ihn so reichlich belohnt.
Da nahm der Nachbar einen großen Krautsack und fing alle umherstreunenden Katzen ein, von denen es ja in jenem Dorf genug gab (längst hatten sie sämtliche Mäuse gefangen und gefressen), und er meinte, daß ihn dafür der Graf viel reicher belohnen werde. Und so ging er zum Schloß, das heißt, er fuhr zum Schloß, denn er besaß ja Pferd und Wagen.
Der Graf wunderte sich, als ihm wieder ein Bauer ein Geschenk überreichen wollte, und wahrscheinlich dachte er, die Welt habe sich plötzlich noch mehr zugunsten der Herrschenden und Wohlhabenden verändert. So ließ er den Bauern vortreten, und dieser öffnete den großen Krautsack, aus dem auch sogleich etwa ein Dutzend verwilderte Katzen heraussprangen und fauchend durch das Schloß liefen. Die Diener hatten große Mühe, die bösen Biester wieder einzufangen.
Dann aber kam das Gegengeschenk des Grafen: Er ließ den Bauern auf den Deresch legen, und ein Diener verabreichte ihm, so, wie das bis vor einiger Zeit noch üblich war, zwanzig Rutenschläge auf den nackten Hintern. Dann setzten ihn die Diener auf seinen Wagen, warfen den Sack mit den Katzenviechern drauf und verabreichten den Pferden ein paar kräftige Schläge, daß diese davonjagten – zurück ins Dorf.
Doch damit ist meine Maise noch nicht zu Ende. Die Geschichte hat noch kein Eck, sie geht noch ein bißchen weiter.
Eines Abends saßen mehrere Bauern in der Kotschma, darunter auch der Mann, der auf dem Deresch gelegen hatte. Und wie das so ist, wenn das einfältige Volk beim Schnaps beisammenhockt: Sie sprachen über dieses und jenes, und schließlich fragte ein kleiner Jud, ein umherziehender Ambulanter, wie der Fischer, bei dem er nie etwas verkaufen konnte, so plötzlich zu großem Reichtum gekommen sei? Denn jetzt hat er dessen Frau Tüchlein, Ringlein, Kettchen und was weiß ich noch alles verkauft, und die Gute hat nicht einmal viel gehandelt, sie hat bezahlt, wie eine Städterin.
Nun meinte der Bauer, der die Prügel eingesteckt hatte, er könnte sich am andern Juden rächen, indem er diesem Juden einen Streich spielt, und so sagte er, daß der Fischer dem Grafen eine Katze getragen hätte. Darüber wäre der Graf so froh gewesen, daß er ihn reich belohnt hätte.
Schon am nächsten Tag besorgte sich der Ambulanter eine schöne weiße Katze, die er von einer Witwe einhandelte – für eine Packung Wachskerzen und eine Flasche Lavendelwasser. Also ein ehrliches Geschäft, denn die Katze war wirklich ein wunderschönes Tier. Und mit ihr ging er nun zum Grafen.
Nun wollte es der Zufall, daß der Graf gerade keine Katze im Haus hatte und die Zahl der Mäuse wieder zugenommen hatte. So freute er sich über das schöne Tier und schenkte dem Ambulanter einen Wagen und ein Pferd, damit er nicht mehr zu Fuß durch die Gegend ziehen muß. Das war aber ein großzügiges Gegengeschenk, dann was ist schon eine Katze, auch wenn sie noch so schön ist, wert?! An jenem Tag aber, so scheint es, war der Graf wieder einmal freigiebig, denn die großen Herren sind, je nach Laune, mal so, mal anders.
Der Jud sah, daß er so rasch wie nur möglich verschwand, er bedankte sich, und da war er auch schon davongefahren, denn bei einem so ungleichen Tausch kann man nie wissen, ob der Großzügige auch bis zuletzt großzügig bleibt. Der Graf aber streichelte die schöne weiße Katze und freute sich an dem schmeichlerischen Tier, das nicht nur lieblich schnurrte, sondern obendrein noch Mäuse fing.
Irgendwann erfuhr auch der dumme Bauer, den die gräflichen Diener auf den Deresch gelegt hatten, vom Glück des Ambulanter, der inzwischen aber auch, wie der Fischer, als Fuhrmann sein Geld verdiente. Und da ärgerte er sich grün und blau, und er dachte sich, daß es wohl einen Grund geben könnte, warum ausgerechnet solche Leute wie der Fischer und der Ambulanter im Leben mehr Glück haben als er. Doch ob es tatsächlich einen Grund dafür gab, konnte er nie erfahren.
Das ist meine Maise. Sie könnte auch wahr sein, aber dann hätten der Fischer und der Ambulanter wohl nicht so reiche Geschenke bekommen, dann hätte man ihnen wahrscheinlich mehr genommen als gegeben. Und so ist und bleibt meine Geschichte eine Maise.
3. Schmil – gebojrn in a Hajbl
Einmal, das war noch vor dem Krieg, also vor dem Jahr ’40, denn danach bin ich ja nicht mehr herumgereist, einmal also saß ich in einer kleinen Kotschma oben in Wischnitz, ein jüdisches Hek, wo sich die Füchse gute Nacht sagten – damals, und heute wahrscheinlich immer noch: die Fuksn winschn a gite Nocht –, ich saß also in einer Kotschma, vor mir ein Gläsele Bronfn, denn was sollte man auch anders trinken? Gepanschten Wein? Dünnes Bier? Also, der getrajbte Bronfn war immer noch sauberer als das andere Zeug, was die Bauern dort durch die Kehlen gossen.
Und bei mir am Tisch saßen noch zwei Händler, die mit verschiedenen Geschäften unterwegs waren; was sie verkauften, kann ich nicht mehr sagen, es ist auch nicht wichtig, denn wir sprachen nicht von Geschäften, nachdem wir sehr rasch festgestellt hatten, daß keiner von uns dem anderen etwas verkaufen oder ihn gar über die Ohren hauen konnte. So wären also die beiden anderen für mich völlig uninteressant gewesen, wenn es sich nicht ergeben hätte, daß beide ganz gut erzählen konnten. Freilich, auch ich erzählte diese und jene Geschichte, und so war das ein ganz fröhlicher Abend, an den ich mich gern zurückerinnere.
Als dann keine Gäste mehr in der Stube saßen und auch die letzten betrunkenen ukrainischen und rumänischen Bauern gegangen waren, wobei der Wirt bei einem ein bißchen nachhelfen mußte – der Wirt war übrigens, wie könnte es auch anders gewesen sein, ein Jud, groß und kräftig, mit einem mächtigen Bart; wäre er klein und schwach gewesen, hätte er keinen Schejgez mehr hinauswerfen können, und seine Wirtschaft wäre in Schulden ersoffen –, der Wirt setzte sich also zu uns, und dann erzählte er eine Geschichte, wobei er immer wieder betonte, daß alles erfunden sei, und wir sollten nicht etwa glauben, eine bestimmte Bojarin, deren Gut in der Nähe lag, sei in diese Sache verwickelt gewesen.
Es ist die Maise vom Schmil, von dem man sagte: »Is er gebojrn in a Hajbl«, was heißen soll, daß er ein Glückskind war. Aber wie ist er zu seinem Glück gekommen? Davon will ich jetzt in dieser Maise erzählen.
In einem kleinen Dorf, nahe an einem herrschaftlichen Konak, lebte einst ein Mann, der Schmil hieß. Der andere Name ist nicht mehr bekannt, und es ist auch nicht wichtig, ob er Klein oder Müller geheißen hat. Wichtig ist, daß er sehr bald merkte, wie viele Dumme es auf dieser schönen Welt gibt, und wichtig ist, daß die Dummen, die mit Schmil zu tun hatten, nicht wußten, daß sie die Dummen sind, oder daß sie nicht merkten, daß der Schmil sie für dumm verkaufen konnte.
Der Schmil war das, was man einen Luftmenschen nennt; das ist einer, der Geschäfte abwickelt, die dann gar nicht stattfinden, der aber dann doch einen Gewinnst macht, einen kleinen oder einen großen, je nachdem wie wohlhabend der Dumme ist, mit dem er gerade ein Geschäft abgewickelt hat, das dann aber, ich sagte es bereits, eigentlich kein Geschäft ist; dazu braucht es ein wenig Grojßkajtmeschuggas und etwas mehr Masl.
Eines Tages legte sich Schmil ins Bett und nahm Abschied von seinen Freunden. Er sagte, er werde nun bald sterben, denn auf dieser Welt ist seine Zeit um, er spürt, wie das Ende naht, und vieles mehr sagte er. Und seine Freunde, die guten und die weniger guten, die Geschäftsleute, die er manchmal hereingelegt hatte, kamen und verziehen ihm, daß er vielleicht nicht immer ehrlich gewesen war.
Und so kam eines Tages die Bojarin vom Konak, deren Mann ein großer Balebos, ein mächtiger Gwir gewesen war, und der Mann war gerade vor einem Jahr gestorben. »Schmil«, sagte die Frau, deren Schejnkajt wie ein Bojm und deren Klugschaft wie ein Schpendl waren, »Schmil, ich wünsche dir ein schönes Leben auf der anderen Welt.«
»Ich danke Euch, gnädige Frau Bojarin«, entgegnete Schmil mit schwacher Stimme und schloß die Augen, als würde er gleich wegsterben ...
»Schmil, wenn du drüben sein wirst, im Reiche der Seligen, dann wirst du doch sicher auch meinen lieben Mann, selig soll er sein, dort antreffen.«
»Sicher, gnädige Frau, sicher, denn das Reich der Seligen ist nicht so groß, weil ja die meisten Menschen in die Hölle kommen, und die Seligen kennen sich alle«, antwortete Schmil, denn er ahnte, daß da vielleicht etwas für ihn herausschauen könnte.
»Würdest du dann nicht, lieber Schmil, für meinen Mann einige kleine Sachen mitnehmen, ein Paar warme Wollsocken zum Beispiel, auch warme Unterwäsche? Denn ich habe gehört, daß es im Himmel oft kühl und windig ist, besonders nachts, wenn die Sonne nicht scheint«, fragte nun die gute Frau.
Und Schmil, der Ganef, was meinst du, was hat der geantwortet?
»Gern, gnädige Frau, gern nehm ich alles mit, was Ihr dem gnädigen Herren schicken möchtet. Aber seid Ihr sicher, daß der gnädige Herr nicht viel mehr Sachen braucht als nur warme Wäsche?«
Und die Bojarin: »Woher soll ich das wissen?«
»Ja«, sagte nun Schmil, »wenn einer im Sterben liegt, so wie ich, dann ist er eigentlich schon mit einem Fuß auf der anderen Welt, und wenn Ihr mir erlaubt, heute nacht mit dem gnädigen Herren zu sprechen, dann kann ich ihn ja fragen, was er dort oben benötigt.«
»Tu das, Schmil, tu das«, freute sich die Frau.
Als sie dann am nächsten Morgen kam und ungeduldig wissen wollte, was ihr Mann im jenseits alles benötigt, sagte Schmil:
»Ja, gnädige Frau, der gnädige Herr läßt Euch schön grüßen, und er hat gesagt, er wird dem Herrgott persönlich erzählen, was für eine gute Frau er hat; das Himmelreich ist Euch dann sicher. Dann hat er auch gesagt, was ich ihm alles so mitbringen soll, wenn ich kann. Zuerst braucht er dringend einen schönen warmen Wintermantel, mit Pelz innen, denn wenn es auf der Erde schneit, ist es auch im Himmel recht kalt; dann braucht er eine Pelzjarmulke, wie sie die Herren tragen, denn er ist ja auch dort ein Herr, dann Stiefel, Stadtschuhe und zwei Anzüge, einen für Sonntag, wenn er zum Herrgott beten geht, und einen zum Spazierengehn. Ja, seine silberne Tabakdose möchte er, und dann noch etliche Sachen, ich hab mir alles aufgeschrieben, weil ich schon so schwach und vergeßlich geworden bin ... er sagte auch: Etwas Geld, nicht zuwenig, könnte er gut gebrauchen; wenn die Seligen eine Reise zu den Sternen machen, muß er immer zu Hause sitzen, weil er sich das nicht leisten kann. Auch dort bekommt man nicht alles umsonst...«
Die Bojarin hörte andächtig zu, die Tränen traten ihr in die Augen, und dann rief sie: »Schmil, alles, alles, was er sich wünscht, wird er bekommen! Aber kannst du, armer kranker Mann, das auch hinüberschleppen?«
»Werdet Ihr mich dafür bezahlen, denn es ist ja wirklich eine ungewöhnliche Arbeit, die ich da leisten muß. Aber ich tue es gern, das könnt Ihr mir glauben...«
Eines Tages war Schmil verschwunden und mit ihm das viele Gepäck, das er dem Gwir bringen sollte. Die Bojarin war glücklich, die Leute im Dorf aber redeten wie immer dieses und jenes seltsame Zeug, aber davon hörte die Bojarin in ihrem Konak nichts.
Ein Jahr später war sie einmal auf dem Jarmarok, dem Jarid – hier sagte der Wirt, das könnte in Radautz gewesen sein, aber in einer Maise darf man ja keine Wahrheit sagen, und so ist auch dieses nur erfunden –, und wie die gute Frau mit ihren beiden Mägden sich so durch die Menschenmenge drängte, was meinst du, wen sieht sie da? Wer steht da plötzlich vor ihr, lebendig und munter? Der Schmil!
»Was ist, Schmil, was machst du hier? Wie geht es meinem Mann?« fragte sie, und das war der Fehler: Sie stellte gleich zwei Fragen auf einmal, und so hatte der Schmil die Möglichkeit, die zu beantworten, die ihm angenehm war.
»Dem gnädigen Herrn geht es jetzt sehr gut, er läßt sich auch schön bedanken für alles, was Ihr ihm geschickt habt. Er hat auch dem Herrgott persönlich von Euch erzählt, was für eine gute Seele Ihr seid«, redete der Schmil schnell daher und wollte davonlaufen.
Doch die Bojarin fragte noch: »Und wieso bist du, Schmil, nicht oben bei ihm?«
»Auferstanden von den Toten, muß noch rasch einige Sachen erledigen, himmlische Aufträge sozusagen«, und damit verbeugte er sich höflich vor der Frau und verschwand in der Menge.
Die Bojarin nahm ein Schnupftüchl, wischte sich die Tränen, schneuzte dreimal und sagte zu den beiden Mägden: »Seht ihr, es gibt noch anständige Menschen. Er hat mit meinem Mann, selig soll er sein, amen, gesprochen und ihm die Sachen überbracht. Wer würde so etwas heute noch für einen anderen tun?«
4. Jossele und die Waldweibl
Dies ist eine jiddische Kaska, »a Kaskale«, wie meine Bobe – selig ihr Andenken – zu sagen pflegte, denn die Juden haben hier mehr Kaskale und Merale erzählt, keine Poweschtij, also Geschichten, die man zuerst von den Walachen gehört hatte und sie dann oft wiedererzählte.
Also: eine Kaska aus Kwaßtnitz, aus dem kleinen schönen Ort Kwastnize, wie unsere Leute sagten, und die Ruthenen sagten Kwastnitza. Wer weiß heute noch, wo das liegt? Niemand weiß es, denn Kwastnize hat man vergessen, so wie die paar Juden, die einst dort gelebt haben. Den Lemberger Itzhak, den man Itzig nannte, der war Kotschmar; dann der Hirsch Abraham, der hatte ein Gewelb, gerade an der Hauptstraße, die von unten aus Fischthal, dem kleinen deutschen Ort, heraufführte, dann waren noch einige jüdische Arbeiter mit ihren Familien, arme Leute, mit wenig Geld und vielen Kindern, der eine hieß Storch, und ein anderer Adler. Die beiden waren immer zusammen, und über die machten die Zipser Arbeiter immer ihre Witze: »Ssig, do kummen die peidn pårtign Vegl!« lachten sie, wenn der Storch und der Adler sich morgens beim Forstamt meldeten, um zur Waldarbeit zugeteilt zu werden.
Ja, Kwastnize, Kwastnize, vergessen hat man dich im tiefen Wald! Jemand hat mir erzählt, daß es heute in Kwastnize nur noch ein paar alte Baracken gibt, sonst ist dort nichts mehr los. Die meisten Leute sind gestorben, oder die, die den Krieg überlebt haben, die sind nach Poljan, Rußkij-Poljan, oder Poljane, wie die Ruthenen sagen – bei den Zipsern hieß der große Ort Reußenau –, die sind wohl nach Poljan gezogen, wo mehr los ist.
Also: das Kaskale aus Kwastnize – wie schön das klingt, wie ein altes Nigele, ein Liedele, »a Sangl«, und wenn ich sag »a Sangl«, dann kommt in mir schon die Erinnerung hoch, wie ein tiefer Schmerz, was hier drin sitzt, hier in der Brust, aber niemand kann das sehen, was da drin weh tut, nur ich weiß es. Und ich denke an die schöne Zeit, als es in Kwastnize oder in Poljan, manchmal auch drüben in Ruskowa, Musik und Tanz gab – Tanz bei den Juden, denn zwischen uns und den anderen wurde schon unterschieden: ein Jud ging nicht zu den Ruthenen, und der Ruthene kam nicht zu unseren Festen.
Also: Das Kaskale vom Jossele, dem spitzigen, ist eine Art Merale, das man sich ganz früher erzählt hat. Und das ging so:
Einst lebte, und das möchte vor sehr vielen Jahren gewesen sein, als die Menschen noch gut zueinander waren, als niemand fragte, ob man Jud ist oder Goj, also, das war zu jener Zeit, als die Menschen Ärger bekamen mit den Hexen aus dem Wald, den Waldweibln, mit den Wölfen, die im Winter bis in die Gehöfte kamen, mit den Bären, die ihnen die Schafe stahlen, mit den vielen Füchsen, die ihnen mal eine Gans, mal ein Huhn aus dem Hof schleppten, mit allen möglichen Tieren hatten sie Ärger, doch nicht mit den Nachbarn, so wie heute. Mensch verstand sich mit Mensch. Solche Zeiten waren das!
Damals lebte in Kwastnize ein jüdischer Knecht, den nannte man Jossele. Ich glaub, sein anderer Name war auch so was wie Storch oder Adler, und wenn ich mich jetzt richtig erinner, dann hat er Fink geheißen, einfach Fink. Dieser Jossele war bei einem reichen Händler beschäftigt, der ein großes Gewelb in Poljan hatte – kein Jud, ein Goj, denn die Juden hatten mehr kleinere Gewelber, sie lebten auch ein wenig vom Schmuggel, ein wenig von ehrlicher Arbeit und ein wenig einfach nur, weil sie halt spitziger waren als die Ruthenen und die Walachen.
Der Jossele wohnt aber in der Siedlung Kwastnize, und nur am Tag – nicht am Schabbat – war er immer bei seinem Herren. Abends ging er dann die vier Kilometer zu Fuß nach Hause, wo seine Frau auf ihn wartete – mit einem guten Machel, und das war alles sehr richtig und schön, denn unser Jossele machte niemals halt bei der Kotschma, er trank nicht, er rauchte nicht, er war ein sehr braver Mann. So sollte es ja auch sein. Leider aber ist es heute nicht immer so, und wegen den wenigen Juden, die es hier noch gibt, drüben in Poljan und unten in Wischno, da muß man sich manchmal schämen – schämen vor den Gojim, die ja auch nicht besser sind. Aber sollen wir uns mit ihnen vergleichen?! Behüt der Ojberschte!
Eines Tages nun sagte der Herr zum Jossele (und er sprach mit ihm deutsch, wie das früher die Herren hier taten, ungarisch oder deutsch), er sagte: »Jossele, mein Diener, was soll ich machen? Ich hab in der letzten Zeit jede Nacht Ärger. Da kommen irgendwelche Waldweibl von drüben, wo der Schlehdornberg steht, und die treiben allerlei Unfug in meiner Küche. Das lärmt so, daß ich einen schlechten Schlaf hab, wenn die bei mir im Haus sind. Hexen, verfluchte!«
»Wie kommens herein, die Hexen?« fragte der Jossele.
»Durchs Uhlenloch und durch den Rauchfang«, erwiderte der Herr, »da ist’s immer offen, und da kriechens herunter.«
»So, so«, sagte Jossele, und dann begann er zu klären, und das dauerte vielleicht eine ganze halbe Stunde, aber mehr nicht, und weil er recht spitzig war, setzte er sich auch sogleich an die Nähmaschine (die gehörte seiner Herrin, denn ein jüdischer Knecht besaß keine Nähmaschine, auch heute nicht, damals noch viel weniger). Und er nähte aus drei Ziegenhäuten einen Schlauch, schön rund, nicht zu eng, nicht zu weit, gerade so, daß ein Kind durchkriechen konnte. Dann wartete er.
Als es Abend wurde, kochte er frischen Leim, solchen, der langsam trocknet. Damit bestrich er nun ausgiebig innen alle Teile des Schlauchs, stieg auf den Dachboden und befestigte ihn genau über dem Herd, an der Stelle, wo der Rauchfang in die Küche führte. Weil aber der Leim sehr stark roch, stellte er daneben ein Fläschchen mit frischem Baldrianwasser. Das duftete auch ganz schön, und nun waren zwei Gerüche da, die man nicht mehr so genau unterscheiden konnte. (Um es anders zu sagen: Man hätte meinen können, da sitzt ein Zipser Holzfäller, der seine Botschkor ausgezogen und zum Lüften in die Sonne gestellt hat, und neben ihm sitzt ein ruthenisches Mädchen, das sich für den Tanz zurechtputzt und mit dem Riechwasser nicht sparsam umgeht.)
Nun kroch Jossele unter die Holzbank, die am Pripetschik steht, und dort kann man sich gut verbergen, das tun auch andere Männer, die nicht auf die Waldweibl warten. Jossele aber wartete. Und dann kam alles so, wie es kommen mußte.
Plötzlich hörte man ein Fauchen und Keifen, und wer nicht gewußt hätte, daß das die Hexen sind, der wäre wohl davongelaufen, denn es klang geradeso, als kämen hundert Teufel dahergeritten. Aber es waren nur etwa ein halbes Dutzend Waldweibl, und die kamen durch die Lüfte geflogen, dann durchs Uhlenloch und durch den Rauchfang (die wollten, wie bisher, in die Küche). Und plötzlich aber klebten sie im Schlauch fest, denn der Leim war von guter Qualität (mit dem heutigen Leim, dem aus dem Staatshandel, hätte Jossele das niemals geschafft, auf dem bleibt vielleicht eine Fliege haften, aber nicht ein ausgewachsenes Waldweibl).
Ojojoj! Auwaj, auwaj! Die schrien und jammerten, was sie konnten, es klang schrecklich, denn die Stimmen der Waldweibl sind nicht so lieblich und weich wie die Stimmen unserer Frauen, die ähneln mehr jenen von wilden Katzen, also, wer einmal im Wald gehört hat, wie die wilden Katzen schreien, der weiß es. So ging das eine ganze Weile: Ojojoj und Auwaj-auwaj!
Dann kroch Jossele rasch aus seinem Versteck hervor, stieg hinauf auf den Dachboden und band mit einem starken Seil beide Enden des Schlauches zu. Nun nahm er zwei feste Haselruten, die vorher einen Tag lang in Salzlauge gelegen hatten, und dann prügelte er los, was das Zeug hielt. Und die Waldweibl weinten im Schlauch und riefen: »Achwej, achwej! Loßt uns haraus, mir mechtn nie mer kimmen zuruck daher!«
Jossele drosch noch ein wenig weiter, dann sagte er: »Tjuh! « Denn eigentlich war er ein gutmütiger Mann, und totprügeln wollte er die kleinen Hexen auch nicht. »Wunn ihr mir varsprecht des, asu ich loß eich laufen.«
»Mir varsprechens! Mir varsprechens!« flehten die Waldweibl.
Da ließ Jossele sie aus dem Schlauch herauskriechen, was nicht so einfach war. Aber kaum waren sie draußen, flogen sie – huj! – wie aufgescheuchte Wildenten zum offenen Uhlenloch hinaus, zurück in den Wald. Und nun war Ruhe im Haus.
Am nächsten Morgen sagte der Herr zum Jossele: »Mein Kutscher, Aaron, ist schon alt. Ich werd ihm soviel geben, daß er bis an sein Lebensende ohne Sorgen leben kann. An seiner Stelle aber sollst du von nun an mein Kutscher sein.«
Jossele gefiel der Vorschlag, er nahm ihn dankend an und erhielt nun feine Kleider, einen schwarzen Rock und schwarze Stiefel, so, wie es sich für einen herrschaftlichen Kutscher gehört. Aber er blieb weiterhin ein guter Mensch, ging jeden Abend zu seiner Familie nach Hause und schaute niemals in die Kotschma hinein, wo die Ruthenen jüdischen Bronfen tranken und laut grölten. Jossele war eben ein spitziger Jud, und nur die Dummen und Faulen sitzen in der Kotschma und versaufen ihr bißchen Geld.
Und wenn er weiterhin so vernünftig gelebt hat, ist er auch sicher sehr alt geworden, hat viele Kinder und Enkelkinder gehabt und war, so der Ojberschte es wollte, ein glücklicher Mensch.
Mein Kaskale ist aus, dort lauft eine Maus; auch wann du zehn davon fangst, machst kejn Schtrejmel dir draus!
Das hat dann meine Bobe immer noch dazugesagt, und dann hat sie auch erzählt, daß ihr Mann, mein Großvater, nie einen Tropfen Bronfen in den Mund genommen hat. Aber das gehört jetzt nicht her, weil mein Großvater, selig, ich hab ihn nicht gekannt, ja auch ein Zaddik war, und kein Kutscher bei einem reichen Goj in Poljan.
5. Von der Frau, die ihrem Mann treu blieb
In meiner Kindheit hat man gesagt: Maises, Kaskale, Powstje oder wie die Zipser: Kschichtn. Mära, das war ein deutsches Wort, Mära hat man bei uns nicht erzählt. Und mein seliger Großvater, der Mosche, der hat meist jiddisch gesprochen und hat, wenn er etwas erzählte, so begonnen: »Chert, Kinderlech, a naje Maise...« Noch heute ist es mir, als würde ich seine Stimme hören.
Dann saßen wir den ganzen Abend auf der Ofenbank und hörten ihm zu: meine Schwester Reisele, mein Bruder Schamu und ich. Meine Geschwister, seligen Andenkens, sind beide längst tot, und wenn ich jetzt an sie und an Großvater denke, kommt mir alles wieder so in den Sinn, als wäre es gestern gewesen. Und ich muß sagen, daß meine schönste Zeit doch die Kindheit war, die Zeit nach 1923, denn 1940 begannen die Verfolgungen...
Wir saßen also abends in der Kuchl, am Pripetschik, und draußen schneite es, manchmal tagelang. Die Wölfe aber heulten von den Bergen, oben vom Tschunka klang es dann so, als wären sie schon in unserem Hof. Aber am Pripetschik war es schön warm, wir fühlten uns sicher, denn Großvater war nicht mit den Schafen unterwegs, er saß bei uns, und darum hatten wir auch keine Angst.
Vater war meist in der Stadt, in Sigeth, wo er irgendwelche Dinge kaufte oder verkaufte; wenn er zu Hause war, redete er nur von Geschäften, von Geld, und schimpfte über andere Leute, die ihn hereingelegt hatten. Mutter sahen wir auch nur abends spät, denn sehr früh am Morgen verließ sie wieder das Haus, und eigentlich kümmerte sie sich um uns nur von Freitagabend bis Montag in der Früh, sonst war sie vollauf beschäftigt mit ihrem kleinen Gwelb, oben im Tal, bei km fünf.
Es war also Reisele, die für uns kochte und die ganze Hausarbeit verrichtete, und dann war im Winter beinahe immer auch Großvater daheim. Ja, mein Großvater, der Mosche Gottesmann – oder, wie er in den Akten hieß: Gotteszmán Mózses Samu Adolf –, er war Schafhirte, »a jiddischr Tschoban«, wie man damals sagte (heute gibt es hier noch einen einzigen jüdischen Schafhirten, den Mosche Friedmann; früher waren viele Juden Tschobaner oder Brinsnmachr – aber das war einmal).
Mein Großvater Mosche zog im Frühjahr mit den Schafen hinauf ins Tal und blieb dort, bis der Herbst kam. Oben, seitlich vom Weiler Kleinkomann, war seine Kulibn, die Styna und der Zarck. Vor einigen Jahren konnte man die Stelle noch erkennen. Er machte herrliche Brinsn und Urda, manchmal auch Kasch; und das alles brachte dann der Joschi – Großvater rief ihn Jossel – am Dienstag auf den Markt zu der Pruckn, dort, wo auch heute noch das Marktgassl ist.
Der Brinsn, den Joschi verkaufte, der war entweder kugelrund geformt, an der Luft getrocknet und dann leicht geräuchert oder in ein Stück Tannenrinde gestopft; das war für die Christen. Für die Juden wurde der Brinsn anders zubereitet, und den brachte Joschi vorher zu der Gemeinde, in der Grußn Gass, am Platzl; der wurde dort verkauft.
Maises hat uns nur der Großvater erzählt, denn eine Großmutter haben wir nicht gehabt; die ist gestorben, als meine Mutter noch ein kleines Medelech war, und mein Vater war Waise. Manchmal hat Großvater selbst für uns gekocht, und das war unsere Lieblingsspeise – Chremsln mit Schofbrinsn. Von den Chremsln gibt es eine Maise; aber die habe ich schon einmal erzählt.
Dann war da noch die Maise »Von der Frau, die ihrem Mann treu blieb«; und immer, wenn Großvater die erzählte, mußte Reisele ein bißchen weinen. Und diese Maise will ich nun erzählen, so gut ich kann, denn seit ich sie zum letzten Mal gehört habe, sind bald sechzig Jahre vergangen...
Es war einmal ein reicher Kaufmann, der hatte eine junge wunderschöne Frau, doch was er noch nicht hatte, das waren Kinder (von denen gab es genug bei anderen, armen Leuten, er selbst konnte sich nicht an einem Sohn freuen).
So vergingen die Jahre, und immer wieder hoffte er auf Nachwuchs, und eines Tages sagte seine Frau, daß sie niederkommen wird, und darüber war er sehr glücklich. Bald gebar sie einen Sohn, der ähnelte ganz seinem Vater, und am achten Tag wurde er, so wie es das Gesetz verlangt, beschnitten, und mit drei Jahren kam er in den Cheder, und er lernte fleißig, und seine Eltern waren sehr zufrieden mit ihm.
Da geschah es, daß der reiche Kaufmann geschäftlich verreisen mußte, und bevor er losfuhr, bat er seinen besten Freund, auf Frau und Sohn zu sorgen, damit ihnen in seiner Abwesenheit nichts geschehe. Dann stieg er in seine Kaleaschka und fuhr davon.
Es verging einige Zeit, und da erschien eines Tages der Freund und sagte der Frau, sie soll ihren Mann vergessen





























