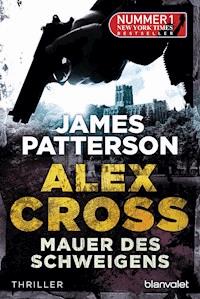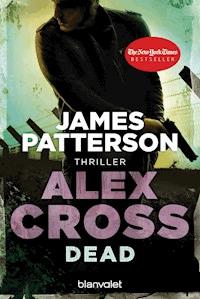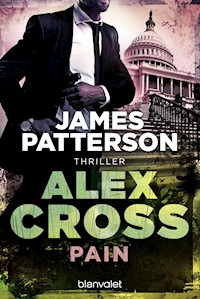
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Cross
- Sprache: Deutsch
Ein alter Widersacher hat es auf Alex Cross abgesehen und nimmt dessen Sohn ins Visier – eine rote Linie für Cross!
***Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie CROSS!***
Auf Wunsch des Verurteilten wohnt Alex Cross der Hinrichtung des Mörders Michael ›Mikey‹ Edgerton bei, den er gemeinsam mit Detective John Sampson hinter Gitter gebracht hat. Edgertons Familie ist hingegen weiter von dessen Unschuld überzeugt und schwört, Rache an Cross und Sampson zu nehmen. Kaum zurück in Washington werden die beiden zu einem Tatort gerufen. In der Küche ihres Hauses sitzt eine nackte Frau tot am Esstisch, auf dem Schoß eine Nachricht an Cross. In ihr wird angedeutet, dass Edgerton zu Unrecht verurteilt wurde. Unterzeichnet ist die Nachricht mit »M.« – für Cross kein Unbekannter, sondern ein langjähriger Widersacher. War Edgerton tatsächlich unschuldig oder spielt M. ein perfides Spiel mit Cross?
Der neue Pageturner von Bestsellerautor James Patterson lässt Sie atemlos zurück – rasant, nervenzerreißend und unerbittlich fesselnd! Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Auf Wunsch des Verurteilten wohnt Alex Cross der Hinrichtung des Mörders Michael »Mikey« Edgerton bei, den er gemeinsam mit Detective John Sampson hinter Gitter gebracht hat. Edgertons Familie ist hingegen weiter von dessen Unschuld überzeugt und schwört, Rache an Cross und Sampson zu nehmen. Kaum zurück in Washington, werden die beiden zu einem Tatort gerufen. In der Küche ihres Hauses sitzt eine nackte Frau tot am Esstisch, auf dem Schoß eine Nachricht an Cross. In ihr wird angedeutet, dass Edgerton zu Unrecht verurteilt wurde. Unterzeichnet ist die Nachricht mit »M.« – für Cross kein Unbekannter, sondern ein langjähriger Widersacher. Cross muss sich fragen: War Edgerton tatsächlich unschuldig, oder spielt M. ein perfides Spiel mit ihm?
Der Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N. Y.
Die Titel der Alex-Cross-Reihe:
Pain · Danger · Hate · Panic · Justice · Devil · Evil · Run · Dark · Cold · Storm · Heat · Fire · Dead · Blood · Ave Maria · Und erlöse uns von dem Bösen · Vor aller Augen · Mauer des Schweigens · Stunde der Rache
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
James Patterson
Pain
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »Criss Cross« bei Little, Brown and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 by James Patterson
This edition arranged with Kaplan/DeFiore Rights through Paul & Peter Fritz AG.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Umschlaggestaltung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Orhan Cam/Shutterstock.com und stock.adobe.com (merla, LIGHTFIELD STUDIOS)
JA · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-29098-6V001
www.blanvalet.de
1
Es war ein scheußlicher Nachmittag Mitte März, kalt und regnerisch. John Sampson und ich rannten zum Haupteingang des sechseckigen Greensville Correctional Center, einem Hochsicherheitsgefängnis im ländlichen Süden des US-Bundesstaates Virginia.
Wir duckten uns ins Innere des Kontrollpostens, zeigten unsere Dienstmarken und Ausweise vor und legten die Dienstwaffen ab. Ein Tor rollte beiseite, und wir gingen weiter.
Ich habe als Detective der Mordkommission bei der Metropolitan Police von Washington, D.C., sowie als FBI-Verhaltensforscher im Lauf der Jahre eine Menge Gefängnisse und Haftanstalten besucht, aber trotzdem werde ich immer noch jedes Mal nervös, wenn eines dieser Stahlstrebentore hinter mir ins Schloss fällt. Angeführt vom Gefängnisdirektor, Adrian Yates, sowie mehreren Journalisten, die bereits vor uns eingetroffen waren, mussten wir insgesamt sieben solcher Tore hinter uns bringen.
Eine Journalistin namens Juanita Flake ergriff das Wort: »Stimmt es eigentlich, dass das sein persönlicher Wunsch war?«
Der Direktor setzte seinen Weg unbeirrt fort.
»Können Sie …?«
Direktor Yates wirbelte herum und starrte sie unvermittelt an. Er schien seine Wut kaum bändigen zu können. »Ich will nicht mehr darüber sprechen, Miss Flake. Ich befürworte das alles in keiner Weise, aber es ist meine Pflicht, für eine ordnungsgemäße Durchführung zu sorgen. Wollen Sie es anders haben? Dann wenden Sie sich an den Gouverneur.«
Yates, der im Vorfeld von den Medien heftig kritisiert worden war, stellte sich vor das nächste Tor, das sich daraufhin beiseiteschob. Drei Tore später betraten wir einen Raum, der mit seinen etwa dreißig Sitzplätzen wie ein kleines Amphitheater wirkte.
Zwanzig Plätze waren bereits besetzt. Ich erkannte einen Großteil der Anwesenden, obwohl ich sie seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatte. Und sie erkannten uns ebenfalls. Die meisten nickten zur Begrüßung und ließen ein schwaches Lächeln sehen.
Eine dicht beisammensitzende Fünfergruppe verzog verächtlich das Gesicht, und ich war mir sicher, dass sie einander hämische Bemerkungen über uns zuraunten. Diese drei Männer und zwei Frauen waren sehr viel besser gekleidet als die übrigen Besucher.
Die Männer – zwei Brüder im mittleren Alter und ihr Vater – trugen maßgeschneiderte dreiteilige Anzüge. Die Frauen – eine Mitte sechzig, die andere Mitte zwanzig – hatten sich für holzkohlegraue Chanel-Kostüme entschieden. Ihre Frisuren saßen perfekt, und die Juwelen blitzten.
Vor einem lang gestreckten rechteckigen Fenster entdeckte Sampson zwei freie Plätze. Ein zugezogener Vorhang hinter den Fensterscheiben verdeckte die Sicht.
Fast im selben Augenblick begann ich mich zu fragen, ob es wirklich die richtige Entscheidung gewesen war hierherzukommen. Natürlich gab es gute Gründe dafür. Trotzdem kamen mir jetzt erste Zweifel.
»Sie haben ihn reingelegt«, hörte ich eine Frauenstimme sagen.
Ich hob den Blick und sah die ältere der beiden Modepuppen neben mir stehen, eine zierliche Frau mit aschblond gefärbten Haaren. Ihre auffallend stramme Gesichtshaut ließ vermuten, dass ihr ein hochbezahlter Schönheitschirurg zur Verfügung stand.
»Mrs. Edgerton«, erwiderte ich müde. »Das hat Ihr Sohn schon während des Prozesses und in den Berufungsverhandlungen behauptet.«
»Berufungsverhandlung, nicht Verhandlungen«, zischte Margaret Edgerton mir zu. »In diesem primitiven, mordlüsternen Bundesstaat steht einem ja nur eine zu.«
»Und der Oberste Gerichtshof von Virginia hat das Urteil wie auch das Strafmaß bestätigt, Madam.«
Sie bebte vor Wut. »Ich weiß nicht, wie Sie das angestellt haben, aber Sie haben es getan, so wahr ich hier stehe. Und ich bete zu Gott, dass Sie in der Gewissheit sterben müssen, einen unschuldigen jungen Menschen auf die andere Seite dieses Vorhangs gebracht zu haben.«
»Nein, Madam, dafür hat Ihr Sohn ganz alleine gesorgt, und zwar schon vor langer Zeit«, erwiderte ich.
»Er ist unschuldig.«
Direktor Yates sagte: »Wir müssen anfangen.«
»Mein Sohn ist unschuldig!«, rief Mrs. Edgerton. »Das können Sie nicht machen!«
»Das Gesetz zwingt uns dazu«, erwiderte Yates. »Aber ich habe volles Verständnis, wenn Sie nicht dabei sein wollen.«
Dann verließ er den Raum.
Sie funkelte mich wütend an. »Vergessen Sie diesen Augenblick niemals. Es ist der Augenblick, an dem Sie Ihre Seele verdammt haben. Sie werden in der Hölle schmoren.«
Damit stürmte sie davon und brach schluchzend an der Seite ihres Mannes zusammen.
Einige Bundesstaaten überlassen dem Verurteilten die Wahl der Hinrichtungsmethode. In Virginia kann man sich zwischen einer Giftspritze oder dem elektrischen Stuhl entscheiden. Der Vorhang wurde zurückgezogen und gab den Blick nicht etwa auf eine Trage, sondern auf einen schweren Eichenstuhl mit Arm-, Bein und Brustgurten frei.
Zwei Gefängnisbeamte betraten die Todeskammer, gefolgt von Direktor Yates. Dieser sah zu, wie seine Beamten die einzige andere Tür des Hinrichtungsraums öffneten.
Ein Mann Anfang vierzig mit rasiertem Schädel trat hervor. Er war groß und schlaksig und wirkte ein wenig benommen, als hätte man ihm ein Beruhigungsmittel verabreicht. Ohne den elektrischen Stuhl zu beachten, blickte er durch das Fenster zu uns nach draußen.
Dann richtete Michael »Mikey« Edgerton sich zu voller Größe auf und ging ohne Aufforderung zum Stuhl. Es war, als würde er das, was gleich geschehen würde, gutheißen.
»Mom, Dad, Delilah, Pete und Joe, wisst ihr, wieso ich mich für die Funkenmarie entschieden habe?«, war Edgertons Stimme durch die Sprechanlage zu hören. Er setzte sich, lachte und blickte mir anschließend direkt in die Augen. »Weil ich nicht wie ein kleines Kind einfach einschlafen will. Ich will, dass Cross und Sampson und alle anderen, die mich so dermaßen reingelegt haben, sehen, wie die Funken sprühen, wie der Rauch aus meinem Schädel quillt, wie die Haut an meinen Armen und Beinen aufplatzt, sobald sie mich mit ihren Stromschlägen quälen … mich, einen unschuldigen Menschen.«
Seine Mutter, sein älterer Bruder und seine Schwester brachen in Tränen aus. Nur sein Vater und sein jüngerer Bruder verharrten regungslos auf ihren Stühlen.
»Du hast es getan!« Das war eine Frau im mittleren Alter, die ganz in unserer Nähe saß. Sie trug eine Jeans und ein Sweatshirt mit dem Emblem des Georgia Institute of Technology. Jetzt sprang sie auf. »Du hast es getan, und du hast die Strafe verdient! Ich hoffe, du zerfällst zu Asche, sobald sie den Schalter umlegen, du krankes Arschloch!«
2
Mikey Edgertons makabrer letzter Wunsch ging in Erfüllung.
Bis jetzt hatte ich noch nie mit angesehen, wie ein Mensch auf dem elektrischen Stuhl gestorben war. Der Anblick, wie zweitausend Volt durch seinen Körper jagten, erschütterte Sampson und mich so sehr, dass wir, nachdem Edgerton für tot erklärt worden war und der Vorhang seines Lebens sich geschlossen hatte, kaum die Kraft hatten, uns von unseren Plätzen zu erheben.
Wir verließen die Zeugenkammer und versuchten, Edgertons Mutter zu ignorieren, die zwischen Nervenzusammenbruch und rasender Wut hin und her schwankte.
»Ich mache euch fertig für das, was ihr meinem Jungen angetan habt!«, kreischte sie einmal. »Ich nehme jeden einzelnen Cent, den ich besitze, und sorge dafür, dass ihr selbst auf diesem Stuhl hier endet.«
Wir mussten ihre Tiraden ebenso über uns ergehen lassen wie die wütenden Erwiderungen der Angehörigen von Edgertons Opfern, bis endlich das letzte stählerne Tor hinter uns ins Schloss fiel und wir in den Nieselregen und den Nebel traten.
Familie Edgerton war dicht hinter uns und ging zu ihrer bereitstehenden Limousine. Wir schlugen die entgegengesetzte Richtung ein und steuerten den Streifenwagen an, mit dem wir hergekommen waren.
»Dr. Cross? Detective Sampson?«
Ich drehte mich um und rechnete fest damit, dass mir irgendein Reporter ein Mikrofon unter die Nase hielt. Doch dann sah ich Crystal Raider vor uns stehen, die Frau mit dem Sweatshirt der Georgia Tech. Sie sah uns an, und auf ihrer Miene spiegelten sich die verschiedensten Gefühle und Gedanken.
»Das hat er extra gemacht«, sagte sie. »Um uns zu quälen. Um das Messer noch einmal in unseren Wunden zu drehen, nach allem, was er meiner Schwester und den anderen angetan hat.«
»Das stimmt«, erwiderte ich. »Und es hat funktioniert.«
Crystal reckte trotzig das Kinn. »Kann sein. Aber ich glaube auch, dass meine Kissy von irgendwoher zugeschaut hat, und dass es ihr gefallen hat, wie er abgetreten ist. Ich wette, die anderen Frauen sehen das genauso.«
»Gehen Sie nach Hause«, erwiderte ich mit sanfter Stimme. »Suchen und finden Sie Kissy in ihrem Jungen, und legen Sie das Ganze in die Kiste mit den schlechten Erinnerungen, die Sie nur ganz selten wieder hervorkramen.«
Sie fing an zu weinen und umarmte uns beide. »Vielen Dank, dass Sie sich so für sie eingesetzt haben, Dr. Cross, Detective Sampson. Sie haben sie nie verachtet, und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar.«
»Erotiktänzerinnen sind auch Menschen«, entgegnete Sampson. »Gute Menschen. So wie Ihre Schwester.«
Sie weinte weiter und brachte trotzdem ein schwaches Lächeln zustande, gefolgt von einem noch schwächeren Winken. Dann ging sie zu einem wartenden Pick-up mit Florida-Kennzeichen.
Während der dreistündigen Fahrt nach Norden saßen wir schweigend und beklommen im Wagen, jeder in seine Gedanken vertieft.
Erst kurz vor Washington, D.C., hörte es auf zu regnen. Sampson räusperte sich. »Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, Alex«, sagte er heiser.
»Das hat niemand. Bis auf Edgerton.« Ich musste einen Schauder unterdrücken.
Mein Freund seit ewigen Zeiten sah mich an. »Alex, im Moment weiß ich nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass wir der Gerechtigkeit zum Sieg verholfen haben, oder ob ich eher um Vergebung meiner Sünden beten sollte.«
Ich spürte ein Ziehen in der Magengegend, unterdrückte es und erwiderte: »Mikey Edgerton hat diese acht Frauen ermordet, und vielleicht noch mehr. Daran habe ich nicht den geringsten Zweifel.«
Während der sich anschließenden, langen Stille bog Sampson vom Interstate Highway 95 ab auf den Beltway, den Autobahnring, der ganz Washington umschließt, um mich nach Hause in die Fifth Street in Southeast Washington zu bringen.
»Zweifel habe ich auch keine«, sagte er endlich. »Aber trotzdem. Verstehst du?«
Ich musste schlucken. Bevor ich ihm eine Antwort geben konnte, summte mein Handy. Ich holte es aus der Tasche, erkannte die Nummer und nahm das Gespräch an. »Hier Cross«, sagte ich. »Wie geht es dir, Chief?«
»Das sollte ich eigentlich dich fragen«, erwiderte Bree Stone, Chief of Detectives der Metro Police und zugleich meine Ehefrau. »Aber ich habe keine Zeit dafür, und du auch nicht.«
Ich setzte mich auf. »Was ist los?«
Sie nannte mir eine Adresse in Friendship Heights und sagte, dass wir uns unverzüglich auf den Weg dorthin machen sollten. Nachdem sie mir auch den Grund dafür mitgeteilt hatte, verwandelte sich das Unwohlsein in meinen Eingeweiden in eine ekelhafte Übelkeit, wie dieser scheußliche Geschmack, der sich in der Kehle breitmacht, kurz bevor man sich von allem, was man den Tag über zu sich genommen hat, verabschieden muss.
»Wir sind unterwegs«, sagte ich und legte auf.
»Was ist denn los?«, wollte Sampson wissen.
»John«, erwiderte ich, und meine Stimme war nicht mehr als ein heiseres Flüstern. »Was in Gottes Namen haben wir getan?«
3
Wir fuhren nach Friendship Heights im äußersten Nordwesten von Washington, stellten den Wagen in der Forty-First Street ab und liefen den Bürgersteig entlang in die Harrison Avenue, wo ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blinklicht vor einer Absperrung stand.
»Welches ist es?«, wandte Sampson sich an den uniformierten Beamten.
»Das dritte auf der rechten Seite, Sir. Ein paar zivile Kollegen sind auch schon da.«
»Und es werden garantiert noch mehr werden.« Ich umging die Absperrung und näherte mich einem grauen Haus im Craftsman-Stil mit gepflegtem Vorgarten. Davor stand ein Transporter der Gerichtsmedizin.
Ich zählte drei uniformierte Beamte und dazu die beiden in Zivil gekleideten Nachwuchsdetectives Owen Shank und Deana Laurel.
Sie sprachen gerade mit zwei sehr aufgeregten Frauen Ende dreißig. Laurel sah uns, entschuldigte sich bei ihren Gesprächspartnerinnen und kam näher.
Sie berichtete uns, dass es sich bei den beiden Frauen – Patsy Phelps und Anita Kline – um Nachbarinnen der Familie Nixon handelte, die den Craftsman-Bungalow bewohnte. Gary Nixon war ein erfolgreicher Rechtsanwalt mit einer Kanzlei in der K Street. Er war mit seinen beiden kleinen Kindern für vier Tage zu seiner kranken Mutter nach San Diego gefahren. Katrina, mit der er seit fünfzehn Jahren verheiratet war, betrieb eine gut gehende logopädische Praxis und hatte sich nicht freimachen können.
»Die Nachbarinnen sagen, dass die Nixons immer zweimal am Tag miteinander telefoniert haben, ganz egal, wo sie gerade waren«, fuhr Detective Laurel fort. »Und als Mrs. Nixon weder heute Morgen noch heute Abend ans Telefon gegangen ist, hat Mr. Nixon bei Mrs. Phelps und Mrs. Kline angerufen und sie gebeten nachzusehen, ob bei …«
Detective Shank trat zu ihr und fiel ihr ins Wort. »Ich möchte keinesfalls respektlos wirken, Dr. Cross, Detective Sampson. Aber sind Sie sicher, dass Sie hier sein sollten? Ich meine, ist das nicht eine Art Interessenkonflikt?«
»Wir sind auf Befehl hier«, erwiderte Sampson. »Bringen Sie uns rein.«
Shank, ein zäher, drahtiger Mann, der früher bei einer Aufklärungseinheit der Marine gedient hatte, war zwar nicht gerade begeistert, aber er wusste, was Befehle waren. »Geradeaus, Sir.«
Detective Laurel kehrte wieder zu den Nachbarinnen zurück. Wir folgten Shank ins Innere des Hauses, dessen Inneneinrichtung im Wesentlichen von Pottery Barn und Toys »R« US stammte.
Shank berichtete, dass es keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gab. Das Haus war nicht besonders aufgeräumt, also genau so, wie man es bei einer jungen, wohlhabenden Familie erwarten würde, aber nirgendwo waren Hinweise auf einen Kampf zu entdecken. Ein kurzer Flur führte uns in eine Küche, wie man sie normalerweise nur auf Werbeanzeigen in irgendwelchen Gourmetzeitschriften zu sehen bekommt.
An der Tür des Edelstahlkühlschranks hingen Kinderzeichnungen und ein Kalender, auf dem die Nixons ihre Babysitter- und Arzttermine eingetragen hatten. Erst nachdem wir den Herd passiert hatten, sahen wir Spuren eines Kampfes.
Ein umgekippter Küchenstuhl. Eine zerbrochene Glasvase auf dem Fußboden neben dem Frühstückstisch. Dahinter befand sich das Wohnzimmer. Der Fernseher lief und verbreitete in dröhnender Lautstärke die Nachricht einer stetig zunehmenden Polizeipräsenz in der Harrison Avenue in Friendship Heights.
Der Leichnam von Katrina Nixon, die einmal eine hübsche braunhaarige Frau Ende dreißig gewesen war, lag am hinteren Ende des Zimmers nackt in einem dick gepolsterten Sessel. Ihre Haut war bläulich verfärbt und mit einem dünnen weißen Film bedeckt. Ihr Mund stand offen, als wäre sie bei dem Versuch zu schreien erstarrt. Ihre trüben Augen waren weit aufgerissen.
Es stank nach Bleichmittel. Die Mordwaffe, ein rot-violetter Hermès-Seidenschal, war mit enormer Brutalität um ihren Hals geschlungen worden.
Ein weißes Blatt Papier lag auf ihrem Schoß.
Während ich mich ihr näherte, hatte ich das Gefühl, als würde in meinem Inneren etwas zerbrechen. Ich las den Zettel und spürte, wie sich ein Teil von mir ablöste und in die Tiefe stürzte.
Sie haben es gründlich verkackt, Dr. Cross, aber lassen Sie sich deswegen keine grauen Haare wachsen, las ich. Letztendlich hat Mikey Edgerton mit seinem Ritt ins Jenseits genau das bekommen, was ihm für seine sündige Vergangenheit zusteht. – M
4
M.
Als ich zwei Stunden später vor meinem Haus ankam, war ich immer noch tief erschüttert. Es hatte aufgehört zu regnen, aber dafür wehte ein für Mitte März unnatürlich warmer Wind.
Bree saß auf der Schaukel auf unserer Eingangsterrasse. Sie hatte sich eine leichte Decke umgelegt und klopfte mit der flachen Hand auf den freien Platz neben sich. »Ist er echt?«, erkundigte sie sich.
Ich nickte und setzte mich. »Er hat ihn unterschrieben.«
Sie schwieg zunächst und sagte dann: »Dir ist schon klar, dass die Edgertons das als Beweis dafür verwenden werden, dass ihr Sohn in eine Falle gelockt wurde und jemand anders der Täter war.«
Empört ließ ich mich gegen die Lehne sinken. »Aber nur, wenn wir der Presse das mit M erzählen und das ganze Wirrwarr an die Öffentlichkeit kommt.«
»Nichts bleibt für immer geheim, Alex«, erwiderte sie und streichelte mir den Kopf.
»Genau davor habe ich Angst«, sagte ich. »Dann geht es plötzlich um mich.«
»Ihm geht es immer um dich.«
»Das ist mir klar. Es ist bloß so …«
»Was?«
»Verwirrend.«
»Mikey Edgerton war schuldig.«
»Das weiß ich«, erwiderte ich. Mein Blick fiel auf den dunklen Vorgarten unserer Nachbarn. »M spielt nur seine Spielchen mit uns. Was ist denn das da drüben?«
»Ein Gerüst. Morse hat gesagt, dass sie das Haus gründlich renovieren lassen wollen, und zwar innen und außen.«
»Noch mehr Lärm.« Ich war verärgert. »Und die ziehen einfach ein Jahr lang weg, damit sie nichts davon mitkriegen müssen.«
»Sie haben sich für ein gemeinsames Sabbatjahr entschieden.«
»Schön für sie.« Ich stand auf. »Jetzt habe ich Hunger.«
»Nana macht dir gerade etwas zu essen. Ich gehe schlafen. Könnte sein, dass morgen ein schwieriger Tag wird.«
Ich gab ihr einen Kuss, sagte ihr, dass ich sie liebte, und ging ins Haus.
Auf dem Fernseher im Wohnzimmer lief gerade Terriers, die momentane Lieblingsserie meiner siebzehnjährigen Tochter Jannie. Aus der Küche verbreitete sich Knoblauch-, Zwiebel- und Basilikumduft bis in den Hausflur.
All diese Gerüche und Geräusche beruhigten mich. Ich ging ins Wohnzimmer, wo Jannie in Joggingklamotten auf dem Sofa döste. Auf ihrem Schoß lag ein aufgeschlagenes Biologiebuch, und in der Hand hielt sie die Fernbedienung für den Fernseher.
»Hey, Schätzchen«, sagte ich und stupste sie behutsam an.
Jannie erschrak, wachte auf und drückte auf Pause. »Hallo, Dad«, erwiderte sie schlaftrunken.
»Schläfst du, lernst du, oder schaust du Fernsehen?«
»Alles drei.« Sie gähnte und grinste gleichzeitig.
»Das ist unmöglich.«
»Für die meisten Männer schon, aber die meisten Frauen können das.«
»Kannst du mir das ein bisschen genauer erklären?«
»Also, zum Beispiel letzte Woche, in der Schule. Da haben wir gelernt, was die neueste Forschung herausgefunden hat. Männliche Gehirne sind nämlich so aufgebaut, dass sie sich nur auf eine Aufgabe konzentrieren können. Sie können am besten und am effektivsten lernen, wenn sie eine Sache nach der anderen erledigen, also, immer erst ein Projekt und dann das nächste. Und in vielen Fällen hilft es ihnen, wenn sie sich dabei bewegen können. Also, beim Lernen, meine ich.«
»Aha. Und das weibliche Gehirn?«
»Frauen sind einfach fantastisch!«
Ich grinste. »Da stimme ich dir aus tiefstem Herzen zu. Aber wieso?«
Sie zeichnete mit ihrem Zeigefinger imaginäre Kreise um ihren Kopf. »Das weibliche Gehirn kann sich auf viele Dinge gleichzeitig konzentrieren. Meine Lehrerin hat gesagt, das ist wie beim Jonglieren. Während die Männer alles ausblenden bis auf die eine Sache, mit der sie gerade beschäftigt sind, können die Frauen immer noch alles hören, alles riechen und alles sehen. Und bekommen trotzdem noch alles erledigt!«
»Es sei denn, sie schlafen gerade.«
Sie lachte. »Okay, es sei denn, sie schlafen gerade.«
»Du kennst dich offensichtlich aus, das gebe ich gerne zu. Falls du zufällig mitbekommst, wie dein Bruder sich im Multitasking versucht, dann erklär ihm bitte das mit dem männlichen Gehirn und halte ihn davon ab. Okay?«
»Meinst du, er hört auf mich?«
»Vermutlich nicht«, erwiderte ich. Dann beugte ich mich zu ihr und nahm sie in den Arm. »Du hast mir gefehlt, Schätzchen.«
»Du mir auch, Dad.« Sie gähnte. »Keine Ahnung, wieso ich so schlapp bin.«
»Vielleicht gehst du heute Abend mal früh zu Bett.«
Sie nickte. Trotzdem wirkte sie irgendwie beunruhigt.
Als ich schon an der Tür war, rief sie mir hinterher: »Am Dienstagnachmittag ist mein erstes Freiluftrennen.«
»Habe ich schon im Kalender eingetragen, unter ›Auf keinen Fall verpassen‹«, sagte ich und betrat die Küche.
Am Herd stand meine über neunzigjährige Großmutter, eine passionierte Feinschmeckerin, und rührte in einer tiefen Pfanne.
»Ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es riecht unglaublich lecker.«
»Ein neues Hühnchenrezept«, erwiderte sie und klopfte den Kochlöffel auf dem Pfannenrand ab.
»Dad!«, ließ sich Ali aus dem Zimmer hinter der Küche vernehmen. »Das musst du dir anschauen!«
Nana sagte: »Er will dir unbedingt irgend so ein Mountainbikevideo zeigen. Vorher lässt er dich garantiert nicht essen.«
Ich hob beide Hände zum Zeichen, dass ich verstanden hatte. Mein jüngstes Kind, Ali, war zehn Jahre alt, ein ausgesprochen schlaues Köpfchen und ständig auf der Suche nach etwas Neuem. Und wenn er etwas gefunden hatte, was ihn interessierte, dann stürzte er sich wie ein Terrier darauf und ließ einfach nicht mehr los.
Seine neueste Leidenschaft war das Mountainbikefahren. Angefangen hatte es schon im letzten Jahr, als er sich von einem Freund ein Bike geliehen und sich dann eines zu Weihnachten gewünscht hatte.
Wir waren sehr erfreut darüber und haben ihm den Wunsch gerne erfüllt, da Ali, im Gegensatz zu seiner großen Schwester, nie Interesse gezeigt hatte, sich über das absolut Notwendige hinaus körperlich zu betätigen. Aber irgendetwas an diesem Fahrrad hatte seine Fantasie beflügelt, und jetzt war er ständig damit unterwegs, auch bei Eis und Schnee.
Als ich das Zimmer betrat, lag Ali lang ausgestreckt auf dem Fußboden vor seinem Laptop.
»Du bist spät dran«, sagte er mit einem enttäuschten Unterton in der Stimme.
Ich hob die Hände. »Kann nichts dafür. Warst du heute mit dem Rad unterwegs?«
Er nickte. »Die übliche Strecke um das Tidal Basin.«
Bree und ich liefen dort auch regelmäßig. Die Strecke war ungefährlich und belebt. Ich hatte ihm erlaubt, dort auch allein zu fahren, vorausgesetzt, er holte sich zuvor die Erlaubnis, und es war weder zu früh am Morgen noch zu spät am Abend. »Du wolltest mir etwas zeigen?«
Er drückte eine Taste an seinem Laptop. Der Bildschirm erwachte zum Leben, und ich sah eine Aufnahme aus der Helmkamera eines Mountainbikers, hoch über einer riesigen Stadt.
»Wo ist das?«, erkundigte ich mich.
»In Lima, Peru. Du wirst es nicht glauben.«
Der Radfahrer fuhr los und stürzte sich unmittelbar nach dem Start ein unfassbar steiles Treppenhaus hinunter. Dann schoss er nach draußen in die Sonne und befand sich auf einer etwa sechzig Zentimeter breiten Mauer. Links und rechts ging es senkrecht in die Tiefe.
Zahlreiche Menschen sahen zu, wie der Mountainbiker bis zum Ende der Mauer fuhr und von dort in die Luft sprang. Sieben, acht Meter tiefer landete er auf einem staubigen Pfad an einer Hügelflanke, die so steil war, dass ich schon dachte, er würde über den Lenker in den sicheren Tod stürzen. Aber er landete problemlos, wandte sich nach links, überquerte eine schmale Holzbrücke, fand einen Sprunghügel, hob ab und landete erneut auf einer Treppe. Gut vier Minuten dauerte der Wahnsinn, bis der Biker irgendwann stehen blieb und anfing zu lachen. Das Video hielt an.
»War das nicht irre?«, fragte Ali.
»Was war denn das?«
»Urban Downhill Mountainbiking.«
»Wow«, sagte ich. »Jeden Tag eine neue Sportart.«
»Das werde ich eines Tages auch machen«, sagte Ali feierlich.
»Aber nur, wenn ich es nicht verhindern kann«, ließ Nana sich aus der Küche vernehmen. »Alex. Dein Essen ist fertig.«
5
Anstatt mich mit Edgertons Hinrichtung, der erdrosselten Mrs. Nixon oder der neuesten Nachricht von M zu befassen, genoss ich Nanas fantastisches Pestohühnchen mit Schwarzbohnenpasta. Und ich sagte ihr, dass sie uns dieses Gericht unbedingt noch öfter servieren musste.
Ali marschierte mit unter den Arm geklemmtem Laptop durch die Küche.
»Bett?«, fragte ich ihn.
Er gähnte und nickte. »Dad, hast du eigentlich Wickr?«
»Äääh, ich glaube nicht.«
»Das ist so eine coole App, ein Messenger für Spione.«
»Tatsächlich?«
»Sie hat eine militärische Verschlüsselung«, fuhr er ernsthaft fort. »Wir könnten uns Nachrichten schicken, und niemand würde etwas davon mitkriegen, weil es so ein Selbstzerstörungsprogramm hat.«
»Das Handy zerstört sich selbst?«
»Nein.« Er rümpfte die Nase. »Die Nachricht. Oder das Telegramm. So nennen die das. Jedenfalls verschwindet es nach zwei Minuten. Das ist doch gut für Spione, oder nicht?«
»Wenn man gleichzeitig telefonieren und spionieren will, wahrscheinlich schon.«
»Soll ich es auf deinem Handy installieren? Das geht ganz einfach, und dann könnten wir … du weißt schon …«
»Uns wie Spione unterhalten?«
Er grinste und nickte.
»Ich denke darüber nach«, sagte ich und gab ihm einen Gutenachtkuss.
»Dad? Wenn Urban Downhill eine olympische Sportart werden würde, dann wäre ich bestimmt ziemlich gut.«
Ich musste lächeln. Dieser Junge hangelte sich ununterbrochen von einer Leidenschaft zur nächsten. »Ich glaube, du wärst in allem gut, was du gerne machst.«
Als Nana zu Bett gegangen war, räumte ich auf und ging ins Wohnzimmer. Jannie war schon lange auf ihrem Zimmer. Ich versuchte, mich auf ein Basketballspiel zu konzentrieren, und als ich schließlich nach oben ging, war es fast Mitternacht.
Bree schlief schon tief und fest, und ich schob mich unter die Decke. Trotz allem, was ich heute erlebt hatte, rückte der Schlaf schnell näher.
Doch als ich kurz vor dem Einnicken war, ertönte Hundegebell, und zwar in einer nervtötenden Folge: erst drei tiefe Laute, gefolgt von einer Pause und dann zwei oder vier deutlich höheren. Das Schlafzimmerfenster war offen, also stand ich auf und machte es zu, doch das Gebell war immer noch zu hören, wenn auch gedämpfter als zuvor.
Das ging nun schon fast einen Monat so, aber ich hatte noch keine Zeit gehabt, die Besitzer ausfindig zu machen und mich zu beschweren. Und jetzt war ich auch nicht in der Stimmung dazu. Also holte ich mir meine Ohrstöpsel und startete die Weißes-Rauschen-App auf meinem Handy.
Ich machte die Augen zu. Ohne es zu wollen, landete ich mit meinen Gedanken wieder bei M und den wenigen und sehr widersprüchlichen Dingen, die ich über ihn wusste.
Nur eines steht unwiderlegbar fest, dachte ich noch, während ich allmählich einschlief: Der Zettel, den er bei der erdrosselten Mrs. Nixon hinterlassen hatte, war kein Novum, mit dem er mich direkt verspottet hatte.
Er hatte es zum vierten Mal gemacht.
Innerhalb von zwölf Jahren.
6
Am nächsten Morgen, es war Samstag, gegen 7.00 Uhr, schlüpfte Ali Cross ins Schlafzimmer seines Vaters. Bree war schon aufgestanden und nach unten gegangen.
Ali ging auf die Seite seines schnarchenden Vaters und schüttelte ihn sanft an der Schulter. Alex erschrak und setzte sich verwirrt auf.
»Willst du vielleicht laufen gehen?«, erkundigte sich Ali. »Dann nehme ich das Mountainbike.«
Sein Vater ließ sich in die Kissen sinken und ächzte. »Ich habe kaum geschlafen, Kumpel. Ich glaube kaum, dass mein Körper so früh schon fit genug ist.«
Ali war enttäuscht, doch dann gab er seinem Vater einen Kuss auf die Wange und sagte: »Schlaf weiter. Wir gehen dann nächsten Samstag.«
Alex lächelte, und seine Lider senkten sich wieder.
Im Erdgeschoss entdeckte Ali Bree, die gerade eine Tasse Kaffee trank. Sie trug Arbeitskleidung.
»Du willst auch nicht mit mir laufen gehen?«, fragte er sie.
»Heute nicht«, erwiderte sie. »Ich muss die Aktenstapel auf meinem Schreibtisch abarbeiten.«
»Ich drehe meine übliche Runde, okay? Und ich nehme mein Handy mit.«
»Hast du deinen Dad gefragt?«
»Er liegt im Koma.«
Bree musste unwillkürlich lächeln. »Ich sage Nana Bescheid, sobald sie aufgestanden ist.«
Ali grinste. Er hatte nicht damit gerechnet, dass es so einfach werden würde.
Andererseits … er war schließlich zehn, fast schon elf Jahre alt, oder etwa nicht? Und er ging in die sechste Klasse, war ein Jahr weiter als die meisten Kinder in seinem Alter. Er konnte gut auf sich selbst aufpassen.
Er holte sein Mountainbike aus dem Schuppen hinter dem Haus und machte sich auf den Weg. Eigentlich fühlte Alex Cross’ jüngster Sohn sich am wohlsten, wenn er die Nase in ein Buch stecken oder im Internet irgendwelche Neuigkeiten aufspüren konnte. Aber er liebte sein Fahrrad, vor allem, wenn er damit irgendwo herunterspringen konnte. Die vorderen und hinteren Stoßdämpfer des Bikes waren absolut fantastisch.
Als er das Denkmal für Martin Luther King junior passiert hatte und am Westufer des Tidal Basins Richtung Süden fuhr, hatte er bereits zehn tolle Sprünge gemacht und war jedes Mal sicher gelandet. Er hatte den Weg fast für sich allein.
Er raste dem Denkmal für Franklin Delano Roosevelt entgegen, als er rechts des Pfades einen Mann neben seinem Fahrrad knien sah. Der Mann drehte sich um und winkte ihm zu, bedeutete ihm anzuhalten.
Aber es war zu spät. Ali hatte den Mann angeschaut und den Weg aus dem Blick gelassen, sodass er jetzt mit dem Vorderreifen über die Scherben einer zerbrochenen Glasflasche fuhr. Der Reifen platzte.
Ali verlor die Kontrolle über das Rad und landete unsanft auf dem harten Boden. Er war benommen und bekam keine Luft mehr.
Der Mann, der ihm zugewinkt hatte, war mit schnellen Schritten bei ihm. »Hast du dich verletzt?«
»Nichts Schlimmes.«
»Sehr schade, dass ich dich nicht rechtzeitig vor den Scherben warnen konnte«, sagte der Mann. Er sprach mit einem weichen Südstaatenakzent. »Aber bei mir hat es beide Reifen erwischt. Zum Glück ist den Felgen nichts passiert.«
Er war groß und durchtrainiert, trug eine Radlerhose und ein eng anliegendes Trikot mit der Aufschrift U.S. ARMED FORCES CYCLING TEAM. Seine Augen wurden von einer Sonnenbrille verdeckt, und auf seinem Kopf mit den kurz geschnittenen dunkelblonden Haaren saß ein Rennradhelm.
Er half Ali beim Aufstehen und sagte: »Ich bin Captain Arthur Abrahamsen.«
»Ali Cross.«
»Sehr erfreut, Ali Cross. Soll ich mir mal deinen Reifen anschauen?«
»Nein danke, Sir. Ich schiebe das Rad nach Hause. Kein Problem.«
»Du könntest vielleicht auch fahren.« Captain Abrahamsen lächelte ihn an. »Vorausgesetzt, der Reifen lässt sich reparieren. Ich kenne mich ein bisschen damit aus.«
Ali zögerte, doch dann zuckte er mit den Schultern und nickte. Es war natürlich sehr viel einfacher, nach Hause zu fahren, anstatt das Rad mit dem platten Reifen die knapp sechs Kilometer bis nach Hause zu schieben.
»Kannst du vielleicht die Scherben vom Weg räumen, während ich mir deinen Reifen anschaue?«, bat ihn der Captain. »Wir wollen schließlich nicht, dass noch mehr Leute einen Platten bekommen. Sonst können wir gleich einen Club aufmachen.«
»Na klar«, erwiderte Ali.
Abrahamsen hob das Vorderrad von Alis Fahrrad an und setzte den Reifen in Schwung.
Ali schob die großen Scherben mit der Seite seiner Turnschuhe ins Gras. »Sind Sie beim Militär?«
»Das bin ich, bei der U.S. Army«, erwiderte Abrahamsen ohne den Blick von dem Reifen zu nehmen.
»Und fahren Sie auch Rennen für die Army?«
»So etwas in der Art«, meinte er. »Ich darf zwar mit der Mannschaft trainieren, aber ich bin nicht gut genug, um mit ihr um die Welt zu fliegen und mein Land bei Wettkämpfen zu vertreten. Noch nicht.«
Das sagte er mit so viel Überzeugung und Nachdruck, dass Ali unwillkürlich lächeln musste. »Das ist toll.«
»Voll toll, wie mein Neffe immer sagt«, erwiderte Abrahamsen. »Und da ist das Loch.«
Er hielt den Reifen fest und zeigte Ali, wo die Glasscherbe ihn durchstochen hatte.
»Kann man das reparieren?«, wollte Ali wissen.
»Ich schätze mal, ich kann es flicken, sodass du bis nach Hause kommst. Aber dann musst du dir einen neuen Reifen und einen neuen Schlauch besorgen.«
Abrahamsen ging zu seinem Fahrrad. »Kannst du dein Rad so tragen?« Er schob den rechten Arm durch den Rahmen seines Fahrrads und hob es auf seine Schulter.
Ali nickte. Er hatte schon öfter gesehen, wie ein Mountainbiker auf diese Weise unwegsames Gelände überbrückt hatte.
»Aber wo gehen wir hin? Haben Sie kein Flickzeug dabei?«
»Doch, habe ich«, entgegnete er. »Keine Sorge. Alles, was wir brauchen, ist im Mannschaftswagen. Der steht unten beim Anleger. Möchtest du vielleicht einen Aufkleber von unserem Team haben, für dein Fahrrad?«
Die Vorstellung gefiel Ali. »Bis jetzt kenne ich keinen einzigen professionellen Fahrradfahrer.«
»Und du kennst immer noch keinen. Noch nicht. Na komm, beeilen wir uns. Ich habe um 12.00 Uhr eine Sitzung. Und ich schätze, deine Mutter wartet schon auf dich.«
»Nana Mama, meine Urgroßmutter«, erwiderte Ali und nahm sein kleineres Fahrrad ebenfalls auf die Schulter. Er wollte Captain Arthur Abrahamsen unbedingt demonstrieren, dass er es den ganzen Weg bis zum Anleger tragen konnte.
Der Captain lächelte. »Urgroßmutter? Willst du sie vielleicht anrufen? Um ihr zu sagen, wo du bist und mit wem? Damit sie sich keine Sorgen macht?«
Ali legte die Stirn in Falten und klopfte auf der Suche nach seinem Handy seine Taschen ab. »Als ich losgefahren bin, hatte ich es noch.«
»Hier«, meinte Captain Abrahamsen und reichte ihm sein eigenes Telefon. »Ruf sie an. Ich sehe inzwischen mal nach, ob es dir vielleicht bei deinem Sturz aus der Tasche gefallen ist.«
Ali nahm das Handy und wählte, während Abrahamsen zu der Stelle zurückging, wo sie beide gestürzt waren.
Es klingelte, und Nana nahm ab. »Hallo?«
»Nana? Ich bin’s, Ali. Ich habe einen Platten, und Captain Arthur Abrahamsen, der ist Radrennfahrer bei der Army, also, er hilft mir beim Flicken. Ich rufe dich von seinem Handy aus an.«
»Das ist aber nett von ihm.«
»Ich bin bald zu Hause«, sagte Ali noch und legte auf.
Dann drehte er sich um und sah Abrahamsen im hohen Gras knien. Der Captain stand auf und hielt ein schwarzes Handy in der Hand. »Ist es das?«
Ali stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Sein Vater hätte einen Anfall bekommen, wenn er das Ding verloren hätte. »Ja. Vielen Dank.«
Sie tauschten die Handys aus, und Abrahamsen sagte: »Hast du deine Urgroßmutter erreicht?«
»Ja.«
»Es ist schon besser, dass sie sich keine Sorgen zu machen braucht, findest du nicht?«
Ali nickte und war bereits wieder dabei, das Fahrrad auf die Schultern zu heben. »Viel besser, Sir.«
7
Am Samstagmorgen gegen 9.00 Uhr wachte ich endlich auf. Nachdem ich geduscht und mich angezogen hatte, ging ich nach unten auf die Eingangsterrasse, um die Zeitung zu holen. Da fuhr ein Transporter vor unserem Haus vor. Auf den Seitenwänden waren das Wappen der U.S. Army sowie etliche Bilder von radelnden Männern und Frauen zu erkennen.
Zu meiner Verblüffung kam Ali herausgesprungen. »Dad!«
Auf der Fahrerseite stieg ein Mann Anfang dreißig aus. Er trug eine Radlerhose und ein Sweatshirt mit der Aufschrift »U.S. Army«.
Er und Ali kamen gemeinsam die Eingangstreppe herauf, und Ali sagte: »Captain Arthur Abrahamsen ist fast Mitglied im Rennradteam der U.S. Army! Ich hatte einen Platten. Wir konnten ihn nicht flicken, deswegen hat er mich gefragt, ob er mich nach Hause bringen soll.«
Der Captain lächelte und streckte mir die Hand entgegen. »Arthur Abrahamsen. Sie haben einen bemerkenswerten Jungen.«
Ich erwiderte seinen Händedruck und lächelte. »Das stimmt. Danke für Ihre Hilfe.«
»War mir ein Vergnügen.« Abrahamsen kicherte leise. »Er hat mir eine Menge beigebracht, über viele verschiedene Themen.«
»Ich hoffe, er hat Ihnen nicht das Ohr abgeknabbert.«
»Nein, Sir«, erwiderte Abrahamsen. »Beide Ohren sind noch intakt. Dann hole ich mal sein Fahrrad aus dem Wagen. Ich fürchte, er wird einen neuen Schlauch und einen neuen Reifen brauchen.«
»Wir sind beide über Glasscherben gefahren und haben einen Platten bekommen«, sagte Ali, während Abrahamsen die Heckklappe des Transporters aufmachte.
Der Laderaum war vollgepackt mit Rädern, Reifen und anderen Ausrüstungsgegenständen und Ersatzteilen.
»Sind Sie wirklich hauptberuflicher Radrennfahrer im Militärdienst?«, fragte ich ihn, als er Alis Fahrrad heraushob.
»Er trainiert nur mit dem Team«, schaltete sich Ali ein.
»Und selbst das nicht in Vollzeit.« Abrahamsen machte die Heckklappe wieder zu. »Ich arbeite im Pentagon und auf dem Capitol Hill, darum muss ich versuchen, meine Trainingszeiten irgendwie dazwischenzuquetschen.« Er brachte das Fahrrad zu uns.
»Also dann, vielen Dank noch mal«, sagte ich. Wir gaben uns noch einmal die Hand.
Der Captain lächelte Ali an. »Es ist immer schön, auf einen Kavalleriekameraden zu treffen.«
Ali blickte ihn verwirrt an.
»Ich war früher bei der vierten Kavallerie der U.S. Army«, fügte Abrahamsen erläuternd hinzu. »Panzer. Aber ich fand schon immer, dass die Kavallerie in unserer Zeit lieber Fahrräder benützen sollte.«
»Mountainbikes!«, meinte Ali und grinste dabei.
»Ganz genau! Die haben mehr Ähnlichkeit mit Pferden.« Abrahamsen zeigte mit dem Finger auf ihn und zwinkerte ihm zu. »Alles Gute. Erfreut, Sie kennenzulernen, Mr. Cross.«
»Die Freude war ganz meinerseits, Captain«, erwiderte ich.
Abrahamsen setzte sich in den Transporter, winkte noch einmal und fuhr los.
»Das ist echt ein netter Mann«, sagte Ali.
»Sieht ganz so aus«, erwiderte ich und nahm sein Fahrrad.
»Was meinst du? Ob ich eines Tages in der Kavallerie sein kann?«, fragte Ali nachdenklich.
»Im Panzer oder auf dem Fahrrad?«
»Fahrrad.«
Ich hielt kurz inne, dann sagte ich: »Du kannst alles erreichen, was dein Herz begehrt, wenn du dich dafür einsetzt.«
8
Drei Tage lang ignorierte ich die Medienberichte über Edgertons Hinrichtung ebenso wie die Anschuldigungen seiner Angehörigen, dass Katrina Nixons Ermordung ein Beweis für Mikeys Unschuld sei. Am Dienstagmorgen stand ich in der Anmeldung des Bundesgefängnisses in der Mill Street in Alexandria, Virginia, unweit des Gerichtsgebäudes.
Die Beamtin des Sheriffbüros gab mir meinen Ausweis zurück und sagte: »Weiß Dirty Marty, dass Sie kommen?«
»Mr. Forbes hat selbst um dieses Gespräch gebeten«, erwiderte ich.
Die Beamtin, eine untersetzte Frau namens Estella Maines, schniefte nur und sagte: »Wir holen ihn gerne raus, Dr. Cross, aber ich weiß wirklich nicht, wieso Sie sich die Mühe machen.«
»Das ist der hoffnungslose Idealist in mir, Deputy.«
Maines lächelte beinahe und ließ mich passieren.
Ich betrat die Kabine und machte mir noch einmal bewusst, wie wichtig solche Besuche für mich waren. Als freier Berater der Metropolitan Police und des Federal Bureau of Investigation war ich zwar ein viel beschäftigter Mann, aber letztendlich fand ich nur in meiner Rolle als Therapeut wirkliche, echte Befriedigung.
Martin Forbes kam durch eine Stahltür geschlurft und nahm auf der anderen Seite der kugelsicheren Glasscheibe Platz. Er war Mitte vierzig und hatte schütteres Haar. Abgesehen von der weißen Schlangenlinie an der Unterseite seines Kiefers sah er völlig unscheinbar aus. Gleichzeitig war diese Narbe der einzige Grund, weshalb ich mich überhaupt zu diesem Besuch bereit erklärt hatte.
Es lag schon eine Weile zurück, dass Forbes für kurze Zeit bei der Verhaltensforschungseinheit des FBI angestellt gewesen war. Während unserer Zusammenarbeit damals hatte er genau denselben Ehrgeiz bei der Jagd nach Straftätern an den Tag gelegt wie ich.
Dieser Ehrgeiz hätte ihn selbst beinahe das Leben gekostet, meinem ehemaligen Partner beim FBI, Ned Mahoney, jedoch hatte er das Leben gerettet. Wir hatten gemeinsam Ermittlungen im Zusammenhang mit mehreren brutalen Morden in Arizona, New Mexico und Texas durchgeführt. Alle Anzeichen hatten für das Werk eines Serienmörders gesprochen, doch dann hatte sich herausgestellt, dass eine kriminelle Organisation dahintersteckte, die ganz bewusst falsche Indizien hinterlassen hatte, um ihre Spuren zu verwischen.
Mahoney war einer Zelle des Sinaloa-Drogenkartells zu nahe gekommen und eines Nachts in Tucson auf offener Straße entführt worden. Forbes hatte das Ganze beobachtet, war den Tätern gefolgt und hatte Ned befreit. Im Verlauf dieser Befreiung hatte einer der Schläger des Kartells versucht, ihm die Kehle aufzuschlitzen.
Jetzt griff Forbes nach dem Telefon auf seiner Seite der Abtrennung. »Vielen Dank, dass du gekommen bist, Alex.«
»Das ist das Mindeste, was ich tun kann.«
»Ich bin unschuldig.«
»Ich habe gesehen, dass du auf nicht schuldig plädiert hast.«
»Das stimmt«, entgegnete er. »Aber nicht, weil ich irgendwelche juristischen Winkelzüge im Sinn habe, Alex. Man hat mich reingelegt.«
Ich seufzte. »Du hast gesagt, dass du eine psychologische Beratung möchtest, Marty. Deshalb bin ich hier.«
»Weil ich wusste, dass du sonst nicht kommen würdest. Ich habe es nicht getan.«
»Aber du hast eine entsprechende Vergangenheit, Marty. Dein schlechter Ruf hat dich eingeholt.«
Forbes lief rot an, doch er bekam sich schnell wieder in den Griff. »Ich bin damals freigesprochen worden. Hast nicht du einmal zu mir gesagt, dass man, wenn man ein Feuer löschen will, den Flammen so nahe kommen muss, dass man sich verbrennen kann?«
»Das war Mahoney.«
»Na ja, jedenfalls bin ich kein Racheengel. Ich habe keine Ahnung, wer diese Schweinehunde auf der Jacht erschossen hat, aber sosehr sie es auch verdient hatten, ich habe nichts damit zu tun. Hundertprozentig.«
Ich schwieg zunächst und ließ mir den ganzen Fall mitsamt der Vorgeschichte noch einmal durch den Kopf gehen. Die Zeitungen hatten den ehemaligen FBI-Agenten »Dirty Marty« getauft, in Anspielung auf Clint Eastwoods Dirty Harry, einen Polizisten, der als einzelgängerischer Rächer das Gesetz in die eigenen Hände genommen hatte.
Es war damals um verschiedene Zwischenfälle mit Schusswaffengebrauch gegangen, und obwohl Forbes vor Gericht tatsächlich freigesprochen worden war, hatte das FBI ihn von seinem Posten als leitender Ermittler in Chicago abgezogen und an einen Schreibtisch in der Abteilung für Verbrechensanalyse in der FBI-Zentrale in Quantico versetzt. Vor seiner Versetzung hatte Forbes eine verdeckte Ermittlung in einem Sex-Sklavenhändler-Ring geleitet. Es war um mehrere Personen gegangen, die Frauen, aber auch junge Mädchen und Jungen, aus unterentwickelten Ländern über Kanada und Mexiko in die Vereinigten Staaten eingeschleust hatten.
Innerhalb von vierundzwanzig Monaten waren die Ermittler in die unteren Ebenen des Schleuserrings eingedrungen und hatten mehr als fünfzig Frauen befreit, die als Prostituierte kreuz und quer durch das Land gekarrt wurden. Bewacht wurden sie von gewaltbereiten Zuhältern. Diese befreiten Frauen hatten zwei Männer und eine Frau als die wahrscheinlichen Drahtzieher des Verbrechersyndikats identifiziert.
Nach Angaben der Zeuginnen handelte es sich dabei um einen Panamaer namens Carlos Octavio, der acht Sprachen fließend beherrschte, und Ji Su Rhee, eine Koreanerin, die neun Sprachen sprach. Ihre Aufgabe bestand darin, Länder zu bereisen, in denen Armut und Gesetzlosigkeit herrschten, um dort Kinder und junge Frauen einzukaufen. Der zweite Mann hieß Gor Bedrossian, ein Armenier mit guten Verbindungen sowohl in die USA als auch nach Russland. Er war vermutlich derjenige, der den Schmuggel und die Verteilung der Opfer organisierte und mit eiserner Faust dafür sorgte, dass niemand aus der Reihe tanzte.
Forbes hatte vor zwei Problemen gestanden. Zum einen hatte er keine konkreten Beweise gehabt, die auf eine Verbindung zwischen diesen drei angeblichen Drahtziehern und den versklavten und bei diversen Razzien überall im Land befreiten Frauen schließen ließen. Und zum Zweiten betraten diese drei nur selten, wenn überhaupt, US-amerikanischen Boden.
Vor seiner Versetzung aus dem aktiven Dienst war Forbes der Spur des Geldes gefolgt und hatte versucht, es bis zu den Köpfen des Syndikats zurückzuverfolgen, jedoch ohne Erfolg. Ein Jahr nach seiner Versetzung hatte er sich dann zwei Monate lang beurlauben lassen, um ein Buch über Sexsklaverei im 21. Jahrhundert zu verfassen.
Die Staatsanwaltschaft war überzeugt davon, dass er sich diese Auszeit in Wahrheit nur genommen hatte, um die Verdächtigen zu ermorden.
Sechs Wochen nach dem Beginn von Forbes’ Freistellung entdeckte die US-Küstenwache vor der Küste von Florida eine führerlos im Meer treibende Jacht, die Harén – spanisch für »Harem«. An Bord fand man sechs aufgedunsene, geköpfte Leichen, darunter auch die von Bedrossian, Octavio und Rhee. Sie waren allesamt erschossen worden.
Bei der Durchsuchung der Jacht entdeckte die Küstenwache in mehreren Zellen unter Deck sechzehn Teenagermädchen aus Brasilien, Kambodscha und Indien, allesamt dehydriert und fast verhungert.
Später sagten die Mädchen aus, dass vier Nächte zuvor Schüsse an Bord gefallen seien. Sie hatten gehört, wie ein Boot längsseits festgemacht hatte, was durchaus üblich war. In der Regel hatte es sich dabei um einen Käufer oder einen Verkäufer gehandelt.
Dann waren die ersten Schüsse gefallen, zunächst langsam und methodisch, dann jedoch immer wilder und unkontrollierter. Sie hatten gehört, wie das andere Boot abgefahren war, und dann hatte tagelang nichts als Stille geherrscht. Da die Jacht unweit der Grenze zu internationalen Gewässern aufgefunden worden war, hatte man das FBI hinzugezogen. Der Zustand der Leichname hatte die Ermittlungen zwar behindert, sie aber nicht zum Erliegen gebracht.
Jedes der sechs Opfer hatte aus nächster Nähe von hinten eine Kugel genau zwischen die Schulterblätter bekommen. Anschließend waren ihnen mit chirurgischer Präzision die Köpfe abgetrennt worden.
Später hatte man die Kugeln einer Waffe zugeordnet, die Forbes während seiner Zeit als aktiver Agent benutzt hatte. Ebendiese Pistole mit Kaliber vierzig war in einem Schrank in der Hütte in West Virginia gefunden worden, in die er sich zurückgezogen hatte, um sein Buch zu schreiben. Außerdem hatte das FBI auf der Jacht DNA-Spuren gesichert, die Forbes’ Anwesenheit dort belegten.
»Alex?« Forbes legte die Hand an das kugelsichere Glas. »Bitte, du musst mir glauben. Ich war das nicht. Ich bin reingelegt worden.«
»Von wem?«
Er zögerte. »Ich … weiß nicht genau … Ich kann es nicht sagen. Aber er nennt sich M.«
9
Um drei Uhr nachmittags stieg ich auf die Tribüne am Rand der Laufbahn der Coolidge High School. Ich hatte immer noch das Gefühl, als wäre ich während meines Gesprächs mit Martin Forbes in einer Art Zwischenwelt gelandet.
M?
Schon wieder?
Wie ist das überhaupt möglich?
Aber diese sechs Toten waren … genau wie …
»Alex?«
Ich hob den Blick und sah, dass Nana Mama mir zuwinkte. Sie trug eine Wollmütze und eine Wolljacke und hatte sich eine dicke Decke über die Beine gelegt. Es nieselte zwar nicht mehr, aber die Luft war immer noch kalt und feucht. Ali saß neben ihr und starrte fasziniert auf das Display seines Smartphones.
»Was habt ihr für einen Eindruck von ihr?«, erkundigte ich mich und setzte mich neben die beiden.
»Hab sie noch nicht gesehen«, erwiderte Ali, ohne einmal aufzublicken.
»Im Ernst?« Ich ließ den Blick über die Laufbahn und die Rasenfläche schweifen, wo die Athletinnen und Athleten aus unterschiedlichen Highschools sich gerade warm machten. »Das sieht ihr aber gar nicht ähnlich.«
»Ist dir eigentlich aufgefallen, wie müde sie immer ist?«, sagte Nana. »Sie bekommt nicht genügend Schlaf.«
»Sie ist siebzehn Jahre alt. Da ist es unmöglich, genügend Schlaf zu bekommen.«
»Dad«, meldete Ali sich zu Wort. »Kannst du mir dein Handy leihen? Meins ist ausgegangen.«
»Willst du etwas spielen?«
Er sah mich entrüstet an. »Nein. Ich will ein Buch lesen.«
Ich gab ihm mein Smartphone. »Was für ein Buch denn?«
Seine Daumen huschten bereits über das Display meines Handys. »Polizeiliche Ermittlungen: Eine Einführung in Grundlagen und Praxis, von Peter Stelfox.«
»Wo hast du das denn gefunden?«, wollte ich wissen.
»Online.«
»Du solltest lieber Bücher lesen, die deinem Alter entsprechen«, sagte Nana.
»Bücher, die meinem Alter entsprechen, finde ich langweilig.« Ali hob nicht einmal den Kopf.
Meine Großmutter warf mir einen durchdringenden Blick zu. Offensichtlich war sie der Meinung, dass ich eingreifen sollte. »Manchmal würde ich mir ein wenig Unterstützung wünschen«, sagte sie schließlich.
Bevor ich etwas entgegnen konnte, betrat Jannie die Laufbahn und trabte los. Sie trug eine Jogginghose und hatte die Kapuze ihres Shirts bis in die Stirn gezogen. Normalerweise waren die Schritte meiner Tochter von einer auffälligen Leichtigkeit und Elastizität, als würde sie bei jeder Berührung des Bodens zurückfedern. Mit dieser natürlichen Schnellkraft hatte sie das ernsthafte Interesse etlicher Trainer aus der ersten Division der National Collegiate Athletic Association, also des US-amerikanischen Hochschul-Sportverbandes, auf sich gezogen, und jeder einzelne hatte versucht, sie mit einem Stipendium zu locken.
Doch während Jannie das Tempo ihres Aufwärmlaufs kontinuierlich steigerte, sah ich, dass sie sich nicht mit den Ballen vom Boden abstieß, sondern den Fuß etwas weiter hinten aufsetzte. Dadurch wirkten ihre Bewegungen schwerfällig, aber Schwerfälligkeit war etwas, was man bei Jannie eigentlich niemals zu sehen bekam.
»Ist sie denn schon wieder am Fuß verletzt?«, wollte Nana Mama besorgt wissen.
»Hoffentlich nicht.« Ich stand auf und starrte durch das Fernglas, um sie besser sehen zu können.
Jannie hatte ein schwieriges Jahr zu überstehen gehabt, nachdem sie sich eines der beiden Sesambeine im rechten Fuß gebrochen hatte. Sie war operiert worden, und lange Zeit war unklar gewesen, ob sie sich vollständig davon erholen würde. Doch dann hatte sie sich nach dem Ende ihrer Leidenszeit in der Hallensaison mit ein paar beeindruckenden Zeiten zurückgemeldet.
Jetzt war ihr jedoch eindeutig anzusehen, dass irgendetwas nicht stimmte. Obwohl ich mir ziemlich sicher war, dass es nichts mit dem Fuß zu tun hatte. Sie hielt die Schultern waagerecht, und auf ihrer Miene waren keinerlei Anzeichen für Schmerzen zu erkennen.
Nur der Funke, der normalerweise in ihr brannte, der war nicht zu sehen.
»Hat sie vielleicht mal durchblicken lassen, dass es in der Schule nicht so gut läuft?«, fragte ich Nana Mama, als Jannie ihre Schritte verlangsamte und mit gesenktem Kopf, die Hände in die Hüften gestemmt, weiterging.
»Lauter Einsen bis jetzt.«
»Jungs?«
Ali kicherte. »Jannie verscheucht sie doch alle.«
Jetzt setzte sich Bree auf den freien Platz neben mir. »Habe ich sie verpasst?«
»Nein.« Erneut nahm ich das Fernglas und beobachtete meine Tochter. Mit unkonzentrierter, fast schon apathischer Miene ging sie zu ihrem Team.
Ich ließ das Fernglas sinken und umarmte und küsste Bree zur Begrüßung. »Schön, dass du’s geschafft hast.«
»Finde ich auch.« Sie lächelte. »Du hast geschrieben, dass du mir etwas Verrücktes erzählen willst?«
10
Ich hatte ihr tatsächlich etwas zu berichten, etwas nahezu Unglaubliches, was Forbes mir erzählt hatte. Etwas, dessen Auswirkungen sich bis weit über das Mysterium von M hinaus erstreckten.
»Es ist verrückt, und es ist kompliziert«, erwiderte ich.
»Was denn?«, wollte Ali wissen.
»Das geht dich nichts an, junger Mann«, beschied ihm meine Großmutter. »Warum liest du nicht etwas über diese Mountainbikes und wie man sie reparieren kann? So, wie Captain Abrahamsen es dir empfohlen hat.«
Ali legte den Kopf schief und lächelte. »Das ist eine gute Idee, Nana.«
»Wir reden später darüber?«, wandte Bree sich an mich.
»Ja. Ganz bestimmt.«
Ich verdrängte die Unterredung mit Forbes aus meinen Gedanken und konzentrierte mich wieder auf Jannie, die zuerst die vierhundert und anschließend die zweihundert Meter laufen sollte.
Bei ihren letzten Startvorbereitungen schien sie alles, was sie beschäftigt hatte, abgestreift zu haben. Sie ging zu ihrem Startplatz auf Bahn drei, machte ein paar schnelle Schritte auf der Stelle und ließ anschließend einige hohe Sprünge folgen.
»Das sieht gut aus«, meinte Bree.
»Auf den Punkt«, sagte Nana Mama.
Ich blieb stumm und beobachtete Jannie, wie sie zur Startlinie zurückging und sich in Position stellte. Bei »Fertig!« spannte sie die Muskeln, und als der Schuss ertönte, schnellte sie los.
Ihre Arme pumpten. Ihre Knie hoben und senkten sich. Jeder Schritt war federleicht und elastisch, und sie legte die erste Kurve in einem nahezu perfekten Rhythmus zurück.
»Sie liegt in Führung!«, kreischte Ali. »Sie schafft es!«
Am Ende der Kurve, als das Feld dichter zusammengerückt war, lag sie gut fünf Längen vor den anderen.
Diese Führung behielt sie auf der Gegengeraden bis zum Eingang in die Schlusskurve bei, doch bei der 300-Meter-Marke wurde ihr Kopf unruhig, und sie schien müde zu werden. Sie veränderte ihre Atemfrequenz.
Auf der Zielgeraden zog eine Schülerin aus dem höchsten Jahrgang einer anderen Schule an ihr vorbei. Man sah deutlich, dass Jannie noch einmal zulegen wollte. Aber sie konnte nicht.
Eine zweite Läuferin überholte sie, und dann noch eine. An vierter Stelle überquerte Jannie schließlich die Ziellinie. Noch nie seit ihrer Verletzung hatte sie so ein schlechtes Resultat erzielt.
Sie wurde langsamer, bis sie schließlich nur noch mit gesenktem Kopf weiterschlurfte. Ich war fest überzeugt, dass sie am Boden zerstört war, aber eigentlich machte sie vor allem einen verwirrten Eindruck.