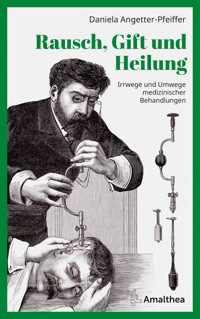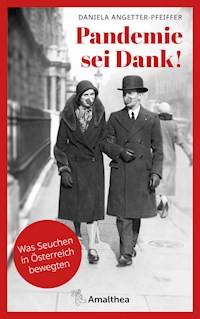
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Amalthea Signum Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Nicht alles ist hin." (Der liebe Augustin 2.0) Wussten Sie, dass Wiens berühmte Trinkwasserqualität, seine Kanalisation und die Gemeindebauten durch Pandemien entstanden? Dass Maria Theresia sich bereits im 18. Jahrhundert für Gratisimpfprogramme einsetzte oder die k. u. k. Armee einst als sicherstes Mittel zur Seuchenabwehr galt? Seit Jahrhunderten verändern Epidemien unsere Gesellschaft, doch zieht so manche Krise bleibende positive Resultate nach sich. Auch sind das Tragen von Masken, Quarantäne und Social Distancing keine Phänomene des 21. Jahrhunderts, sondern bereits seit dem Mittelalter bekannt. Medizinhistorikerin Daniela Angetter-Pfeiffer präsentiert zahlreiche Errungenschaften aus Österreichs Geschichte, die wir Pest, Cholera & Co. zu verdanken haben – mit überraschenden Parallelen zur Gegenwart. Mit zahlreichen Abbildungen Mit einem Vorwort von Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten/Wien
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DANIELA ANGETTER-PFEIFFER
Pandemie sei Dank!
Was Seuchen in Österreich bewegten
Mit einem Vorwort von Christoph Wenisch
Mit 42 Abbildungen
Besuchen Sie uns im Internet unter: amalthea.at
© 2021 by Amalthea Signum Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Johanna Uhrmann
Umschlagmotiv: © mauritius images/memento
Lektorat: Martin Bruny
Herstellung und Satz: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
Gesetzt aus der 11,25/13,75 pt Minion Pro und der Noto Sans
ISBN 978-3-99050-212-9
eISBN 978-3-903217-81-2
Inhalt
Vorwort
Einleitung: Wie Seuchen Österreich bewegten
»In Wien herrscht der Wind oder die Pest.« Ein mittelalterliches Sprichwort mit jahrhundertelanger Gültigkeit
Vom Seuchenkordon zur Sanitätskonferenz. Die Militärgrenze im Dienste der Volksgesundheit
Die k. (u.) k. Armee im Kampf gegen Epidemien
Die Impfung – ein Wagnis ins Ungewisse
Ignaz Semmelweis, der »Retter der Mütter«
Im Kampf gegen das »Schiffsfieber«. Die Novara-Expedition, Österreichs Weltumsegelungsmission
Die Cholera und der Bau der I. Hochquellenwasserleitung
Tuberkulose: Die Bekämpfung der »weißen Pest« durch Fürsorge und Tests
Die Spanische Grippe als Impulsgeber für das Wiener Gesundheitsamt
Maul- und Klauenseuche: Seuchenteppiche als probates Mittel und Symbol bis heute
Warum wir lernen müssen, mit Seuchen zu leben
Literatur
Bildnachweis
Namenregister
Die Autorin
Vorwort
Im Jahr 2020 wurde die Klinik Favoriten in Wien, das ehemalige Kaiser-Franz-Josef-Spital, zur ersten Anlaufstelle für Covid-19-Patienten. Historisch gesehen kam das nicht von ungefähr. Als 1898 nach Experimenten mit Pestviren in Wien drei Personen an der Pest erkrankten, isolierte und behandelte man sie im Kaiser-Franz-Josef-Spital. Ebenso wurde 2009 die erste Patientin in Österreich, die an Schweinegrippe litt, in diesem Spital betreut.
Auch wenn der Umgang mit Epidemien und Pandemien für Mediziner, insbesondere für Infektiologen, zu ihrem Arbeitsumfeld zählt, stellte die durch das Beta-Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöste Pandemie unsere Welt rasch vor große Herausforderungen. Erst nach und nach wurde evidenzbasiertes medizinisches Wissen zu Covid-19, der Erkrankung, die durch das neu entdeckte Virus verursacht wird, verfügbar. Aufgrund der kontinuierlichen Veränderung der Evidenzgrundlage mussten eine regelmäßige Aktualisierung und eine Anpassung der antipandemischen Handlungen erfolgen. Zum Maskentragen und den Lockdowns kamen schrittweise Testungen und in weiterer Folge Impfungen hinzu. Diese Maßnahmen betrafen nicht nur die Patienten und das betreuende Personal wie Ärzte und Pflegekräfte, sondern alle Menschen.
Die neue Erkrankung traf uns völlig unvorbereitet, die optimale Therapie war nicht bekannt, die Sterblichkeit hoch. Im Lauf der Pandemiebekämpfung musste einiges ausprobiert, vieles vermieden und manches gelernt werden. Im Spital etwa ging es um das Erkennen krankheitstypischer Phänomene wie der »happy hypoxaemia«. Dabei hatten Patienten zwar eine messbare schlechte Sauerstoffsättigung, aber trotzdem subjektiv keine Atemnot oder schnellere Atmung. Trotzdem waren sie in akuter Lebensgefahr, was die Anwendung von zweckmäßigen therapeutischen Maßnahmen unumgänglich machte. Gleichzeitig standen Überlegungen wie die Vermeidung von Intubationen und die Lagerungstherapie bei intubierten wie auch nicht intubierten Patienten (»awake positioning«, also die wache Bauchlage mit dem Ziel, die Aufnahme in einer Intensivstation und die mechanische Beatmung zu verhindern) im Vordergrund. Aber auch der Einsatz von Beatmungsgeräten, also das Zusammenspiel zwischen Patienten und Maschine, musste gut geplant sein, denn die Befürchtung, die Beatmungsgeräte in den Spitälern könnten knapp werden, war groß, ebenso wie die Gefahr von Sekundärschädigungen, darunter Lungenentzündungen durch Beatmungsgeräte. Weiters kam das Erkennen der Bedeutung der (Hyper-)Inflammation, also einer überschießenden Abwehrreaktion, die zu einem Schockzustand und einem Multiorganversagen führen konnte, und der Gerinnungsaktivierung hinzu.
Glücklicherweise wurden die antiviralen Therapien schrittweise besser. Mit der Zulassung mehrerer unterschiedlicher Impfstoffe steht uns heute das spezifische Instrument zur Beendigung der Pandemie durch die effektive Vermeidung von schwerer Erkrankung, Tod und Übertragung zur Verfügung. Und so zeigt sich auch diesmal, wie wiederholt in der Geschichte, dass die Impfung ein probates Mittel ist, um Infektionskrankheiten zumindest einzudämmen.
Trotzdem war und ist der Tod in Zusammenhang mit Covid-19 allgegenwärtig. Wie bei den in der Wissenschaft vielfach diskutierten fünf Phasen des Sterbens nach der schweizerischamerikanischen Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross (Leugnen/ Verneinen, Zorn, Verhandeln, Depression/Leid und zuletzt Akzeptanz) begann auch bei Covid-19 alles mit dem Nicht-wahrhaben-Wollen, dem Leugnen und Verharmlosen der Erkrankung – ein Phänomen, das immer wieder bei Pandemien auftritt. Viele Menschen behaupteten, es sei eine ärztliche Fehldiagnose gestellt worden oder Corona überhaupt eine Erfindung. Andere verharmlosten die Erkrankung und fragten sich, was all die Aufregung solle, bloß wegen eines »Chinaschnupfens«. »Corona gibt es zwar, aber mir kann nichts passieren«, waren viele überzeugt. Umgekehrt fühlten sich die von der Krankheit Betroffenen isoliert und unverstanden.
Immer noch empfinden Kranke und Angehörige von an Covid-19 Verstorbenen Neid auf Nichtbetroffene. Ihre Gedanken drehen sich um die Frage: Warum ich? Das kann zu Wut auf alle führen, die nicht unmittelbar an der Krankheit leiden und in der Lage sind, ihr Leben zumindest einigermaßen autark zu gestalten: zu arbeiten, ihre Pläne zu realisieren, zu reisen und ihre Freizeit zu gestalten.
Die Angst, dass ihr Schicksal vergessen wird, nagt an den Betroffenen. Durch Zorn und Gegenzorn entstand mitunter eine Spirale des Streits, die sich nicht zuletzt in Demonstrationen und Gegendemonstrationen äußerte. In der oft flüchtigen Phase des Verhandelns nach Kübler-Ross treten auch »kindliche« Verhaltensweisen zutage, etwa wenn man sich im Rahmen der Covid-19-Pandemie mit dem braven Einhalten der Regierungsmaßnahmen (Testung, Tragen von Masken, 3-G-Regel – gesundet, getestet, geimpft) eine Belohnung, also die Möglichkeit, auf Urlaub zu fahren, ins Theater zu gehen, im Schanigarten zu sitzen oder Angehörige zu treffen, erhandeln will. Einfach gesagt hofft man durch »Kooperation« auf Erleichterung, etwa eine Verkürzung des Lockdowns. Demgegenüber dominieren bei akut Betroffenen Erstarrung, Zorn und Wut, später Verzweiflung und Verlust. Sie müssen einen geschehenen Verlust, etwa die Verschlechterung der Lungenfunktion oder andere Corona-Spätfolgen und somit eine Einschränkung der Gesundheit, einen finanziellen Verlust aufgrund von Arbeitslosigkeit, einen Perspektivenverlust aufgrund von Einsamkeit oder Lockdowns realisieren. Darüber hinaus kann ein drohender Verlust beängstigend sein, wie die Unsicherheit, was die Zukunft bringt.
Nicht zuletzt spricht man im Zusammenhang mit der »Generation Corona« von Bildungsängsten und möglichen Chancenverlusten. Allerdings zeigt die Geschichte, dass Pandemien immer wieder Impulse für innovative Entwicklungen und Neuerungen waren, von denen Menschen wirtschaftlich, sozial und gesundheitlich profitierten, wie auch das vorliegende Buch aufzeigt.
Ohne das Kennen der Angst und der Verzweiflung ist kein Erreichen der Annahme von SARS-CoV-2, Covid-19 und seinen multiplen Folgen möglich. Erst durch die allseitige Annahme der objektiven Realität – »Okay, es gibt eine neue Infektionskrankheit auf der Welt, und ja, auch ich bin betroffen« – gelingt die Neuausrichtung. Mit dieser Perspektive können wir optimistisch weiterleben.
Christoph Wenisch,Leiter der Infektionsabteilungan der Klinik Favoriten in Wien
Einleitung:Wie Seuchen Österreich bewegten
Nicht erst seit Corona weiß man, dass Seuchen unser Leben verändern. Plötzlich wird das Wohnzimmer zum Büro, in dem Kinder spielen und unsere Aufmerksamkeit sowie Hilfe beim Schulalltag verlangen, während man sich auf Zoom-Meetings, Telefonkonferenzen oder virtuelle Tagungen konzentrieren sollte. Noch schlimmer ist es, wenn der einzige PC im Haushalt für Homeoffice und Homeschooling geteilt werden muss. Aber eigentlich muss man froh sein, wenn das Berufsleben während einer Pandemie weitergeht, denn die Schließung von Dienstleistungsbetrieben, Geschäften, Gaststätten, Hotels, Kultur-, Sport- und Freizeiteinrichtungen bewirkt eine steigende Arbeitslosigkeit, ein sinkendes Wirtschaftswachstum und die Schwächung der Regierung sowie der staatlichen Verwaltung.
Darüber hinaus kursieren Meldungen von überfüllten Spitälern, knappen Intensivbetten, einer notwendigen Triage bei der Aufnahme und Behandlung von Patienten und einem Mangel an Ärzten und Pflegepersonal. Dazu kommen strenge Gesundheits- und Grenzkontrollen. Auch wenn Maskenpflicht, Hygienevorschriften, Abstandsregeln, Quarantäne, Lockdown, Homeoffice, Homeschooling, Diskussionen um Impfpflicht und die Suche nach wirksamen Medikamenten sofort an Corona denken lassen, sind diese Auswirkungen von Pandemien keine Maßnahmen des 21. Jahrhunderts, sondern finden sich reihenweise in der Geschichte wieder.
Bei zahlreichen Erkrankungen waren Masken, Quarantäne und Social Distancing die einzige Chance, eine Ansteckung zu verhindern oder zumindest einzudämmen, wusste man doch bis zum 19. Jahrhundert kaum etwas über Viren oder Bakterien. Doch Viren und Bakterien hielten die Menschheit seit jeher in Atem, sie kennen keine Grenzen, weder territoriale noch soziale, schon gar keine politischen.
Insbesondere ab dem Zeitpunkt, als Europa mit der ganzen Welt in Kontakt getreten war, stieg die Verbreitung von infektiösen Krankheiten, denn Viren reisen gerne, und so wurde der weltweite Personenverkehr mehr und mehr zum Infektionsüberträger, ohne dass man es bewusst wahrnahm. Bereits am 14. Juni 1875 schrieb das Neue Wiener Tagblatt treffend: »Epidemien reisen gewöhnlich inkognito, ohne sich zuvor beim löbl[ichen] Sanitätsrath zu melden.« Am 22. September 1928 hieß es im Allgemeinen Tiroler Anzeiger: »Die Verbreitung der Seuchen erfolgte nicht etwa durch die Luft, sondern nur durch den Verkehr. Seuchen reisen nie schneller als der menschliche Verkehr.«
Bei Seuchen wie der Pest oder der Cholera dauerte es viele Wochen, bis sie von Asien nach Mitteleuropa kamen. Heute können Fernreisende hochinfektiöse und exotische Krankheiten innerhalb weniger Stunden global verbreiten. Eine Epidemie wird damit rasch zur Pandemie. Kurz gesagt gibt es Infektionskrankheiten, seitdem die Menschen sesshaft wurden, Pandemien, seitdem sie verstärkt reisen.
Zeiten, in denen Epidemien oder Pandemien grassierten, waren stets Zeiten der sozialen und wirtschaftlichen Veränderung, prägten ganze Landstriche und Stadtbilder sowie Bevölkerungsstrukturen, nicht zuletzt deshalb, weil Menschen vor den Krankheiten flohen und ganze Gebiete dadurch verödeten. Ist es heute Covid-19, so beeinflussten und veränderten früher Pest, Pocken, Cholera, Tuberkulose, Syphilis, Ruhr, Fleckfieber oder die Spanische Grippe, um nur einige Beispiele zu nennen, das Leben.
Bereits aus der Antike gibt es Aufzeichnungen über epidemische Krankheiten. Sie wurden damals unter dem Überbegriff »Pest« zusammengefasst, worunter man allerlei Infektionskrankheiten verstand. Dazu kamen Patienten mit diversen Hautkrankheiten, die sogenannten Aussätzigen. Sie waren beispielsweise vom Gottesdienst ausgeschlossen. Die Berührung eines solchen »Unreinen« war strengstens verboten, denn durch Körperkontakt bestand die Gefahr, selbst unrein zu werden und diese Unreinheit auf andere Menschen, Lebensmittel und Gegenstände zu übertragen. Absonderung und Meldepflicht galten daher schon in der Antike als die wesentlichsten Maßnahmen, um sich vor Ansteckung zu schützen.
Vielfach bekannt ist bis heute das Verhalten gegenüber Leprakranken. Sie vegetierten völlig ausgegrenzt und rechtlos an den Stadträndern, zusammengepfercht in den Leprosorien, und mussten sich durch auffällige Kleidung, mit Schellen oder Glocken öffentlich kennzeichnen.
Darüber hinaus verurteilte man ganze Völker, schuld an Pandemien zu sein, darunter vor allem die Juden, die angeblich für den Ausbruch der Pest verantwortlich waren genauso wie für den der Spanischen Grippe. Der Geologe Ami Boué (1794–1881) beschrieb dies in seinem Buch Die Europäische Türkei, erschienen auf Deutsch bei der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 1889, folgendermaßen: »Die Juden gelten für die schmutzigsten Leute, hauptsächlich wegen ihrer Gewohnheit die Speisen unmässig mit Knoblauch und Zwiebel zu würzen und wegen ihrer Unsitte, in übergrosser Anzahl unter demselben Dache zu wohnen.« Seine Beschreibung war kein Einzelfall, solche Verhaltensmuster sind bis heute erkennbar. Zu Beginn der Corona-Pandemie verdammte man asiatisch aussehende Menschen, weil sie die Infektion nach Europa gebracht hatten, danach wurden die Nachbarn in Südtirol zum Sündenbock, und letztlich schaute man jeden schief an, der im Supermarkt, bei der Bushaltestelle oder auf einem öffentlichen Platz hustete, nieste oder sich schnäuzte.
Neben der Isolation von Kranken und der Ausgrenzung von potenziell Gefährdeten oder Infektiösen aus der Gemeinschaft war die Flucht vor ihnen lange Zeit eine bewährte Vorsorgemaßnahme. Nicht nur zu Zeiten der Pest flohen Mitglieder des Kaiserhauses, hochrangige Persönlichkeiten, aber auch Ärzte aus Epidemiegebieten. Zurück ließen sie die sozial niedriger gestellten Einwohner, einzig und allein dem Schutz Gottes anvertraut. Ihnen blieb nur, durch Gebete, Beschwörungen, Opfergaben und Spenden an die Kirchen, um Heilung für die Kranken und Erhaltung der Gesundheit zu bitten.
Epidemien und Pandemien sowie der Umgang mit ihnen begleiteten uns bis ins 21. Jahrhundert, denn Infektionen verschwanden selten: 2003 verängstigte SARS die Welt. 2009 war die Furcht vor der Schweinegrippe groß. Da nur wenige Tausend Menschen in Österreich an der Schweinegrippe erkrankten, wurde Kritik laut, für nichts und wieder nichts Angst geschürt und unnötig Steuergelder für das Medikament Tamiflu verschleudert zu haben. 2020 kam Covid-19.
Selbst wenn wir uns dank diverser am Markt befindlicher Medikamente und vor allem zahlreicher Impfstoffe lange Zeit in Österreich sowie in Mittel- und Westeuropa kaum mit Pandemien befassen mussten, gab es wohl keine Phase in der Geschichte, in der weltweit nicht irgendwo irgendeine Seuche grassierte. Nicht selten werden bestimmte Gegenden mit Epidemien in Verbindung gebracht. So wurde die »Spanische Grippe« oft fälschlicherweise mit dem beliebten Urlaubsland assoziiert, während sie vermutlich in den Vereinigten Staaten oder in China ausgebrochen war. In Indonesien hingegen wurde sie als »Russische Grippe« bezeichnet. Die Polen titulierten sie als »bolschewistische Krankheit«, die Dänen dachten, sie käme »aus dem Süden«, die Bewohner Brasiliens nannten sie die »Deutsche Grippe«, während sie umgekehrt für die Senegalesen als »Brasilianische Grippe« bekannt war. Die Syphilis war in Frankreich als »Spanische Krankheit«, in Deutschland als »Französische Krankheit« und in Polen als »Deutsche Krankheit« namhaft. SARS-CoV-2 galt wahlweise als amerikanisches oder als »Wuhan-Virus« »made in China« oder auch als »kung flu«. Dieser Stigmatisierung einzelner Länder setzte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eigentlich ein Ende, denn seit 2015 dürfen sich laut WHO Krankheitsnamen nicht mehr auf Orte, Menschen, Tiere oder Nahrungsmittel beziehen – eine Regel, die für US-Präsident Donald Trump 2020 in Bezug auf Corona nur Schall und Rauch war.
Anhand ausgewählter historischer Beispiele soll in diesem Buch der Ausbruch von Seuchen in Österreich und Mitteleuropa sowie ihr Einfluss auf medizinische, gesellschaftliche, aber auch soziale Entwicklungen aufgezeigt werden. Jede Epidemie hat, wenn man so will, ihre eigenen Gesetze, ihre eigene Geschichte, eng verbunden mit den gesellschaftlichen Voraussetzungen, den jeweiligen historischen Ereignissen, mit dem Stand der medizinischen Forschung und mit den Möglichkeiten der Kommunikation. Aber sie hat auch ihre eigenen Verschwörungstheorien: von der Geißel Gottes über ein Geheimprogramm biologischer Kriegsführung bis hin zu gefälschtem Aspirin oder der Schuldhaftigkeit der Impfungen. Selbst während Corona verbreiteten sich manche Fake News schneller als das Virus selbst, wie etwa die Aussage, Chinesen, Amerikaner oder Juden hätten das Virus bewusst in die Welt gesetzt und mit der Impfung würde den Menschen ein Chip eingesetzt werden.
Dennoch waren es gerade Seuchen, die in Österreich immer wieder die Anregung für innovative Maßnahmen boten und von deren Impulsen wir bis heute profitieren. So fremd und bedrohlich der Ausbruch einer der weltweit drastischsten Seuchen, der Pest, erschien, so verdankt Wien dieser Pandemie ihr erstes Stadtgesundheitskonzept sowie eine Vorform der heutigen MA 15, dem Gesundheitsdienst der Stadt Wien. Die Pest war neben anderen Seuchen wie der Cholera oder dem Fleckfieber auch Anstoß für den Cordon sanitaire an der habsburgischen Militärgrenze gegen das Osmanische Reich. Jahrhundertelang sorgte dort die k. k. Armee für ein Einreiseverbot von Infektionsträgern, infizierten Waren oder Tieren und versuchte so, Österreich und Europa rigoros vor Erkrankungen aus dem Osmanischen Reich zu schützen. Wer sich den strengen Quarantänemaßnahmen widersetzte, dem drohte die Todesstrafe.
Der Erfolg sprach für diese Maßnahmen, die Pest konnte eingedämmt werden, die Entwicklungen an der Militärgrenze führten zu internationalen Sanitätskonferenzen, mit der Intention, europaweit gemeinsam gegen Epidemien vorzugehen.
Auch in den nachfolgenden Jahrhunderten spielte das Heer eine wichtige Rolle in der Seuchenbekämpfung. Gerade Soldaten, die oft auf engem Raum zusammenleben mussten und im Gebiet der Monarchie an verschiedenen Kriegsschauplätzen stationiert waren, sahen sich der Gefahr ausgesetzt, an Infektionen zu erkranken. Das Militär war daher ein probates Mittel, Epidemien rechtzeitig zu erkennen und nicht nur die eigenen Angehörigen zu schützen, sondern auch im Rahmen der Volksgesundheit zu wirken. Besondere Anforderungen an die Kriegschirurgie und die Kriegshygiene stellte der Erste Weltkrieg. Wenn fast nichts mehr ging, wurde Triage nötig.
Quarantäne, Isolation und Desinfektion waren nicht das Allheilmittel gegen Seuchen allein. Viel versprach man sich von Impfungen. So drängte die selbst von den Blattern gezeichnete Erzherzogin Maria Theresia (1717–1780) auf umfassende Schutzimpfungen für ihre Bevölkerung und setzte damit den ersten Impuls für Gratisimpfprogramme. Dass die Pocken letztlich mithilfe der Impfung besiegt werden konnten, ist als bedeutendes Beispiel für die Wirksamkeit von Immunisierung zu verstehen, thematisiert aber gleichzeitig die Frage nach Freiwilligkeit oder Impfpflicht.
Nicht nur durch Impfungen kann sich jeder Einzelne schützen. Händehygiene gilt ebenfalls als wichtiger Beitrag zur Vermeidung von Ansteckung bei Epidemien. Der Vorreiter in der Händedesinfektion Ignaz Semmelweis (1818−1865) konnte zwar viele seiner Kollegen nicht überzeugen, aber der »Retter der Mütter« wurde zum Wegbereiter in der Bekämpfung der Krankenhauskeime.
Die Angst vor Keimen war dann besonders groß, wenn viele Menschen dicht zusammengedrängt waren. Selbst wenn Österreich nicht als die große Seemacht galt, in Hinblick auf Seuchen und Epidemien leistete die von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien ausgerichtete Weltumsegelung der Novara einen wichtigen Beitrag zur Seuchenprophylaxe. Wie gelang es, fast 400 Menschen zwei Jahre lang an Bord eines verhältnismäßig kleinen Schiffes gesund und einsatzfähig zu erhalten und noch dazu wesentliche medizinische Erkenntnisse aus großteils unbekannten Gebieten zu gewinnen und in die Heimat zu bringen?
Die Versorgung mit ausreichendem, gesundem Trinkwasser beschäftigte nicht nur die Verantwortlichen der Novara-Expedition, sondern auch Ärzte und Geologen in Wien. Cholera, Typhus und Ruhr forderten moderne Konzepte, wie Wiens Bevölkerung mit qualitativ hochwertigem Trinkwasser versorgt werden könnte. Der Geologe Eduard Suess (1831–1914) hatte die zündende Idee, das Wiener Wasser ist bis heute weltberühmt.
Neben Eduard Suess erlangte Julius Tandler (1869–1936) internationale Bekanntheit. Er setzte mit dem sozialen Wohnbau und anderen Fürsorgeeinrichtungen wichtige Akzente im Kampf gegen die Tuberkulose.
Eng mit dem Ende des Ersten Weltkrieges ist der Ausbruch der Spanischen Grippe verbunden. Hier spannt sich der Bogen von der Pest zur weiteren Etablierung der Gesundheitsfürsorge.
Hatte man Epidemien dann weitgehend vergessen, so war Ostösterreich Anfang der 1970er-Jahre von der Maul- und Klauenseuche betroffen. Die damals getroffenen Maßnahmen an Flughäfen entsprachen vielfach den Maßnahmen während der Corona-Pandemie, und der heute noch oft im Bewusstsein der Bevölkerung vorhandene Seuchenteppich kam 2020/21 erneut zum Einsatz.
Auch wenn Corona derzeit unser Leben auf den Kopf stellt und viele tragische Einzelschicksale uns bewegen, so zeigt die Geschichte, dass die Gesellschaft Krisen oft besser bewältigt, als sie es sich in der jeweils aktuellen Situation zutraut. Man muss aus der Geschichte nicht lernen, aber vielleicht hilft sie, die Gegenwart besser zu verstehen und zu akzeptieren, weil sie zeigt, dass scheinbare Ausweglosigkeit zu innovativen Wendepunkten führen kann.
»In Wien herrscht der Wind oder die Pest.«
Ein mittelalterliches Sprichwort mit jahrhundertelanger Gültigkeit
Dir, sage ich, der heiligsten und unteilbaren Dreifaltigkeit: Ich Leopold, dein demütiger Diener, sage Dank, so sehr ich kann, dafür, dass im Jahr 1679 durch deine höchste Güte die unheilvolle Pestseuche von dieser Stadt und dem Land Österreich abgewendet wurde: und als ständiges Zeichen der gebührenden Dankbarkeit widme ich dir untertänigst dieses Denkmal«, ist in lateinischer Inschrift auf der Pestsäule am Wiener Graben zu lesen. Kaiser Leopold I. (1640–1705) floh angesichts der Pest 1679 aus Wien, versprach aber, wenn die Epidemie beendet sei, eine Gnadensäule zum Dank zu errichten.
Nachdem im Jahr 2020 Covid-19 Wien erreicht hatte, wurde die Pestsäule erneut zur Anlaufstelle für viele Menschen, die um einen glimpflichen Ausgang dieser Pandemie baten, Kerzen anzündeten, Kinderzeichnungen und Gebetstexte hinterlegten.
Einige Gehminuten von der Pestsäule entfernt steht im 4. Wiener Gemeindebezirk die Karlskirche. 1713 gelobte Kaiser Karl VI. (1685–1740), Maria Theresias Vater, anlässlich einer weiteren Pestepidemie, in Wien eine Kirche zu bauen, die dem Pestheiligen Karl Borromäus gewidmet sein sollte. Im selben Jahr erlosch die Pest in Wien, 1738 wurde die erste Messe in der Karlskirche gefeiert.
Nicht unweit der Pestsäule befindet sich das Griechenbeisl am Fleischmarkt, ein beliebter Treffpunkt für berühmte Persönlichkeiten, von Wolfgang Amadeus Mozart über Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Richard Wagner, Mark Twain, Ferdinand Georg Waldmüller, Johann Nestroy, Oskar Kokoschka, Rainer Maria Rilke bis hin zu Luciano Pavarotti, Karlheinz Böhm und vielen anderen. Hier trat im 17. Jahrhundert regelmäßig der Bänkelsänger Marx Augustin (1643–1685), im Volksmund bekannt als »Lieber Augustin«, auf, der während der Pestepidemie 1679 die Wiener Bevölkerung aufheiterte. Obwohl der damals 36-Jährige der Sage nach in alkoholisiertem Zustand auf der Straße aufgefunden, für ein Pestopfer gehalten und in eine Pestgrube geworfen worden war, überlebte er und blieb sogar von der Krankheit verschont. Sein Erlebnis soll er als Bänkelsänger bei der Wiener Bevölkerung zum Besten gegeben haben. Daraus entstand das Volkslied O du lieber Augustin, das rund um das Jahr 1800 in Wien nachgewiesen werden konnte, mit der Strophe: »Jeder Tag war ein Fest. Und was jetzt? Pest, die Pest! Nur ein groß’ Leichenfest, das ist der Rest« – sowie dem Refrain: »O du lieber Augustin, alles ist hin.«
Kerzen, Kinderzeichnungen und Gebete wurden 2020 angesichts der Corona-Pandemie vor die Wiener Pestsäule gelegt, verbunden mit der Bitte um einen glimpflichen Ausgang.
Die Pest, auch der »Schwarze Tod« genannt, tauchte bereits in der Antike auf. In der zweiten Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus wütete sie im Römischen Reich als die »Pest von Galen«, benannt nach dem berühmten Mediziner Galen von Pergamon. Galen knüpfte an die Viersäftelehre der hippokratischen Medizin an, nach der Blut, Schleim sowie gelbe und schwarze Galle in Einklang stehen mussten. Kam es zu einer Verschiebung innerhalb dieser vier Säfte im Körper, wurde der Mensch krank. Behandlung anhand von Puls- und Urinuntersuchungen und Vorbeugung gehörten zu den wesentlichen Aufgaben des Arztes. Als ein bekanntes Opfer der damaligen Seuche gilt der römische Kaiser Marc Aurel, der in Vindobona im Jahr 180 an der Pest gestorben sein soll.
In der Mitte des 6. Jahrhunderts brach die »Pest des Justinian« aus, die sich von Ägypten aus über den Mittelmeerraum und in Teilen Mitteleuropas ausbreitete. Jedenfalls traten Epidemien in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen auf, rafften unzählige Menschen dahin, entvölkerten ganze Landstriche und bewirkten massive demografische Veränderungen, weil, wer noch konnte, vor der Pest floh.
Adam Brenner (1841): Der liebe Augustin erwacht in der Pestgrube
Die Pest dürfte im 8. Jahrhundert verschwunden sein, ehe sie dann im 14. Jahrhundert praktisch weltweit zurückkehrte und verheerend zuschlug.
Wo die Pest im 14. Jahrhundert genau ausbrach und auf welchen Wegen sie nach Europa kam, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Eine Theorie besagt, dass sie um 1340 in Asien ihren Ausgang nahm, möglicherweise in China, im heutigen Kirgisistan oder in einer Region nördlich des Kaspischen Meeres. Mongolische Soldaten sollen die Seuche bis ans Schwarze Meer gebracht haben, von wo sie sich über die See- und Handelswege, darunter über die berühmte Seidenstraße, bis nach Westeuropa verbreitete. 1346 war die Pest jedenfalls in Astrachan an der Wolga und entlang des Don nachweisbar. 1347 trat sie massiv in Caffa, einer genuesischen Siedlung am Schwarzen Meer, auf. Bereits im Jahr zuvor soll der damalige Tatarenführer Pestleichen über die Stadtmauer von Caffa werfen lassen haben, um die Bevölkerung zu infizieren – eine frühe Form der Verwendung einer Seuche als biologische Waffe im Kampf. Als die Genuesen mit ihren Schiffen vor den Mongolen flüchteten, dürften sie die Krankheit an Bord mitgenommen und in den Mittelmeerraum eingeschleppt haben. Aus Florenz berichtete der italienische Dichter Giovanni Boccaccio (1313–1375), dessen Vater 1348 der Pest zum Opfer gefallen war, in seiner Novellensammlung Il Decamerone: »Die Auswirkung dieser Seuche war verheerend, da sie schon durch den Umgang mit einem Kranken auf die Gesunden übersprang wie das Feuer auf trockene oder feste Dinge. Noch schlimmer war, dass sie sich nicht allein durch Gespräche oder Umgang mit Kranken auf Gesunde übertrug, sondern dass schon durch die bloße Berührung von Kleidungsstücken und Gebrauchsgegenständen, die ein Kranker benutzt oder angerührt hatte, diese entsetzliche Seuche den Berührenden zu ergreifen schien. Gegen diese Erkrankung vermochte weder die Kunst der Ärzte noch die Kraft der Medizin irgendetwas auszurichten. Die Luft war angefüllt mit dem giftigen Atem der Verwesung, mit Krankenausdünstungen.« Weiters brachten Handelsreisende den Erreger nach Konstantinopel, Alexandria, Messina, Venedig, Pisa, Genua, Marseille und in den heutigen kroatischen Raum. Über Avignon gelangte die Pest nach Paris, über Bordeaux nach England. Über die Alpenpässe kam sie nach Österreich. Auch Juden warf man vor, die Pest eingeschleppt zu haben. Mitte des 14. Jahrhunderts raffte die Seuche innerhalb von sechs Jahren rund ein Drittel der Bevölkerung dahin. Das Pilgerjahr 1350 trug das Seine dazu bei: Da Papst Clemens VI. (1291–1352) besonders wirkungsvolle Ablässe versprochen hatte, fühlten sich zahllose Pilger aufgefordert, heilige Orte zu besuchen. Für viele war es ein Muss, das sogenannte Christliche Dreieck Rom, Santiago de Compostela und Jerusalem aufgesucht zu haben. Aber auch heilige Städte in Ägypten oder der Berg Sinai sowie das rituelle Bad der Hindus im Ganges waren Anziehungspunkte. Auf den weiten Wegen zu Kirchen, Klöstern und anderen sakralen Orten wurde also der Pesterreger verbreitet.
Neuere Forschungen anhand von Genuntersuchungen stellten darüber hinaus fest, dass der im Mittelalter aufblühende Pelzhandel mit Russland eine Schlüsselrolle bei der Ausbreitung gespielt haben könnte. Die heutige Großstadt Nowgorod galt damals als ein Handelszentrum für Pelze. Über die Hanse kam es zu wirtschaftlichen Verbindungen mit Westeuropa, was dazu führte, dass auf dem Seeweg, über das heutige Norddeutschland, Pelze, die mit infizierten Flöhen und Ratten verseucht waren, nach London und in andere Häfen gelangten.
Der Name »Pest« leitet sich vom lateinischen Wort »pestis« für Seuche ab. Dabei handelt es sich um eine hochgradig ansteckende Infektion, die durch das Bakterium Yersinia pestis, entdeckt 1894 durch den Schweizer Arzt Alexandre Yersin (1863–1943), einem Mitarbeiter von Louis Pasteur (1822–1895), ausgelöst wird und als Beulen- und Lungenpest, Pestsepsis sowie als abortive Pest auftreten kann. Zur gleichen Zeit soll auch der Japaner Shibasaburō Kitasato (1853–1931), ein Mitarbeiter des deutschen Bakteriologen Robert Koch (1843–1910), den Pesterreger beschrieben haben. In der Namensgebung setzte sich jedoch Yersin durch.
Die Pest wird durch den Biss eines infizierten Rattenflohs auf den Menschen übertragen und führt zunächst zur Beulenpest. Als Symptome werden Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, geschwächter Allgemeinzustand und in weiterer Folge Bewusstseinsstörungen beschrieben. Dazu kommen schmerzhafte Beulen am Hals, in den Achselhöhlen und den Leisten. Aufgrund der inneren Blutungen in den Lymphknoten sind diese Beulen blau-schwarz gefärbt. Der aus Böhmen stammende Mediziner Carl Ignaz Lorinser (1796–1853) beschrieb die Krankheit so: »Zuerst leiden die Menschen an einer plötzlichen Schwäche aller Glieder und Kopfschmerzen. Dann befällt sie Ekel und Würgen, worauf ein Erbrechen grüner Galle erfolgt. Oft stellt sich noch am ersten Tag Fieber ein.« Am zweiten oder dritten Tag kommen die Beulen hinzu, der Tod tritt innerhalb von zwei bis sechs Tagen ein. Wer damals den achten Tag überlebte, hatte gute Chancen, zu genesen.
Kommt es zu einer Ansteckung durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch, erkrankt der Patient im Regelfall an der Lungenpest. Dann leidet er an Husten, Atemnot, Zyanose und schwarz-blutigem Auswurf. In vielen Fällen entwickelt sich ein Lungenödem, das unbehandelt zum Tod führt.
Besonders dramatisch verläuft die Pestsepsis. Die Erreger verteilen sich über das Blut im gesamten Körper, es kommt zu hohem Fieber, Schüttelfrost, Kopfschmerzen, Schwindelanfällen und in weiterer Folge zur Schocksymptomatik sowie zu Haut- und Organblutungen, daher der Name »Schwarzer Tod«. Unbehandelt gibt es bei der Pestsepsis kaum eine Überlebenschance.
Die harmloseste Form ist die abortive Pest. Der Patient leidet an leichtem Fieber und geringer Schwellung der Lymphknoten. Nach überstandener Krankheit ist er lange immun gegen alle Pestformen.
Moulage einer Pestnekrose
Die letzten bekannten Pestfälle in Europa stammen aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Heute kommen die Pesterreger in wild lebenden Nagetierpopulationen vor, zum Beispiel bei Erdhörnchen, Murmeltieren, Präriehunden oder Hausratten. Während in Europa derzeit keine infizierten Tierpopulationen bekannt sind, gibt es solche sehr wohl im Kaukasus, in Russland, Südostasien, China, der Mongolei, in Süd- und Ostafrika, Mittel- und Südamerika, aber auch im südwestlichen Teil der USA.
Angesichts der Corona-Situation war wohl die Meldung »Neuer Beulenpestfall in Nordchina« im Juli 2020 alarmierend. Das Deutsche Ärzteblatt vermeldete: »[…] in der benachbarten Mongolei wurde gestern ein Pest-Verdachtsfall gemeldet. Ein 15-Jähriger bekam Fieber, nachdem er ein Murmeltier verspeist hatte […] Bereits vergangene Woche waren laut Xinhua in der mongolischen Provinz Khovd zwei Infektionen aufgetreten. Bei den Erkrankten handelt es sich demnach um Brüder, die ebenfalls Murmeltierfleisch gegessen hatten. Mehr als 140 Kontaktpersonen seien unter Quarantäne gestellt worden.«
Heute erkranken pro Jahr rund 1000 bis 3000 Menschen an der Pest, rund 200 sterben daran. Therapiert wird mit Antibiotika, die existierende Impfung, die einen Schutz vor der Beulenpest von rund drei bis sechs Monaten gewährleistet, aber schlecht vertragen wird, wird nur für Risikogruppen empfohlen, also Jägern oder Bauern, die in Pestgebieten leben und arbeiten.
In Wien und Niederösterreich wütete die Pest ab 1349 und dürfte bereits in den Anfängen rund die Hälfte der Bevölkerung dahingerafft haben. Sie kam aus dem Osten und konnte sich in Wien aufgrund der katastrophalen hygienischen Bedingungen, der engen Wohnräume, der Stallungen in der Stadt, des Abfalls auf den Straßen, vermischt mit Exkrementen von Menschen und Tieren, gnadenlos ausbreiten. Dazu kamen verfaulende Tierkadaver, die vom Abdecker enthäutet worden waren und dann als Fraß für Raben und Hunde auf den Straßen liegen blieben. Sozial unterste Schichten wie Bettler gehörten zu den ersten Opfern.
Damals glaubten Mediziner, der Ursprung liege »im Streit der Gestirne und in der Gegend des indischen Meers«. Außerdem meinte man nach der gängigen Miasmentheorie, die Luft sei verseucht und die Giftstoffe werden durch die Winde verbreitet. Und letztlich behauptete man, die Juden hätten die Wiener Brunnen vergiftet.
Um die schlechte Luft zu reinigen, wurden Parfumessenzen in geschlossenen Räumen verteilt und Kleider sowie Körper damit besprüht. In manchen Gegenden empfahl man, eine Ziege in den Wohnraum zu stellen, um den scheußlichen Geruch der Pest zu vertreiben. Für ein anderes Gegenmittel hielt man Tabakrauchen, sodass vor allem ab dem 16. Jahrhundert das Rauchen teilweise verpflichtend wurde. Schon im 14. Jahrhundert war den Menschen bewusst, dass Quarantäne die wichtigste Maßnahme war, um die Epidemie einzudämmen. Diese dauerte damals oft sogar 60 bis 80 Tage. Half alles nichts, verbrannte man die Häuser von Pestkranken oder gleich ganze Dörfer.
Als Heilmittel galten neben dem allseits angewandten Aderlass Klistiere, Gewürz- beziehungsweise Kräutermischungen, vor allem Theriak. Dieses aus vielen Zutaten bestehende und oft mit Opium versehene Allheilmittel des Mittelalters wird heute noch, wenn auch ohne Opium, angeboten. Der ehemalige Rektor und mehrfache Dekan der medizinischen Fakultät sowie Leibarzt Herzog Albrechts V. von Österreich (1397–1439), Johannes Aigel (Aygel) von Korneuburg (gestorben 1436), der eigene Erfahrungen bei der Behandlung von Pestkranken sammelte, empfahl den täglichen Konsum von Priestersalz, einer Mischung aus gebranntem Salz und aromatischen Kräutern. Dazu wurde die Einnahme von getrockneten, zu Pulver zermahlenen oder zerbröselten Pesteiterbeulen ebenso wie Kröten in getrockneter und pulverisierter Form dringend empfohlen. Abhilfe versprach man sich weiters von Pestbier, das den schwächelnden Kranken Kraft geben sollte.
Damals ging es noch mehr darum, die Gesundheit des Menschen zu erhalten, weniger darum, Kranke zu behandeln. Machtpolitische Gedanken waren vielerorts wichtiger als humane Obsorge, denn der Verlust von Untertanen verminderte den wirtschaftlichen Ertrag, dies wiederum schmälerte die Einnahmen der Grundherren, wodurch die Wehrkraft gefährdet war und die Gefahr von Unruhen größer wurde. Dass die Ärzte der Pest zumeist machtlos gegenüberstanden, war vielen Patienten egal, denn wenn sie gesundeten, hielten sie die unzähligen dafür gesprochenen Gebete verantwortlich, überlebte man nicht, war das Leben davor einfach zu lasterhaft gewesen.
In den darauffolgenden Jahrhunderten kam die Pest immer wieder, nämlich 1381, 1410/11 sowie 1436, dann 1506, 1521, 1541, 1563, 1570, 1586, 1654/55, 1679, 1683 sowie 1713.
1657 errichtete man in Wien den Kontumazhof bei der Rochus-Kapelle am Alsergrund als Quarantänestation. Dort wurden alle Personen, die eine Erkrankung überstanden hatten, beziehungsweise alle, die mit Kranken in Berührung gekommen waren, 40 Tage lang – nach dem italienischen Wort für quaranta beziehungsweise quarantina di giorni – isoliert.
Um 1679 grassierte die Seuche besonders heftig mit allein rund 12 000 Opfern in Wien. Eine Mondfinsternis am 15. April soll schuld daran gewesen sein, gefolgt von einem windstillen und warmen Sommer, der für eine fäulnisförderliche Beschaffenheit der Luft sorgte. Damals bemühte sich der Mediziner und Rektor der Universität Wien Paul de Sorbait (1624–1691), seit 1654 Professor für Medizin an der Universität Wien, gegen die Verbreitung der Pest anzukämpfen. 1679 zum General-inquisitor in allen Pestangelegenheiten ernannt, empfahl er, nach früherem Vorbild infizierte Gegenstände fernab der Zivilisation zu verbrennen oder noch besser einzugraben. Trotzdem gelang es ihm nicht, den massiven Ausbruch zu verhindern. Die Krankheit trat zuerst in der Leopoldstadt auf und breitete sich von dort über ganz Wien und darüber hinaus aus. Auf den Hauptverbindungsstraßen wie etwa zwischen Graz und Wien sowie generell an markanten Verkehrsknotenpunkten wurden Reisende und Händler nur nach einer Befragung durch Wachen und gegen das Vorweisen eines von der Behörde ausgestellten Pestpasses, der Gesundheit bescheinigte, durchgelassen. Die Straßen nach Salzburg wurden überhaupt gesperrt. Besonders bitter war der Ausbruch der Pest im Wallfahrtsort Mariazell im August, ausgerechnet nach einer Bittwallfahrt des kaiserlichen Gefolges. Aber gerade gemeinsames Beten und die Abhaltung von Prozessionen bewirkten durch das enge Beisammensein eine erhöhte Ansteckungsgefahr und eine noch stärkere Verbreitung. Nach dem Ausbruch in Mariazell übersiedelten der Kaiser und sein Hof nach Prag. Im Oktober 1679 erging ein Kaiserliches Patent wegen der »Kontagions-Krankheit« an alle geistlichen und weltlichen Behörden, Landgerichte, Burgfriedsherrschaften und Grundobrigkeiten mit detaillierten Instruktionen. In dieser »Pest-Ordnung« schilderte der kaiserliche Leibarzt und Hofmathematiker sowie mehrmalige Rektor der Universität Wien Johann Wilhelm Ritter von Mannagetta (1588–1666) die damaligen medizinischen Kenntnisse, darunter Krankheitssymptome, Ursachen, Verhaltensregeln für Ärzte und Bevölkerung, Instruktionen für die Einrichtung von Pestlazaretten in allen großen Städten, und gab Anweisung zur Isolierung und zu Vorkehrungen, die wir in Corona-Zeiten als Social Distancing bezeichnen.
Der Handel wurde erschwert und unterlag strengen Hygienebestimmungen. In manchen kleineren Orten Österreichs kam es zu Lebensmittelengpässen, weil keine Nachlieferungen mehr erfolgten und alles ausverkauft war. Geld musste vor dem Wechsel zum nächsten Besitzer in Essig getaucht werden. Schulen und Universitäten wurden geschlossen, Menschenansammlungen, Jahrmärkte und Kirchenbesuche verboten, Fechtschulen, Badeanstalten und Gasthäuser gesperrt. Gottesdienste durften jedoch zumindest teilweise im Freien abgehalten werden. Speisen konnten in Gefäßen verkauft werden, mussten allerdings außerhalb der Gaststätten konsumiert werden. Und es gab eine Reihe von Verordnungen für Berufe: Fleischhauer durften nur Rindfleisch unter bestimmten Regeln verarbeiten, der Verkauf von Schweinefleisch war verboten, weil Schweine »unflath«, also unrein waren, Schneider durften nur Kleider und Stoffe bearbeiten, wenn sie sicher waren, dass diese nicht mit Flöhen infiziert waren, Bäcker durften kein warmes Brot verkaufen, weil dieses das Gift anzog, und Barbiere durften nur eine bestimmte Anzahl an Kunden gleichzeitig in ihr Geschäft lassen. Gegen Pestpartys, die vereinzelt stattfanden, ging man rigoros vor. Doch trotz all der Maßnahmen war die Pest schon wieder da, als man 1683 nach dem Ende der Zweiten Türkenbelagerung in Wien aufatmen wollte.
Die große Pest in Wien, 1669
Ein letztes Mal kam sie 1713, als eine aus Ungarn stammende infizierte Frau in die Rossau zog und dort Mitbewohner ansteckte. Die Pest war damals in Ungarn bereits im Jahr zuvor grassiert. Als die Patientin in das Bürgerspital eingeliefert wurde, verbreitete sich die Seuche dort rasant. Rasch verordnete man erneut Quarantänen, Schul- und Kirchenschließungen und erließ ein Verbot von Menschenansammlungen. Der Zuzug der ärmeren Bevölkerung aus Ungarn wurde untersagt, Lebensmittel durften nur mehr aus Böhmen, nicht mehr aus Ungarn eingeführt werden. Kaiser und Hofstaat zogen sich in die Hofburg zurück, die dortigen Ein- und Ausgänge wurde strengstens kontrolliert. Sein Jagdvergnügen ließ sich Kaiser Karl VI. allerdings nicht nehmen, woraufhin sich das Jagdpersonal regelmäßigen Gesundheitskontrollen unterziehen lassen musste.
Bei dieser letzten großen Pestepidemie verzeichnete Wien noch einmal rund 9500 Erkrankte, wovon über 8600 starben, darunter 50 Wundärzte und elf Doktoren der Medizin. Dazu kamen noch zehn von 28 Seelsorgern in den Pestlazaretten. Danach verschwand die Pest in Österreich und Mitteleuropa. Mit ein Grund dafür war die Errichtung des Seuchenkordons ab dem 18. Jahrhundert gegen das Osmanische Reich, mit dessen Hilfe man Krankheiten aus dem Osten von Europa fernzuhalten trachtete.
Doch bis dahin mussten gesetzliche Regelungen getroffen werden, insbesondere, weil der Wiener durch Schlamperei und Gleichgültigkeit die Pest wüten hat lassen. Somit forderte die Pest erste Ansätze einer modernen Form der Stadthygiene und Pestreglements.