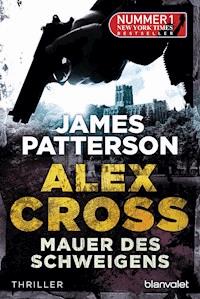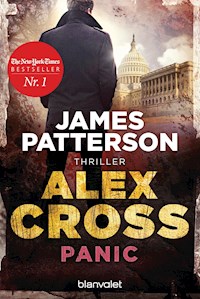
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Cross
- Sprache: Deutsch
Noch nie waren die Straßen von Washington, D. C., so gefährlich!
***Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie CROSS!***
Mitten in der Nacht wird auf einer der Hauptverkehrsadern von Washington, D. C., ein Mann erschossen. Detective Alex Cross hat gerade erst begonnen zu ermitteln, als er zu einem weiteren Mordfall am anderen Ende der Stadt gerufen wird. Er ahnt nicht, was ihn dort erwartet. Tom McGrath, Alex‘ Chef und der hochgeschätzte Mentor seiner Frau Bree, wurde aus einem fahrenden Auto heraus erschossen. Ein Killer auf freiem Fuß, eine Stadt in Panik und eine Polizei ohne Führung: Alex und Bree müssen alles daransetzen, das Gesetz wieder in die eigene Hand zu nehmen, bevor Gewalt und Furcht Washington ins völlige Chaos stürzen.
Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 403
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Mitten in der Nacht wird auf einer der Hauptverkehrsadern von Washington, D. C., ein Mann erschossen. Detective Alex Cross hat gerade erst begonnen zu ermitteln, als er zu einem weiteren Mordfall am anderen Ende der Stadt gerufen wird. Er ahnt nicht, was ihn dort erwartet. Tom McGrath, Alex’ Chef und der hochgeschätzte Mentor seiner Frau Bree, wurde aus einem fahrenden Auto heraus erschossen. Ein Killer auf freiem Fuß, eine Stadt in Panik und eine Polizei ohne Führung: Alex und Bree müssen alles daransetzen, das Gesetz wieder in die eigene Hand zu nehmen, bevor Gewalt und Furcht Washington ins völlige Chaos stürzen.
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Die Titel der Alex-Cross-Reihe:
Justice · Devil · Evil · Run · Dark · Cold · Storm · Heat · Fire · Dead · Blood · Ave Maria · Und erlöse uns von dem Bösen · Vor aller Augen · Mauer des Schweigens · Stunde der Rache
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
Panic
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Cross the Line« bei Little, Brown and Company, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2016 by James Patterson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by Blanvalet
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
© Johannes Wiebel | punchdesign,
unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
(MH Anderson Photography; Malivan_Iuliia)
AF · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN978-3-641-24290-9V001
www.blanvalet.de
Prolog TOD IM ROCK CREEK
1
Er schlüpfte in eine andere Identität, so wie viele Krieger vor der Schlacht. An Abenden wie diesem nannte er sich Mercury.
Er war vollkommen in Schwarz gekleidet, angefangen bei seinem Vollvisierintegralhelm bis hinab zu seinen Stahlkappenstiefeln. Sein Motorrad hatte er am Rand des Rock Creek Parkway südlich der Calvert Street rückwärts in einen mächtigen Rhododendronbusch geschoben. Er selbst saß rittlings auf der im Leerlauf vor sich hin blubbernden Maschine und hielt den Infrarot-Geschwindigkeitsmesser mit beiden Händen fest. Er richtete den Laserstrahl auf alle vorbeifahrenden Fahrzeuge und überprüfte deren Geschwindigkeit.
Siebzig Stundenkilometer, genau so viel war erlaubt. Achtundsechzig. Neunundsiebzig. Routine. Unproblematische Werte. Langweilige Werte.
Mercury hoffte auf eine ungewöhnlichere, eine deutlich höhere Zahl. Und er konnte sich ziemlich sicher sein, dass er die noch vor dem Ende der Nacht zu sehen bekommen würde. Jedenfalls hatte er sich genau die richtige Stelle dafür ausgesucht.
Der Rock Creek Parkway war in den Zwanzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts gebaut worden, und zwar so, dass die wunderschöne Parklandschaft so weit wie möglich erhalten geblieben war. Zunächst vierspurig, später dann zweispurig schlängelte sich die Straße vom Lincoln Memorial in nördlicher Richtung durch ein abwechslungsreiches Waldgebiet. Sie war viereinhalb Kilometer lang und gabelte sich im Nordwesten von Washington. Die rechte Gabel, der Beach Drive, führte Richtung Nordosten tiefer in den Park hinein, während der eigentliche Parkway nach links abzweigte und sich in nordwestliche Richtung wandte, wo er schließlich auf die Calvert Street traf.
Das Display der Radarpistole zeigte jetzt neunundsechzig Stundenkilometer an. Vierundsiebzig. Sechsundsechzig.
Diese Zahlen lagen im Rahmen des Erwartbaren. Der Parkway stand unter Denkmalschutz und wurde von der Nationalpark-Behörde verwaltet. Die Geschwindigkeit war auf der gesamten Strecke auf siebzig Stundenkilometer begrenzt.
Allerdings gab es im District of Columbia keine andere Straße, die so viel Ähnlichkeit mit einer Rennstrecke hatte wie dieser gewundene Parkway. Lang gezogene S-Kurven, Schikanen, etliche Steigungen und Gefälle, lange Geraden auf dem Grund der Schlucht … das alles gab es hier, und dazu war die Straße fast doppelt so lang wie der berühmte Formel-1-Kurs in Watkins Glen, New York.
Allein das reicht schon, dachte Mercury. Allein das bedeutet, dass es irgendjemand versuchen wird. Wenn nicht heute, dann eben morgen oder übermorgen.
In einem Artikel in der Washington Post hatte er gelesen, dass an jedem beliebigen Tag des Jahres mit einer mehr als dreiunddreißigprozentigen Wahrscheinlichkeit irgendein verwöhntes Kind reicher Eltern oder ein alter Sack, der nicht wusste, wohin mit all den Pensionszahlungen, die der Staat ihm in den Hintern blies, seinen neuen Porsche oder seinen hochmotorisierten BMW aus der Garage holte, um am Rock Creek mal so richtig Gas zu geben. Vielleicht auch ein Vorstadt-Jugendlicher, der seinem alten Herrn den Audi aus der Garage stibitzt hatte, ja gelegentlich sogar mal die eine oder andere Mutti im mittleren Alter.
Alle möglichen Leute schienen von diesem Gedanken fast besessen zu sein. An jedem dritten Abend probiert es jemand, dachte Mercury. Und heute standen die Chancen überdurchschnittlich gut.
Vor wenigen Tagen erst hatte die neueste Haushaltskrise dazu geführt, dass die US-Regierung keine Zahlungen mehr veranlassen konnte. Sämtliche Gelder für die Parkaufsicht waren eingefroren worden, genau wie die Gehälter der Angestellten. Die Parkaufseher waren aus versicherungsrechtlichen Gründen nach Hause geschickt worden. Niemand war da, um aufzupassen. Niemand außer ihm.
Stunden vergingen. Der Verkehr wurde immer spärlicher, aber Mercury nahm weiterhin jedes Fahrzeug ins Visier seiner Radarpistole, behielt das Display im Blick und wartete. Gegen Viertel vor drei nickte er für einen Moment ein und überlegte anschließend, ob er für heute Schluss machen sollte, als ein Fahrzeug mit einem großvolumigen Motor unter lautem Röhren vom Beach Drive auf den Parkway einbog.
Kaum hatte Mercury das Geräusch gehört, schoss seine rechte Hand nach vorne an den Gasgriff seines Motorrads. Seine linke Hand hielt die Radarpistole auf das Röhren gerichtet, das im Näherkommen zu einem sägenden Wutgebrüll anschwoll.
Sobald er die Scheinwerfer im Visier hatte, drückte er ab.
Hundertfünfzehn Stundenkilometer.
Er warf die Radarpistole in den Rhododendron. Die konnte er sich später wieder holen.
Ein Maserati raste an ihm vorbei.
Mercury riss den Gashahn auf und ließ die Kupplung herausschnappen. Er jagte aus dem Rhododendron hervor, flog die Böschung hinab und landete mit quietschenden Reifen auf dem Parkway. Der italienische Sportwagen befand sich keine hundert Meter vor ihm.
2
Der Maserati war nagelneu – schwarz, elegant, ein Quattroporte, nach allem, was Mercury beim Vorbeihuschen hatte sehen können, und höchstwahrscheinlich ein SQ5.
Mercury kannte sich mit solchen exotischen Fahrzeugen bestens aus. Ein Maserati Quattroporte SQ5 besaß einen Sechszylinder-Turbomotor, der den Wagen auf zweihundertdreiundachtzig Stundenkilometer beschleunigen konnte. Getriebe, Radaufhängung und Lenkung waren auf dem allerneuesten Stand der Technik.
Der Maserati war also, alles in allem betrachtet, ein würdiger Gegner und den Herausforderungen des Parkway durchaus gewachsen. Der durchschnittliche Autofahrer oder die durchschnittliche Autofahrerin glaubten vermutlich, dass ein solcher Wagen auf einem solch anspruchsvollen Kurs unter keinen Umständen zu schlagen war, schon gar nicht von einem Motorrad.
Aber da lagen sie falsch.
Mercurys Motorrad war eine wahre Bestie, die selbst bei dreihundert Stundenkilometern noch ruhig auf der Straße lag, sich ausgesprochen willig durch Kurven und Serpentinen lenken ließ und auch alle anderen Straßenverhältnisse fast spielerisch zu meistern in der Lage war. Besonders wenn man wusste, wie man ein solches Motorrad fahren musste. Und Mercury wusste das. Er fuhr schon sein ganzes Leben lang schnelle Bikes und war darum wie geschaffen für diese Maschine.
Hundertzwanzig Stundenkilometer, hundertvierzig. Am Ausgang der lang gezogenen Ostkurve flammten die Bremsleuchten des Maserati auf. Der Fahrer des italienischen Sportwagens hatte die anschließende S-Kurve ein wenig unterschätzt.
Es war ein Anfängerfehler, und Mercury nützte ihn gnadenlos aus. Er beugte sich über den Lenker, gab Gas und legte sich geschmeidig in die Kurve. Am Ausgang des Kurven-S hing er mit über hundertzehn Stundenkilometern direkt an der Stoßstange des Maserati.
Jetzt führte der Parkway etwa anderthalb Kilometer weit relativ gerade nach Süden. Der italienische Sportwagen wollte Mercury mit Vollgas hinter sich lassen. Aber gegen die Rennmaschine hatte er keine Chance.
Mercury blieb direkt hinter dem Maserati, nahm die linke Hand vom Lenker und griff nach der Remington 1911, die er mit Klettband am Tank befestigt hatte.
Hundertvierzig. Hundertfünfundvierzig.
Sie näherten sich einer scharfen, lang gezogenen Linkskurve. Der Maserati würde bremsen müssen. Mercury ließ sich ein wenig zurückfallen und wartete ab.
In dem Moment, als die Bremsleuchten des italienischen Sportwagens aufblitzten, gab er erneut Gas und war im nächsten Augenblick nach einem blitzschnellen Manöver neben der Beifahrertür des Maserati. Der Beifahrersitz war leer.
Den Fahrer bekam er nur als schemenhaften Umriss zu sehen, bevor er zweimal abdrückte. Das Fenster zersplitterte. Die Kugeln trafen ihr Ziel.
Der Maserati schleuderte nach links, prallte gegen die Leitplanke und von dort wieder zurück in die Straßenmitte, während Mercury sich und sein Motorrad mit aufheulendem Motor in Sicherheit brachte. Vor der nächsten Linkskurve schaltete er wieder herunter und bremste.
Dann beobachtete er im Rückspiegel, wie der Maserati sich überschlug, die Leitplanke überquerte, gegen die Bäume prallte und explodierte.
Mercury empfand keinerlei Mitleid oder Bedauern für den Fahrer.
Das Arschgesicht hätte schließlich wissen müssen, dass zu schnelles Fahren lebensgefährlich ist.
ERSTER TEIL POLIZISTENMORD
1
Als Tom McGrath den Gang mit den glutenfreien Produkten bei Whole Foods verließ, dachte er, dass die hochgewachsene, schlanke Frau mit der blaugrünen Leggings und der passenden Trainingsjacke vor ihm die Figur einer Balletttänzerin hatte.
Sie war Anfang dreißig, und mit ihren hohen Wangenknochen, den mandelförmigen Augen und den pechschwarzen, zu einem Pferdeschwanz gebundenen Haaren bot sie einen sehenswerten, ja fast schon exotischen Anblick. Sie schien seine interessierten Blicke zu spüren und drehte sich zu ihm um. Dann sagte sie mit einem leichten osteuropäischen Akzent: »Du bewegst dich wie ein alter Knacker, Tom.«
»Genau so fühle ich mich auch, Edita«, erwiderte McGrath. Er war Mitte vierzig und hatte eine Statur wie ein etwas aus dem Leim gegangener Footballspieler. »Ich bin total verkrampft, und dazu noch dieser Muskelkater an allen möglichen Stellen, wo ich niemals damit gerechnet hätte, dass man da überhaupt Muskelkater kriegen kann.«
»Zu viel Hanteltraining und zu wenig Dehnübungen«, erwiderte Edita und stellte zwei Flaschen Kombucha-Tee in den Einkaufswagen, den McGrath vor sich herschob.
»Ich dehne mich ständig. Bloß eben nicht so. Und nicht um fünf Uhr morgens. Bei manchen Übungen ist mein Kopf so dick angeschwollen, dass ich mir vorgekommen bin wie eine Zecke.«
Edita blieb vor einem Regal stehen und nahm verschiedene Salatzutaten heraus. »Was ist das? Eine Zecke?«
»Kennst du doch. Diese kleinen Insekten, von denen man Borreliose kriegt?«
Sie schnaubte. »Hat dir deine erste Yogastunde denn gar keinen Spaß gemacht?«
»Na ja, einmal war ich da hinten noch mit der Kobra beschäftigt, während du mit den anderen hübschen Yogadamen zusammen schon den herabschauenden Hund gemacht hast. Also das hat mir sogar sehr viel Spaß gemacht«, sagte McGrath.
Edita versetzte ihm einen gutmütigen Klaps auf den Oberarm. »Das hast du dir doch ausgedacht.«
»Ich bin irgendwie aus dem Rhythmus geraten. Hat mich aber nicht weiter gestört.«
Sie schüttelte den Kopf. »Was ist bloß mit euch Männern los? Ihr bleibt mir ein ewiges Rätsel.«
McGrath wurde wieder ernst. »Dabei fällt mir ein: Ich habe dich doch kürzlich etwas gefragt. Hast du etwas rausgefunden?«
Edita verkrampfte sich. »Ich hab dir doch gesagt, dass das nicht so einfach ist, Tom.«
»Du musst es einfach nur tun, dann kannst du das alles hinter dir lassen.«
Sie sah ihn nicht an. »Meine Ausbildung? Mein Auto? Meine Wohnung?«
»Wie gesagt, ich helfe dir.«
Edita wirkte hin- und hergerissen. »Das ist denen doch scheißegal, Tom. Die …«
»Keine Sorge. Du hast schließlich den Krieger McGrath an deiner Seite.«
»Du bist ein hoffnungsloser Fall.« Sie wurde weich und streichelte ihm die Wange.
»Bloß, wenn es um dich geht«, erwiderte er.
Edita zögerte kurz, bevor sie ihm ein Luftküsschen zuwarf und die Kasse ansteuerte. McGrath war ihr beim Ausladen des Einkaufswagens behilflich.
Als die Kassiererin anfing, ihre Sachen über den Scanner zu ziehen, fragte Edita: »Warum machst du denn ein Gesicht wie ein verlassenes Hundebaby?«
»Ich finde eben, dass auch ein paar kleine Laster in den Einkaufswagen gehören. Zumindest Bier.«
Sie zeigte auf eine Flasche auf dem Förderband. »Das da ist aber viel gesünder.«
McGrath beugte sich vor und nahm die Flasche in die Hand.
»Cliffton Dry?«
»Sekt, nur eben aus Bioäpfeln anstatt Trauben.«
»Wenn du das sagst.« Die Skepsis war McGrath deutlich anzuhören.
Während er ihre Einkäufe in Stoffbeutel verstaute, bezahlte Edita mit Bargeld aus einer kleinen Gürteltasche. McGrath überlegte, was seine Kumpel wohl dazu sagen würden, dass er sich mit einer Frau abgab, die statt eines Sechserpacks Budweiser eine Flasche Cliffton Dry kaufte. Sie würden ihn gnadenlos zur Schnecke machen. Aber wenn Edita auf Apfel-Blubberwasser stand, würde er es zumindest probieren.
Ihm war klar, dass sie eine seltsame Beziehung führten, aber erst kürzlich hatte er beschlossen, dass Edita überwiegend gut für ihn war. Sie machte ihn glücklich. Und sie machte, dass er sich jung fühlte und jung dachte, und auch das war etwas Gutes.
Sie nahmen die Einkaufstaschen in die Hand, und er folgte ihr hinaus in den warmen Nieselregen, der die Bürgersteige glitzern ließ. Der Verkehr auf den südwärts führenden Fahrstreifen der Wisconsin Avenue hatte trotz der frühen Morgenstunde bereits zugenommen, aber Richtung Norden war es immer noch ruhig.
Edita ging ein, zwei Schritte vor ihm her, als sie sich nach Süden wandten.
Eine Sekunde später sah McGrath im Augenwinkel rote Flammen aufzucken, hörte das ratternde Bamm-Bamm-Bamm einer Schnellfeuerpistole und spürte, wie er getroffen wurde. Eine Kugel schlug in seine Brust ein und riss ihn zu Boden.
Edita fing an zu schreien, doch dann wurde auch sie von zwei Kugeln niedergestreckt und landete neben McGrath auf dem Bürgersteig, während ihre Einkäufe über den blutigen Bürgersteig rollten.
McGrath nahm seine Umgebung nur noch aus weiter Ferne und in Zeitlupe wahr. Er rang um Atem, kam sich vor, als hätte man ihm mit einem Vorschlaghammer den Brustkorb zertrümmert. Er schaltete auf Autopilot und holte mit zittrigen Fingern sein Handy aus seiner Hose.
Er wählte die Notrufnummer und sah geistesabwesend zu, wie der Cliffton Dry unbeschädigt den Bürgersteig entlangrollte.
»Notrufzentrale, was kann ich für Sie tun?«, ertönte eine Stimme.
»Schüsse auf Polizeibeamten«, krächzte McGrath. »Auf dem 3200er-Block in der Wisconsin Avenue. Ich wiederhole, Schüsse auf …«
Er merkte, dass er ohnmächtig wurde. Er ließ das Handy los und nahm alle Kraft zusammen, um zu Edita zu sehen. Sie lag regungslos da, mit leerer, ausdrucksloser Miene.
Bevor er starb, flüsterte McGrath: »Es tut mir leid, Ed. Alles.«
2
Ein leichter Regen hatte eingesetzt, als John Sampson und ich aus unserem Zivilfahrzeug stiegen. Wir standen am Rand des Rock Creek Parkway, südlich der Massachusetts Avenue, und die Luftfeuchtigkeit näherte sich bereits den Werten eines Dampfbades. Es war 6.30 Uhr.
Die linke Fahrspur wurde von einem Transportfahrzeug der Gerichtsmedizin, zwei Streifenwagen der Metropolitan Police von Washington, D. C., sowie zwei uniformierten Beamten blockiert. Nicht auszudenken, was das für den morgendlichen Berufsverkehr bedeutete.
Der jüngere der beiden Polizisten machte ein verdutztes Gesicht, als er uns sah. »Die Mordkommission? Der Kerl ist mit hundertvierzig Sachen gegen einen Baum gerast.«
»Jemand hat gemeldet, dass unmittelbar vor dem Unfall Schüsse gefallen sind«, erwiderte ich.
»Wissen wir, wer der Mann war?«, fragte Sampson.
»Der Wagen ist auf einen gewissen Aaron Peters aus Bethesda zugelassen.«
»Danke, Kollege«, sagte ich, dann machten wir uns auf den Weg zur Unfallstelle.
Der Maserati lag auf dem Dach und hatte sich mit der Beifahrerseite voraus um einen Japanischen Ahorn gewickelt. Die Karosserie war stark zerkratzt und verbeult, und sämtliche Fenster waren zersplittert.
Die Gerichtsmedizinerin, eine dickliche, ziemlich bissige und außerordentlich kompetente Rothaarige namens Nancy Ann Barton kniete neben der Fahrertür des Maserati und spähte mithilfe einer Stablampe ins Wageninnere.
»Was halten Sie davon, Nancy?«, erkundigte ich mich.
Barton hob den Blick, sah mich an und erhob sich. »Ihnen auch einen guten Morgen, Alex.«
»Hallo, Nancy. Was sagen Sie dazu?«
»Kein ›Wie geht’s, wie steht’s‹? Kein ›Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag‹?«
Ich grinste breit und erwiderte: »Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Vormittag, Frau Doktor.«
»Schon besser.« Barton lachte. »Tut mir leid, Alex, aber da bin ich altmodisch. Ich will der Menschheit wieder ein bisschen mehr Freundlichkeit einimpfen, zumindest der Menschheit in meiner unmittelbaren Umgebung.«
»Und wie funktioniert es?«, wollte Sampson wissen.
»Ziemlich gut, ehrlich gesagt«, erwiderte sie.
»Haben wir’s hier mit einem Unfall zu tun?«, wollte ich dann wissen.
»Kann sein.« Mit diesen Worten ließ sie sich wieder neben das Wrack sinken.
Ich kniete mich neben sie, und sie leuchtete mit ihrer Stablampe erneut ins Wageninnere und zeigte mir den Fahrer. Er hing kopfüber in seinem Sicherheitsgurt, trug einen Bell-Helm mit teilweise geschmolzenem Visier, eine Halsmanschette und einen feuersicheren Rennanzug, genau wie ein Formel-1-Pilot, mitsamt den dazugehörigen Stiefeln und Handschuhen.
»Der Anzug hat was genützt«, sagte Barton. »Keine Verbrennungen, soweit ich sehen kann. Der Airbag hat auch funktioniert, genau wie der integrierte Überrollbügel.«
»Aaron Peters«, sagte Sampson mit Blick auf sein Smartphone. »Ehemaliger Senatsmitarbeiter, heute wichtiger Öl-Lobbyist. Kein Wunder, dass der sich einen Maserati leisten konnte.«
Ich stand auf, um meine eigene Taschenlampe zu holen. »Feinde?«, erkundigte ich mich.
»Ich schätze mal, dass die automatisch dazugehören, wenn man für die Ölindustrie arbeitet.«
»Vermutlich.« Ich ging wieder in die Knie, knipste meine Lampe an und ließ den Strahl durch das Innere des verbeulten Sportwagens gleiten. Bei einem schwarzen Metallkästchen auf dem Armaturenbrett blieb ich hängen.
»Was ist denn das?«, wollte die Gerichtsmedizinerin wissen.
»Wenn mich nicht alles täuscht, steckt in dem Kästchen eine Kamera, wahrscheinlich eine GoPro. Womöglich hat er seine Fahrt gefilmt.«
»Ob die das Feuer überlebt hat?«, fragte Sampson nachdenklich.
»Vielleicht haben wir ja Glück.« Ich richtete den Lichtstrahl auf den rußgeschwärzten Helm des Fahrers. Dabei fielen mir ein paar Dellen im oberen Teil auf.
»Haben Sie die fotografiert?«, fragte ich Barton.
Sie nickte.
Ich streckte die Hand aus und löste den Kinnriemen. So behutsam wie möglich zog ich an dem Helm und brachte Aaron Peters’ Gesicht zum Vorschein. Seine feuerfeste Sturmhaube hatte die Flammen unbeschadet überstanden, war jedoch blutgetränkt. Der Grund dafür waren die beiden Schusskanäle, die quer durch Peters’ Schädel führten.
»Kein Unfall«, sagte ich.
»Ausgeschlossen«, pflichtete Barton mir bei.
Mein Handy klingelte. Ich wollte es eigentlich ignorieren, aber dann sah ich, dass Bryan Michaels, der Polizeichef, am Apparat war.
»Chief«, sagte ich.
»Wo stecken Sie?«
»Am Rock Creek. Ein Öl-Lobbyist ist in seinem Wagen erschossen worden.«
»Kommen Sie sofort nach Georgetown. Einer von unseren Leuten ist ermordet worden, aus einem fahrenden Auto heraus, zusammen mit einer anderen Person. Ich will unsere besten Kräfte vor Ort haben.«
Ich erhob mich, winkte Sampson zu unserem Auto, setzte mich in Bewegung und fragte: »Wer ist es, Chief?«
Er sagte es mir, und in mir krampfte sich alles zusammen.
3
Sampson setzte das Blinklicht auf das Dach und schaltete die Sirene ein. So rasten wir nach Georgetown. Während ich die Nummer meiner Ehefrau, Detective Bree Stone, wählte, fiel mir auf, dass es nicht mehr regnete. Bree musste heute vor Gericht aussagen, und ich konnte nur hoffen, dass sie …
Bree meldete sich mit den Worten: »War das am Rock Creek ein Unfall?«
»Mord«, erwiderte ich. »Aber zu deiner Information, Michaels hat uns gerade eben nach Georgetown geschickt. Zwei Todesopfer nach Schießerei. Ich fürchte, eines davon ist Tommy McGrath.«
Nach einer langen, fassungslosen Stille krächzte Bree: »Oh mein Gott, Alex, ich glaube, mir wird gleich schlecht.«
»Genauso ist es mir auch gegangen, als ich es erfahren habe. Muss ich irgendetwas wissen?«
»Über Tommy? Keine Ahnung. Er und seine Frau haben sich vor einer Weile getrennt.«
»Wieso?«
»Über Persönliches haben wir eigentlich nie geredet, aber ich habe gespürt, dass ihn das Ganze ziemlich mitgenommen hat. Außerdem war er ziemlich unzufrieden damit, dass er in seinem neuen Job keine eigenen Fälle mehr bearbeiten konnte. Er hat mal gesagt, dass ihm die Straße fehlt.«
»Das behalte ich im Hinterkopf. Ich melde mich, sobald wir da sind.«
»Danke«, erwiderte sie. »Jetzt muss ich erst mal ein bisschen weinen.«
Sie legte auf, und mein Magen rebellierte schon wieder, weil ich wusste, wie viel McGrath ihr bedeutet hatte. Er war Chief of Detectives gewesen, also Abteilungsleiter der Kriminalpolizei, durchaus umstritten und unser direkter Vorgesetzter. Aber vor vielen Jahren, als Bree sich gerade die ersten Sporen als Detective verdient und McGrath noch selbst als Ermittler unterwegs gewesen war, hatte er sie unter seine Fittiche genommen; sie waren sogar für kurze Zeit ein Team gewesen. Er hatte sie ununterbrochen unterstützt, während sie die Karriereleiter hinaufgeklettert war, und war auch derjenige gewesen, der sie an das Dezernat für Kapitalverbrechen empfohlen hatte.
Als Chief of Detectives war McGrath, aus meiner Sicht, immer ein kompetenter und fairer Vorgesetzter gewesen. Er konnte jedoch durchaus unangenehm werden und wusste genau, welche Strippen man ziehen musste, um bestimmte Dinge durchzusetzen. Er hatte sich also bestimmt auch Feinde gemacht. Einer seiner ehemaligen Partner war sogar überzeugt davon, dass McGrath bewusst für seine Entlassung aus dem Polizeidienst gesorgt hatte, und zwar mithilfe gefälschter Beweise.
Aber als Detective hatte Tommy immer einen hervorragenden Instinkt bewiesen. Er besaß ein natürliches Gespür für Menschen und war ein guter Zuhörer, und während wir jetzt quer durch die Stadt zum Schauplatz seiner Ermordung fuhren, wurde mir bewusst, wie sehr ich ihn vermissen würde.
Der 3200er-Block der Wisconsin Avenue war von Streifenwagen mit blauen Blinklichtern, uniformierten Polizeibeamten und Barrieren komplett abgeriegelt worden. Wir parkten also ein Stück weiter entfernt am Straßenrand, und ich nahm mir noch einen kurzen Moment Zeit, um mich innerlich auf das vorzubereiten, was ich gleich sehen und tun würde.
Ich habe etliche Jahre als Ermittler beim FBI und bei der Metropolitan Police auf dem Buckel. Das heißt, ich habe schon Hunderte von Tatorten gesehen. Normalerweise schlüpfe ich für die Arbeit in eine Art psychologischen Schutzanzug, der dafür sorgt, dass ich eine emotionale Distanz zu den Opfern wahren kann. Aber hier ging es um Tommy McGrath. Einen von uns, einen Bruder. Und dieser Bruder war einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Dieses Wissen riss ein paar Löcher in meinen Schutzanzug. Das Ganze erhielt dadurch eine sehr persönliche Komponente, und das ist etwas, was ich nicht gebrauchen kann, wenn ich mit einem Mord zu tun habe. Da bevorzuge ich die Rolle des rationalen, analytischen Beobachters.
Ich stieg also aus dem Zivilfahrzeug und versuchte, den distanzierten Ermittler zu geben. Aber als ich den Schauplatz der blutigen Tat erreicht hatte und McGrath in Turnhose und T-Shirt neben einer wunderschönen Frau in Yogakleidung liegen sah, beide von mehreren Schüssen tödlich getroffen, machte der kühle, rationale Alex Cross auf dem Absatz kehrt und suchte das Weite. Das hier war etwas Persönliches.
»Ich habe McGrath gemocht«, sagte Sampson mit einer Miene hart und düster wie Ebenholz. »Sehr sogar.«
Ein Streifenbeamter kam auf uns zu und berichtete, was sich laut Zeugenaussagen hier abgespielt hatte. Anscheinend war das Auto auf McGrath und die Frau zugerollt. Dann waren Schüsse gefallen, erst drei, und dann noch einmal zwei. Darin waren sich alle Zeugen einig.
McGrath war als Erster getroffen worden, danach die Unbekannte. Anschließend war Chaos ausgebrochen, wie immer, wenn irgendwo Schüsse fallen. Die Umstehenden hatten versucht, sich in Sicherheit zu bringen, hatten irgendwo Deckung gesucht, was natürlich absolut verständlich ist. Jeder Mensch hat das Recht zu überleben. Aber gleichzeitig machen Angst und Panik mir die Arbeit schwerer, weil ich schließlich sichergehen muss, dass das Urteil und das Erinnerungsvermögen der Zeugen nicht durch solche Gefühle beeinflusst werden.
Die Zeugen warteten im Inneren des Bio-Supermarkts auf uns, aber ich wollte zuerst noch einen Blick auf den gesamten Tatort und die Einkäufe werfen, die rund um die Opfer auf dem Boden lagen: frisches Obst und Gemüse, Bienenwachskerzen und zwei zerbrochene Flaschen Kombucha-Tee.
Im Rinnstein, etwa drei Meter von den Toten entfernt, lag eine Flasche Cliffton Dry, eine Art Apfel-Schaumwein. Seltsam.
»Was hast du denn, Alex?«, erkundigte sich Sampson.
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich dachte eigentlich, dass Tommy McGrath immer nur Budweiser getrunken hat.«
»Dann ist es eben ihre Flasche. Waren die beiden ein Paar?«
»Bree sagt, dass er von seiner Frau getrennt gelebt hat.«
»Eine Scheidung ist auf jeden Fall ein mögliches Mordmotiv«, meinte Sampson. »Aber das hier sieht mir doch viel eher nach Bandenkrieg aus.«
»Findest du? Das war ja nicht die übliche ›Wir-rattern-drauflos-und-hoffen-dass-wir-irgendwas-treffen‹-Nummer. Da war ein Präzisionsschütze am Werk. Fünf Schüsse, fünf Treffer.«
Wir sahen zu der Frau hinüber, die seltsam verdreht auf der Seite lag.
Da bemerkte ich ihre Gürteltasche, streifte mir Latexhandschuhe über und kniete mich neben sie, um den Reißverschluss aufzuziehen.
4
Neben sechs Fünfzig-Dollar-Scheinen fand ich in der Gürteltasche einen Studentenausweis der juristischen Fakultät der American University und einen Führerschein des District of Columbia, beide ausgestellt auf den Namen Edita Kravic. In drei Tagen hätte sie ihren zweiunddreißigsten Geburtstag gefeiert, und sie hatte ganz in der Nähe gewohnt.
Außerdem entdeckte ich zwei Visitenkarten mit der Aufschrift DER PHOENIX-CLUB – DAS NEUE NORMAL, was immer das heißen sollte. Laut der Visitenkarten arbeitete Edita dort als zertifizierte Level-zwei-Trainerin, was immer das wieder bedeuten sollte. Unter dem Namen des Clubs stand eine Telefonnummer in Virginia und eine Adresse in Vienna, in der Nähe von Wolf Trap.
Ich stand auf und dachte: Wer warst du, Edita Kravic? Und was warst du für den Chief of Detectives McGrath?
Sampson und ich betraten den Whole Foods und gingen zu den tief erschütterten Zeugen. Drei sagten aus, dass sie den ganzen Vorfall beobachtet hatten.
Die Kassiererin Melanie Winters berichtete, dass die Opfer des Anschlags unmittelbar zuvor im Laden gewesen seien. Sie hatten gelacht und miteinander gescherzt. Es hatte alles sehr harmonisch gewirkt, die Chemie zwischen den beiden hatte gestimmt, auch wenn McGrath sich in der Schlange bei Edita Kravic darüber beschwert hatte, dass er kein Bier kaufen durfte.
Ich warf Sampson einen Blick zu: »Na, was habe ich gesagt?«
Nachdem McGrath und Kravic den Laden verlassen hatten, war die Kassiererin zum Schaufenster gegangen, um ein paar leere Obstkisten wegzuräumen. Dabei hatte sie nach draußen geschaut und gesehen, wie eine dunkelblaue Limousine mit offenen Seitenfenstern herangefahren war. Im nächsten Augenblick waren die Schüsse gefallen. Winters hatte sich auf den Fußboden geworfen und war dort liegen geblieben, bis die Schüsse verstummt und der Wagen mit quietschenden Reifen davongerast war.
»Wie viele Leute haben im Wagen gesessen?«, wollte Sampson wissen.
»Das weiß ich nicht«, lautete ihre Antwort. »Ich habe nur Blitze gesehen und die Schüsse gehört.«
»Von wo kamen die Blitze?«, hakte ich nach. »Vom Beifahrersitz? Von der Rückbank? Von beiden?«
Sie zog die Stirn kraus. »Ich weiß es nicht.«
Lucas Phelps, Student an der Georgetown University, war gerade den Bürgersteig entlanggegangen und noch ungefähr einen halben Häuserblock von dem Geschäft entfernt gewesen. Als die Schüsse gefallen waren, hatte er einen Kopfhörer getragen und sich einen Podcast angehört. Im ersten Moment hatte er geglaubt, die Schüsse gehörten zu seiner Sendung, bis er McGrath und Kravic hatte zu Boden stürzen sehen.
»Was war es für ein Auto?«, wollte Sampson wissen.
»Da kenne ich mich nicht so gut aus«, erwiderte Phelps. »Ein Viertürer? Dunkle Farbe vielleicht.«
»Wie viele Insassen?«, fragte ich ihn.
»Zwei, glaube ich. Aber aus der Entfernung und dem Winkel war das nicht leicht zu erkennen.«
»Haben Sie das Mündungsfeuer der Schüsse gesehen?«
»Ja, klar, jetzt, wo Sie es sagen.«
»Von wo kam das Mündungsfeuer? Vom Beifahrersitz? Von der Rückbank? Von beiden?«
»Vorne«, erwiderte er. »Glaube ich jedenfalls. Es ist alles so schnell gegangen.«
Mit dem dritten Zeugen, einem gewissen Craig Brooks, stellte sich wieder einmal heraus, dass die Dreieckspeilung immer noch der beste Weg zur Wahrheitsfindung ist. Als die Schüsse fielen, war der zweiundsiebzigjährige pensionierte Steuerprüfer zu Fuß von Norden her unterwegs zu Whole Foods gewesen, um im Auftrag seiner Frau »was von diesem glutenfreien Mist« zu kaufen.
»Drei Leute haben im Auto gesessen, und der auf dem Beifahrersitz hat zum offenen Fenster rausgeschossen, mit einer Remington 1911 R1, Kaliber fünfundvierzig.«
»Woher wissen Sie das so genau?«, wollte Sampson wissen.
»Ich habe die Waffe gesehen, und außerdem liegt dort drüben eine Fünfundvierziger-Patronenhülse.«
Ich folgte seinem Blick und nickte. »Haben Sie sie angefasst?«
»Bin doch nicht blöd.«
»Vielen Dank. Die Automarke? Modell? Kennzeichen?«
»Es war auf jeden Fall ein GM. Das Modell habe ich nicht erkannt. Viertürer, dunkel lackiert, aber matt, nicht poliert. Könnte auch eine Grundierung gewesen sein. Keinerlei Auffälligkeiten, und die Kennzeichen waren verdeckt.«
»Männer? Frauen?«
»Die haben alle Baseballmützen und schwarze Masken getragen«, sagte Brooks. »Aber als sie an mir vorbeigefahren sind, habe ich die Mütze des Schützen deutlich gesehen. Sie war rot, mit einem Redskins-Logo drauf.«
Wir ließen uns die Telefonnummern geben, falls wir noch Nachfragen hätten, dann ging ich wieder nach draußen. Inzwischen war eine kriminaltechnische Einheit eingetroffen und hatte bereits angefangen, den Tatort zu dokumentieren.
Ich nahm die ganze Szenerie noch einmal genau in den Blick, mit den drei Schilderungen des Tathergangs im Hinterkopf. Ich hatte das Geschehen deutlich vor Augen.
»Der Schütze war außergewöhnlich gut. Er muss eine Ausbildung haben«, sagte ich.
»Kannst du das präzisieren?«, meinte Sampson.
»Er hat aus einem fahrenden Fahrzeug auf zwei bewegliche Ziele geschossen und bei fünf Versuchen fünfmal ins Schwarze getroffen.«
»Wobei die Schwierigkeit vor allem vom Winkel abhängt, richtig?«, ergänzte Sampson. »Also von der Frage, wo und wann er angefangen hat zu schießen. Aber ich stimme dir zu: Er war vorbereitet.«
»Und McGrath war das erste Ziel. Der Schütze hat dreimal auf ihn geschossen, bevor er Edita Kravic noch zwei Kugeln verpasst hat.«
Ein Kriminaltechniker fotografierte die Opfer im Licht einer matten Aluminiumleuchte. Ich hatte mir den toten McGrath jetzt mindestens sechs Mal angesehen. Jedes Mal fiel es mir ein bisschen leichter. Jedes Mal wurde die Distanz zwischen uns ein wenig größer.
5
Ein Polizistenmord spricht sich schnell herum. Als Sampson und ich schließlich durch eine Gasse hinter dem Whole Foods verschwanden, hatte die Wisconsin Avenue sich in einen riesigen Medienzirkus verwandelt. Aber wir wollten erst dann mit irgendwelchen Berichterstattern sprechen, wenn wir auch etwas zu berichten hatten.
Nachdem wir wieder in unserem Wagen saßen und Sampson losgefahren war, rief ich Chief Michaels an und brachte ihn auf den neuesten Stand.
»Wie viele Leute brauchen Sie?«, wollte er wissen, nachdem ich meinen Bericht beendet hatte.
Ich überlegte. »Vier, Sir, einschließlich Detective Stone. Sie war mit McGrath befreundet. Sie wird auf jeden Fall mit dabei sein wollen.«
»In Ordnung. Ich stelle Ihnen so schnell wie möglich ein Team zusammen.«
»Geben Sie uns noch eine Stunde, Sir«, sagte ich. »Wir wollen erst noch in McGraths Wohnung vorbeifahren, bevor wir ins Präsidium kommen.«
»Drehen Sie jeden Stein um, Alex«, sagte Michaels.
»Jawohl, Sir.«
»Sie werden auch Terry Howard unter die Lupe nehmen müssen.«
»Soweit ich gehört habe, geht es Terry alles andere als gut.«
»Trotzdem. Früher oder später wird sich jemand nach ihm erkundigen, und dann müssen wir sagen können, dass wir ihn befragt haben.«
»Das erledige ich persönlich.«
Michaels legte auf. Ich wusste, dass er bereits den ersten Druck spürte. Wenn ein Kollege ermordet wird, will man so schnell wie möglich Gerechtigkeit schaffen. Man will Solidarität mit dem Opfer demonstrieren, den Fall zügig aufklären und einen Verantwortlichen vor Gericht stellen. Andererseits will man auch auf keinen Fall voreilige Schlüsse ziehen, bevor nicht alle Indizien ausgewertet sind. Jetzt hatten wir sechs Detectives im Team. Wir alle würden in den nächsten Tagen Tag und Nacht arbeiten und dabei sehr schnell sehr viele Fakten zusammentragen.
Ich machte die Augen zu und holte ein paarmal tief Luft, stählte mich für die vor uns liegenden, harten Tage, die mir keine Zeit für meine Familie lassen würden.
Die Arbeit schreckte mich nicht, die erzwungene Trennung von meiner Familie hingegen sehr wohl. Es geht mir besser, wenn ich ab und zu zu Hause bin. Dann fühle ich mich geerdeter. Und außerdem bin ich dann ein besserer Polizist.
Der Wagen verlangsamte seine Fahrt. »Wir sind da, Alex«, sagte Sampson.
McGrath bewohnte eine Erdgeschosswohnung in einem restaurierten Mehrfamilienhaus unweit des Dupont Circles. Wir benutzten den Schlüssel, den unser ermordeter Vorgesetzter bei sich getragen hatte, und schlossen seine Wohnungstür auf.
Die Türangeln waren gut geölt, und die Tür ließ sich ohne das leiseste Quietschen öffnen. Dahinter kam ein spärlich möbliertes Apartment zum Vorschein – zwei Liegesessel, ein Fernseher mit einem gebogenen Bildschirm und in der Ecke ein Stapel Umzugskartons. Es sah so aus, als wäre McGrath noch gar nicht ganz eingezogen.
Bevor ich mich mit Sampson darüber austauschen konnte, ertönte im hinteren Teil der Wohnung ein lauter Knall, und wir hörten hastige Schritte.
Ich zog meine Waffe und zischte: »Sampson, auf die Rückseite.«
Mein Partner machte auf dem Absatz kehrt und rannte los, machte sich auf die Suche nach einem Durchgang in die hinter dem Haus verlaufende Gasse. Ich schob mich, die Dienstpistole im Anschlag, zügig durch die Wohnung und nahm nebenbei die wenigen restlichen Besitztümer unseres ermordeten Vorgesetzten in Augenschein.
Als ich in die Küche kam, sah ich ein offenes Fenster. Ich steckte den Kopf nach draußen und sah Sampson unter mir vorbeiflitzen. Er verfolgte einen männlichen Weißen in Jeans, einem schwarzen AC/DC-T-Shirt und einer schwarzen Golfmütze auf den wilden, blonden Stachelhaaren.
Er war ein kraftvoller Läufer, mit Sicherheit ein Leichtathlet. Er trug einen schwarzen Rucksack, und trotzdem waren seine Schritte federnd und leicht. Der Abstand zwischen ihm und meinem Partner wurde unaufhörlich größer. Ich drehte mich um, rannte durch McGraths Wohnung und zur Haustür hinaus, sprang in den Wagen, schaltete Blaulicht und Sirene ein und raste los, wollte den Flüchtigen stellen.
Bei der Ecke Twenty-Fifth Street/I Street jagte ich um die Kurve und sah gerade noch, wie er einem Fußgänger auswich und dann hinter der nächsten Straßenecke verschwand. Wahnsinn, wie schnell er war. Sampson kam jetzt erst aus der Gasse hervor. Er war mindestens hundert Meter hinter dem Flüchtigen.
Ich wollte Vollgas geben und dem Kerl mit allem, was ich hatte, hinterherrasen, aber ich wusste, dass wir geschlagen waren. Die I Street macht am Ende des Blocks eine Biegung und wird zur Twenty-Sixth Street, während man geradeaus in den Rock Creek Park gelangt. Dort war das Gelände so dicht bewachsen und so hügelig, dass jemand, der so schnell zu Fuß war wie unser Mann, dort problemlos untertauchen konnte. Eigenartig, dass die Stelle, wo heute am frühen Morgen der Maserati gegen einen Baum geprallt und explodiert war, in Luftlinie gar nicht weit von hier entfernt war.
Ich schaltete die Sirene aus, hielt neben Sampson an und stieg aus.
»Alles in Ordnung, John?«
Nach vorn gebeugt, die Hände auf die Knie gestützt, so stand mein Partner da. Er war schweißgebadet und schnappte nach Luft.
»Hast du das gesehen?«, stieß er heiser hervor. »Der Typ war fast so schnell wie der Flash oder so.«
»Beeindruckend«, pflichtete ich ihm bei. »Die Frage ist: Was hatte der Flash in Tommy McGraths Wohnung zu suchen?«
6
Zwei Stunden später lenkte Detective Bree Stone ihren Wagen nach West Langley, ein ziemlich schickes Wohnviertel in McLean, Virginia.
»Was glaubst du denn, was Tommy auf seinem Laptop hatte?«, erkundigte sich Detective Kurt Muller, der ältere Mann auf dem Beifahrersitz neben ihr. Dabei zwirbelte er die Enden seines Schnurrbarts zu festen, spitzen Locken.
»Etwas, das dafür gesorgt hat, dass der Laptop gestohlen wurde. Vielleicht musste er deswegen sogar sterben«, sagte Bree und dachte noch einmal an die Sitzung, aus der sie gerade kamen, und die Informationen, mit denen Alex und Sampson sie dort versorgt hatten.
Es gab eine Menge zu verarbeiten, aber sie waren sich sicher, dass der flinke Einbrecher sich McGraths Computer und vermutlich auch die externe Festplatte mit den Sicherungskopien geschnappt hatte. Die IT-Experten der Metro Police hatten sich bereits McGraths Dienstakten vorgenommen, und ein Detective sah sich die Aufnahmen sämtlicher Überwachungskameras in einem Radius von sechs Häuserblocks um den Whole Foods an. Ein weiterer Ermittler befasste sich mit den abgeschlossenen Fällen, die McGrath bearbeitet hatte, falls dort irgendetwas vorgefallen war, das als Grund für eine Hinrichtung hätte dienen können.
Alex hatte Bree und Muller gebeten, McGraths getrennt lebende Ehefrau in ihrem Haus in McLean, Virginia, aufzusuchen. Alex und Sampson wollten sich auf Edita Kravic und Terry Howard konzentrieren.
»Ich hab gehört, dass Howard krank sein soll«, sagte Muller.
»Die Vorstellung, dass er was damit zu tun hat … grässlich«, erwiderte Bree.
»Geht mir auch so«, meinte Muller. »Wir waren sogar mal befreundet.«
Sie verlangsamte die Fahrt, entdeckte den Briefkasten mit der Adresse, nach der sie suchte, und bog in eine lang gezogene Einfahrt ein, die zu einem weitläufigen, mit Zedernschindeln verkleideten, einstöckigen Haus mit üppigem Landschaftsgarten führte.
»Das muss ein kleines Vermögen gekostet haben«, sagte Bree.
»Eins Komma fünfundsiebzig Millionen«, bestätigte Muller. »Habe ich vor der Abfahrt noch recherchiert.«
»Wie kann sich der Abteilungsleiter der Kriminalpolizei so eine Hütte leisten?«
»Indem er eine Frau mit Geld heiratet«, meinte Muller. »Sie hat einen Treuhandfonds in die Ehe eingebracht.«
Bree kaute auf der Innenseite ihrer Backe herum. Während sie den Wagen abstellte, sagte sie: »Und warum habe ich nichts davon gewusst?«
»Dann hat er dich wahrscheinlich nie zum Abendessen oder zu einem Grillnachmittag eingeladen, was?«
»Ich war noch nie im Leben hier.«
»Ich schon.« Muller stieg aus.
Bree folgte ihm die Einfahrt entlang. Als sie noch sechs, sieben Meter entfernt waren, ging die Haustür auf, und ein groß gewachsener, gepflegt wirkender Mann in einem gut geschnittenen Anzug stand vor ihnen. Er hatte einen Aktenkoffer in der Hand und stutzte, als er sie sah.
Jetzt tauchte hinter ihm eine Frau Mitte vierzig auf. Sie hatte rötlich-blonde Haare und den Körper einer Tennisspielerin, dazu verquollene, gerötete Augen und einen gequälten Gesichtsausdruck.
»Kurt«, rief sie Muller mit bebender Stimme zu. »Wie schrecklich, dass wir uns so wiedersehen müssen.«
Muller nickte. »Geht mir ganz genauso, Vivian.«
Der gut gekleidete Mann drehte sich halb zu ihr um.
Vivian McGrath machte eine geistesabwesende Handbewegung. »Kurt, darf ich vorstellen: Lance Gordon, mein Anwalt. Detective Muller hat für Tommy gearbeitet, Lance.«
»Ich auch«, sagte Bree.
»Mein herzliches Beileid, Ihnen allen«, sagte Gordon. »Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, Vivian, rufen Sie mich jederzeit an.«
»Ich weiß das sehr zu schätzen, Lance«, sagte sie. »Wirklich.«
Der Rechtsanwalt spitzte die Lippen und nickte. Dann ging er an Muller und Bree vorbei. Bree fiel auf, dass ein seltsam süßlicher Duft von ihm ausging. Irgendwie kam ihr der bekannt vor, aber sie wusste nicht, woher.
Bree und Muller traten auf McGraths Witwe zu. Muller sagte: »Das muss schwer für dich sein, Viv. Trotz allem, was zwischen euch vorgefallen ist.«
Bree vergaß Gordon und konzentrierte sich ganz auf Vivian McGrath. Tränen liefen ihr übers Gesicht, und sie schluckte mehrfach, um ihre Gefühle wieder in den Griff zu bekommen.
»Das stimmt«, presste sie dann hervor. »Ich hatte ihn ja schon verloren. Aber das? Das ist so …«
Muller tätschelte ihr ungelenk die Schulter und sagte: »Viv, das ist Detective Bree Stone. Wir gehören beide zu der Sonderkommission, die Toms Tod aufklären soll. Alex Cross leitet sie.«
Vivian lächelte schwach. »Für Tommy nur die Besten.«
Dann legte sie Bree ihre sorgfältig manikürte Hand auf den Arm und sagte: »Er hat oft von Ihnen gesprochen, Detective Stone. Bitte, kommen Sie doch rein. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten?«
»Gern«, sagte Bree, und Muller nickte.
Sie führte ihre Besucher durch mehrere Zimmer, die allesamt eine Fotostrecke im Architectural Digest verdient gehabt hätten, in eine Küche mit freigelegten Deckenbalken, cremefarbenen Schränken und einem weinroten Herd.
Über einer Kücheninsel hingen blitzblank geputzte Kupfertöpfe. Sämtliche Oberflächen waren makellos sauber. Jedes Messer, jedes Küchengerät schien an seinem vorgesehenen Platz zu liegen. Fast ein bisschen steril, nach Brees Empfinden. Keine Bilder am Kühlschrank, keine Post auf dem Tresen, kein Geschirr in der Spüle.
»Setzt euch doch, bitte«, sagte Vivian und deutete auf die Hocker an der Frühstückstheke. »Was wollt ihr wissen? Wie kann ich euch helfen?«
»Stimmt es, dass Sie und Tom sich scheiden lassen wollten?«, begann Bree.
»Wir hatten uns getrennt, richtig.« Sie schniefte. »Was möchten Sie denn gerne? Einen Espresso? Eine Latte?«
»Gerne Espresso«, erwiderte Bree.
»Latte«, sagte Muller und befühlte seinen Schnurrbart.
Die Espressomaschine, die in einer Ecke der Küche stand, hätte Bree wahrscheinlich ein ganzes Monatsgehalt gekostet. Vivian drückte auf eine Taste, dann fing das Gerät an zu dampfen und zu zischen und spuckte schließlich eine schwarze, himmlisch duftende Brühe aus.
Nachdem Vivian ihr die Tasse mitsamt Untertasse vorgesetzt hatte, sagte Bree: »Die Trennung.«
McGraths Witwe verhärtete ihre Miene und verschränkte die Arme vor der Brust. »Was ist damit?«
»Ging das von Tom aus?«, wollte Muller wissen. »Oder eher von dir?«
»Hat Tom dir das nie erzählt?«
»Gehen Sie davon aus, dass wir völlig ahnungslos sind«, sagte Bree.
»Ich habe die Trennung vorgeschlagen, aber es war wegen Tom«, sagte sie mit trostlosem Blick. »Ich habe immer geglaubt, dass wir es schaffen können. Er war so anders als alle anderen in meinem sozialen Umfeld. Wir haben siebzehn Jahre lang an uns gearbeitet, und dann, mit einem Mal, nicht mehr. Ich weiß immer noch nicht, wieso eigentlich.«
Dann brach sie schluchzend zusammen.
7
Bree holte tief Luft. Sie empfand im Moment eher Ungeduld als Mitleid.
Nachdem Vivian sich wieder im Griff hatte, sagte Bree: »Könnten Sie uns vielleicht noch ein bisschen konkreter beschreiben, was Sie damit gemeint haben, dass Sie Ihren Mann schon verloren hatten?«
Vivian McGrath trocknete sich mit einem Papiertaschentuch die Tränen ab, warf Muller einen kurzen Blick zu und sagte: »Er hat mich nicht mehr angefasst, wenn Sie es genau wissen wollen. Und ich hatte das Gefühl, dass er Dinge vor mir geheim hält. Er hatte ein zweites Handy. Hat Geld ausgegeben, das er gar nicht hatte. Ich bin davon ausgegangen, dass er eine Geliebte hat.«
Bree sagte nichts dazu.
»Hatte er denn eine Geliebte?«, hakte Muller nach.
»Ich weiß es nicht«, erwiderte Vivian. »Ich glaube schon. Sag du’s mir. Ich meine, ich habe keinen Schnüffler engagiert, aber ich habe gemerkt, dass Tommy mit mir nicht mehr glücklich war. Darum habe ich ihn vor drei Monaten gefragt, ob er mich immer noch liebt. Er hat mir keine Antwort gegeben. Dann habe ich ihn gefragt, ob er sich trennen will oder scheiden lassen. Er hat gesagt, dass er das mir überlässt.«
»Aber wenn Sie eigentlich gerne mit ihm zusammenbleiben wollten, warum haben Sie sich für eine Trennung entschieden?«, erkundigte sich Bree.
Vivian tupfte sich erneut die Augen, setzte sich dann kerzengerade hin und sah Bree gefasst an. »Ich dachte, er würde dadurch wieder zur Vernunft kommen. Ich dachte, dass er sich für mich entscheiden würde.«
»Aber das hat er nicht getan«, sagte Muller.
Sie wirkte gedemütigt. »Nein.«
»Haben Sie die Scheidung schon eingereicht?«, wollte Bree jetzt wissen.
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Weil ich ihn immer noch geliebt habe«, sagte sie. »Weil ich gehofft habe …«
»Das muss sehr schmerzhaft gewesen sein«, sagte Bree.
»Es war schmerzhaft, es war erniedrigend und es hat mich trauriger gemacht, als Sie sich vorstellen können, Detective Stone«, sagte sie mit gequälter Miene.
»Auch wütend?«
Vivian sah Bree direkt ins Gesicht. »Natürlich.«
»So wütend, dass du ihn hättest umbringen können?«, hakte Muller nach.
»Niemals. Wir haben uns im Fernsehen oft diese Sendungen angeschaut, wo immer die Ehepartner die Mörder sind. Wir haben immer gesagt, dass wir das nicht begreifen können. Wenn die Ehe nicht mehr funktioniert, geht man eben auseinander. Man versucht, irgendwie befreundet zu bleiben oder auch nicht, und dann lebt man weiter.«
»Wie hatten Sie die finanziellen Dinge in Ihrer Ehe geregelt?«, wollte Bree wissen.
»Wir haben einen Ehevertrag, falls Sie darauf anspielen«, erwiderte Vivian. »Vom Tag unserer Heirat vor siebzehn Jahren an hat Tom gewusst, dass er im Fall einer Scheidung keinen Cent bekommen würde.«
»War er vielleicht sauer deswegen?«, fragte Muller.
Vivian schnaubte. »Im Gegenteil. Tommy wollte es genau so haben, er war sogar stolz darauf. Er hat gesagt, dass es zeigt, dass er mich nur wegen …«
Erneut schossen ihr die Tränen in die Augen. Sie holte tief Luft. »Die persönliche Unabhängigkeit, die damit verknüpft war, hat ihm gefallen. Die Eigenständigkeit.«
»Wie haben Sie Ihr gemeinsames Leben gestaltet?«, wollte Bree dann wissen. »Ich meine, Sie sitzen hier draußen und führen eine Country-Club-Existenz, während Tom in der Stadt einer recht gefährlichen Arbeit nachgegangen ist.«
Alle möglichen Gefühlsregungen waren jetzt auf Vivians Gesicht abzulesen – Widerstand, nachdenkliches Abwägen und schließlich Einwilligung. Sie ließ die Schultern sinken.
»Je länger ich darüber nachdenke, Detective Stone, desto klarer wird mir, dass Tom und ich in völlig unterschiedlichen Welten gelebt haben, und zwar von Anfang an. Hier waren wir geborgen, fast wie im Märchenland, aber dort draußen in Washington, auf der Straße … tja, Tom wollte eben immer ein Drachentöter sein. Bei seiner Arbeit hat er sich lebendig gefühlt, aber wenn ich ihn in die Stadt begleitet habe … ich habe immer nur Angst empfunden.«
Muller sagte: »Er ist zusammen mit einer jungen Frau ermordet worden.«
»Das habe ich schon gehört. Wer war sie?«
»Edita Kravic, Anfang dreißig. Jurastudentin an der American University und verdammt attraktiv.«
Die Tatsache, dass die Frau, die mit ihrem getrennt lebenden Ehemann zusammen ermordet worden war, Anfang dreißig und verdammt attraktiv gewesen war, wirkte auf Vivian wie eine brutale Rechts-Links-Kombination.
»War sie seine Geliebte?«, erkundigte sie sich mit gepresster Stimme.
»Das wissen wir nicht«, antwortete Bree. »Hat er ihren Namen in Ihrer Gegenwart vielleicht einmal erwähnt?«
»Nein, nie.«
»Nur, damit wir das geklärt haben, Mrs. McGrath«, sagte Bree. »Wo waren Sie heute Morgen um 7.20 Uhr?«
Vivian starrte sie ungläubig an. »Glauben Sie etwa ernsthaft, dass ich Tom hätte umbringen können?«
»Wir müssen das fragen, Viv«, sagte Muller. »Das gehört zu unserem Job. Du weißt doch, wie es ist.«
»Wahrscheinlich habe ich gerade unter der Dusche gestanden.«
»Hat Sie jemand gesehen?«
»Hoffentlich nicht. Ich lebe allein.«
»Wen haben Sie heute Morgen als Erstes gesehen?«
»Das war Catalina Monroe. Meine Masseurin. Um 8.00 Uhr.«
»Wissen Sie, wie wir sie erreichen können?«
McGraths Witwe ratterte eine Telefonnummer herunter und sagte dann: »Wisst ihr, wen ihr euch mal vorknöpfen solltet?«
»Wen denn?«, wollte Bree wissen.
»Terry Howard.« Der gehässige Unterton in Vivians Stimme war nicht zu überhören. »Er hat Tom bedroht, und zwar mehr als einmal.«
»Den hat Cross übernommen«, sagte Muller.
»Gut. Gut. Ich hatte bloß Angst, es könnte … na ja, du weißt schon.«
»Wollen Sie eine Trauerfeier abhalten?«, erkundigte sich Bree.
Vivian wirkte mit einem Mal noch verwirrter als zuvor. Sie senkte den Blick und flüsterte: »Muss ich das machen? Ich weiß ja nicht einmal, ob Tommy das überhaupt gewollt hätte.«
Muller sagte: »Du solltest dir vielleicht erst mal Zeit nehmen und an die schönen Momente denken, die du mit Tommy gehabt hast, dir darüber klar werden, was dir die gemeinsame Zeit bedeutet hat. Falls du dann das Gefühl hast, dass die Liebe, die Tommy dir einmal entgegengebracht hat, das trägt, dann machst du es. Und wenn nicht, dann eben nicht.«
»Falls Sie sich entschließen sollten, keine Trauerfeier zu veranstalten, übernehme ich das«, sagte Bree.
Wie betäubt blickte McGraths Witwe sich um. Mit bebendem Kiefer sagte sie dann: »Nein, Kurt hat recht. Ich möchte unsere Liebe wertschätzen und meinen Mann … den Mann, der Tommy für mich war, beerdigen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann.«
Der Damm brach, und sie fing an zu schluchzen. »Es ist das Einzige, was ich jetzt noch für ihn tun kann.«
8
Edita Kravics Apartment in Columbia Heights sah aus wie aus einem exklusiven Einrichtungskatalog – hochwertige Möbel, sorgfältig gerahmte Bilder an der Wand –, und angesichts der Lage betrug die Miete garantiert zwei-, vielleicht sogar dreitausend Dollar im Monat.
Das kam mir ziemlich seltsam vor, schließlich nagten Jurastudenten normalerweise am Hungertuch. Edita hingegen schien als zertifizierte Level-zwei-Trainerin ganz gut zurechtzukommen.
Die Küche war mit viel Kochstudio-Schnickschnack ausgestattet, und im Kühlschrank lagerten neben Gourmetkäse und -brotaufstrichen auch etliche exquisite Weine. In den Schränken fand sich viel edles Kristall, aber nirgendwo war auch nur ein Foto zu sehen, nicht der kleinste Hinweis auf Edita Kravics Privatleben, nichts, woraus wir mehr über sie hätten erfahren können.
Das Apartment besaß drei Schlafzimmer. Das kleinste davon war als Büroraum genutzt worden. Auf dem Schreibtisch stand eine kleine Telefonanlage für mehrere Leitungen sowie ein aufgeklappter Laptop.
»Ich sehe mich hier mal um«, sagte ich.
»Ich nehme mir die anderen Zimmer vor«, meinte Sampson.
Genau wie im Wohnzimmer gab es auch hier keine persönlichen Gegenstände in den Regalen oder an den Wänden. Nur einen einfachen Schreibtisch, einen Stuhl ohne Rückenlehne und zwei Aktenschränke aus Holz. Ich wollte eine Schublade am ersten Schrank aufziehen, doch sie war abgeschlossen. Die oberste Schublade des anderen Schranks hingegen ließ sich öffnen. Darin lagen nur ein paar gängige Büroartikel.