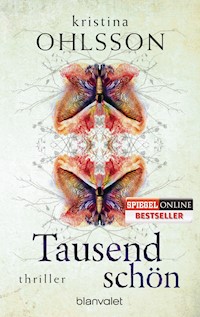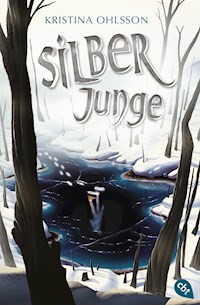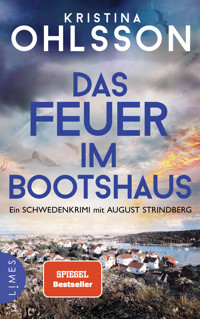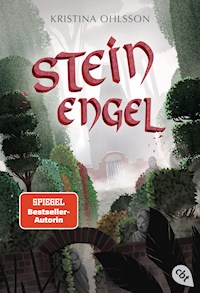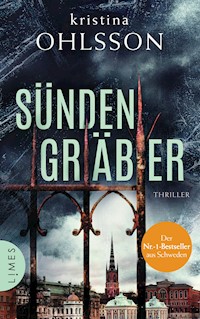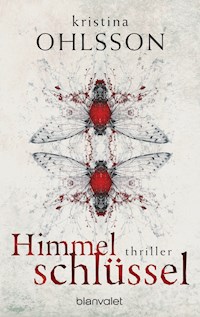9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Krimi
- Serie: Fredrika Bergman / Stockholm Requiem
- Sprache: Deutsch
Ein Lehrer wird ermordet. Zwei Kinder verschwinden. Eine düstere Legende erwacht zum Leben.
In der Nacht erwacht er zum Leben, erwählt ein Kind und verschwindet mit seinem Opfer in der Dunkelheit. Der Papierjunge. Eigentlich glaubt niemand an die jüdische Sagengestalt – bis an einem eiskalten Wintertag in Stockholm eine Erzieherin vor den Augen von Schülern und Eltern erschossen wird. Als wenig später zwei Kinder verschwinden, fragen sich die Ermittler Fredrika Bergman und Alex Recht, ob der Junge aus der Legende etwas mit den Vorfällen zu tun haben könnte. Die Ermittlungen führen Fredrika nach Israel, wo sie mit einem grausamen Verbrechen aus der Vergangenheit konfrontiert wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Kristina Ohlsson
Papierjunge
Thriller
Deutsch von Susanne Dahmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2013unter dem Titel »Davidsstjärnor«bei Piratförlaget, Stockholm.
1. Auflage
Copyright © 2013 der Originalausgabe by Kristina Ohlsson
Published by agreement with Salomonsson Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2015
by Limes Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Leena Flegler
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-15936-8
www.limes-verlag.de
DIEANGSTKAMMITDERDunkelheit. Er hasste die Nächte. Die Entfernung zwischen seinem Zimmer und der Geborgenheit, die das Schlafzimmer der Eltern versprach, fühlte sich jedes Mal unendlich groß an. Oft versteckte er sich sogar lieber unter der Decke, als sich auf den dunklen Flur vor seiner Zimmertür hinauszuwagen.
Er merkte seiner Mutter an, dass seine Angst vor der Nacht ihr Sorgen bereitete. Manchmal schrie er laut, wenn er einen Albtraum hatte, und dann kam sie immer, strich ihm über die Stirn und flüsterte, alles sei gut, machte die Nachttischlampe an und zog das Rollo vor seinem Fenster hoch.
»Da ist nichts, David. Nichts, was dir schaden könnte. Sieh nur.«
Und dann wollte sie das, was alle Eltern wollen: Er sollte selbst nachsehen. Sehen, dass dort draußen keine Gefahren lauerten.
Aber David hatte keine Angst vor dem, was man mit bloßem Auge erkennen konnte. Er fürchtete sich vor dem, was man erst dann bemerkte, wenn es schon zu spät war. Vor Gefahren, die sich in der schützenden Dunkelheit und in völliger Stille umherbewegten. David fürchtete etwas, wovor man sich nicht schützen konnte.
Avital hatte sie ihm erzählt, die Geschichte des Jungen, der Kinder hasste und ihnen in der kargen Landschaft auflauerte, die sich um ihr Dorf herum erstreckte. Avital hatte ihn »Papierjunge« genannt.
»Tagsüber schläft er, und wenn die Sonne untergeht, dann steht er auf«, hatte er ihm eines Tages zugeflüstert, als sie sich in seinem Baumhaus versteckt hatten, weil David nicht nach Hause gehen wollte. »Dann sucht er sich ein Kind aus und holt es sich.«
David spürte, wie sich seine Eingeweide zusammenzogen. »Und wie sucht er es sich aus?«, flüsterte er.
»Das kann man nie wissen. Sicher ist nur, dass keiner sicher sein kann.«
David versuchte, seine Angst herunterzuschlucken. »Das hast du dir bloß ausgedacht.«
Der Boden des Baumhauses war hart und der Wind viel zu kühl. Er hatte nur Shorts und einen kurzärmeligen Pullover an und merkte, dass er allmählich anfing zu frieren.
»Gar nicht!«
Avital war schon immer der Draufgängerische von ihnen beiden gewesen. Niemals ängstlich und immer bereit, für das, was er meinte oder was er haben wollte, zu streiten. Aber er war auch ein guter Freund. Das hatte Davids Papa schon mehrmals gesagt: dass aus Avital später einmal ein guter Mann und ein tapferer Soldat werden würde. Einer, der das Richtige tat und nicht das Falsche und der sich für seine Freunde und für sein Volk einsetzte. Was er von David dachte, hatte er nicht erwähnt, aber David meinte zu wissen, dass er ihn anders einschätzte als Avital.
»Nachts, wenn wir schlafen, dann kommt er. Er wartet draußen vor dem Fenster, und wenn wir am allerwenigsten damit rechnen, kommt er und holt sich uns. Du schläfst also besser nicht bei offenem Fenster«, warnte Avital ihn.
Die Worte drangen in Davids Kopf wie Pfeilspitzen, die man nicht wieder herausziehen konnte.
Von diesem Tag an musste das Fenster geschlossen bleiben.
Doch als der Sommer kam und die trockene Hitze übers Land wälzte, hatte seine Mutter genug.
»Man kann vor Hitze auch krank werden, David. Du musst die kühle Nachtluft reinlassen.«
Er ließ zu, dass sie das Fenster öffnete, und dann wartete er, bis sie selbst schlafen ging. Sobald das Haus still war, stand er auf und machte das Fenster wieder zu. Dann erst konnte er einschlafen.
Aber richtig sicher konnte er sich trotzdem niemals sein.
Das erklärte Avital ihm eine Weile später.
»Wenn er wütend wird, dann ist er total stark«, sagte er zu David. »Da können ihn keine Türen, keine Wände und keine Fenster aufhalten. Da kann man nur noch hoffen.«
»Worauf hoffen?«
»Dass er sich einen anderen holt.«
Das gab letztlich den Ausschlag. Danach war Davids Angst, allein schlafen zu müssen, größer als die Furcht vor dem Flur zum Schlafzimmer der Eltern. Nacht für Nacht schlich er zu ihnen, und er wurde nur abgewiesen, wenn seine kleine Schwester ihm zuvorgekommen war.
»Komm, mein Kleiner«, flüsterte seine Mutter, und dann durfte er unter ihre Bettdecke kriechen.
Aber er schlief nicht, jedenfalls nicht mehr als ein paar Stunden in der Morgendämmerung, und das brachte neue Probleme mit sich. Er war gerade in die Schule gekommen und schlief während des Unterrichts ein. Die Lehrer machten sich Sorgen und riefen seine Eltern an, die daraufhin mit ihm zum Arzt gingen.
»Der Junge ist erschöpft«, sagte der Arzt. »Lassen Sie ihn ein paar Tage ausruhen, dann wird er wie ausgewechselt sein.«
David durfte zu Hause bleiben, und Avital kam mit den Hausaufgaben und erzählte ihm, was sie in der Schule gemacht hatten. Insgeheim wünschte David sich, die Lehrerin hätte einen anderen geschickt. Er hatte versucht, Avital aus dem Weg zu gehen, damit der ihm nicht noch mehr schlimme Geschichten erzählte. Doch es war, als sollte er ihm nicht entkommen. Avital hatte gerade den Reißverschluss seines Rucksacks zugezogen und stand von Davids Bettkante auf, um nach Hause zu gehen, da sagte er: »Hast du ihn schon gesehen? Ich meine, nachts?«
David schüttelte heftig mit dem Kopf.
»Ich glaube, er wird bald kommen«, sagte Avital.
Es sollte noch einige Zeit dauern, bis es so weit wäre.
Jahrzehnte.
David und Avital verließen das Dorf, in dem sie aufgewachsen waren, und landeten zufällig im selben Kibbuz.
Und dann kam er. Der Papierjunge. Aus dem Kibbuz verschwand ein Kind. Zehn Tage und zehn Nächte lang suchten die Erwachsenen gemeinsam mit der Polizei und dem Militär nach ihm. Schließlich fand man seine Leiche, und sie war so übel zugerichtet, dass man den anderen Kindern nicht erzählen wollte, was ihm widerfahren war.
Sie wussten es trotzdem.
David und Avital, zu jener Zeit bereits erwachsene Männer, sahen einander in schweigendem Einverständnis an. Sie wussten, was dem Jungen zugestoßen war.
Der Papierjunge hatte ihn sich geholt.
Und es war nur eine Frage der Zeit, bis er zurückkommen würde.
Schluss Fragment I
DIEFRAU, DIENOCHNICHTweiß, dass an der nächsten Straßenecke bereits die Hölle auf sie wartet, geht entschlossenen Schrittes den Bürgersteig entlang. Vom dunklen Himmel fällt Schnee und legt sich wie gefrorene Engelstränen auf ihre Schultern und auf ihren Kopf. In der Hand hält sie einen Geigenkasten. Der Tag war lang, und sie will nur noch nach Hause.
Heim zu ihrer Familie.
Zu den schlafenden Kindern und zu ihrem Ehemann, der mit Wein und Pizza auf sie wartet.
Vielleicht empfindet sie sogar ein Gefühl des Friedens. Eine Geschichte, die sie lange umgetrieben hat, scheint zu Ende gegangen zu sein. Sie merkt erst jetzt, was für eine Belastung dies alles für sie gewesen ist. Es nun hinter sich gebracht zu haben wird vieles verändern.
Je näher sie ihrem Wohnviertel kommt, umso länger werden ihre Schritte. Endlich wird sie sich die Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen. Um sich zu erholen. Um wieder Kraft zu schöpfen.
Sie hat Sehnsucht, geht noch schneller.
Da hört sie es. Das Geräusch, das die winterliche Stille durchschneidet, trifft sie wie ein Hammerschlag.
Laute Sirenen.
Überall Blaulicht.
Autos überholen sie mit laut heulenden Martinshörnern und rasen an ihr vorbei.
Sie weiß intuitiv, wohin sie unterwegs sind.
Zu ihr nach Hause.
Sie rennt schneller, als sie je gerannt ist. Sie läuft um ihr Leben und doch direkt in die Arme des Todes. Das Geräusch ihrer Schritte wird vom Schnee gedämpft, und ihr Atem wird zu dichten Wolken. Als sie um die letzte Ecke gebogen ist, sieht sie das Blaulicht über die Fassaden flackern. Überall Menschen. Männer und Frauen in Uniform, auf den Bürgersteigen und auf der Straße. Laute Stimmen. Aufgeregte Gesichter. Jemand weint ungehemmt, ein anderer schreit einen Autofahrer an, er soll verdammt noch mal woanders parken.
Dann bemerken die anderen sie.
Sie ist wie ein Güterzug auf offener Strecke, unmöglich aufzuhalten. Irgendjemand unternimmt trotzdem den Versuch, greift aber um einen winzigen Moment daneben. Sie wirft sich durch die offene Haustür und stürzt die Treppe hinauf.
Und dort ist erst mal Schluss.
Mit voller Wucht kracht sie mit dem Körper eines anderen zusammen und stürzt. Versucht, sich wieder aufzurappeln, wird aber niedergedrückt von jemandem, der sich einbildet, stärker zu sein als der Wille einer rasenden Mutter.
»Sie können da jetzt nicht reingehen. Warten Sie …«
Aber sie wartet nicht. Ohne selbst zu begreifen, wie ihr geschieht, hat sie ihn mit einem einzigen Hieb in den Schritt dazu gebracht, sie loszulassen. Sie steht auf, läuft weiter. Hört seine Stimme im Treppenhaus widerhallen: »Ich hab sie nicht gekriegt! Haltet sie auf!«
Endlich hat sie es die Treppe hinaufgeschafft. Und steht vor ihrer Wohnungstür.
Gleich wird sie erfahren, was geschehen ist.
Dass ihr Mann und ihre Kinder tot sind.
Dass keiner mehr übrig ist.
Schweigend wird sie auf der Schwelle zu dem Zimmer stehen, in dem sie alle liegen, wird die fieberhafte Aktivität wahrnehmen, die um sie herum herrscht, in dem Versuch, etwas zu retten, obwohl ohnehin alles zu spät ist. Und so werden sich alle, die dort sind, an diese Szene erinnern.
Dass sie schweigend in der Tür stand, mit Schnee auf dem Mantel und einem Geigenkasten in der Hand.
Vorher
DERERSTETAG
Mittwoch, 25. Januar 2012
EFRAIMKIELWARMITZWEIAufträgen gekommen. Der erste lautete, einen neuen Sicherheitschef für die Salomongemeinde, eine der beiden jüdischen Gemeinden Stockholms, zu finden und einzustellen. Über den zweiten wollte er am liebsten gar nicht nachdenken. Wenn beide ausgeführt wären, würde er nach Israel zurückreisen. Oder woandershin. Er wusste nur selten im Voraus, wie lange er bleiben musste.
Eigentlich hätte es nicht so schwer sein dürfen. Jedenfalls war es das normalerweise nicht. Wie oft war er nicht schon mit vergleichbaren Aufträgen losgeschickt worden? Unzählige Male. Aber wie oft war er schon vergleichbaren Schwierigkeiten begegnet? Nicht ein einziges Mal.
Die Salomongemeinde in Stockholm hatte von sich aus Kontakt zu Jerusalem aufgenommen. Im vergangenen Jahr hatte es eine Reihe besorgniserregender Vorfälle gegeben. Die Gemeinde war wiederholt Ziel von Anschlägen gewesen. In mehreren Fällen hatte es sich regelrecht um Attentate gehandelt, die sogar gegen die Schule der Gemeinde gerichtet gewesen waren. Keiner hatte eine Erklärung dafür, warum sich die Sicherheitslage in Stockholm urplötzlich so verändert hatte, aber das spielte im Grunde auch gar keine Rolle. Entscheidend war lediglich, dafür zu sorgen, dass die Sicherheit verbessert würde.
Ein Teil der Lösung, so hatte der Beschluss zumindest gelautet, sollte darin bestehen, einen besser qualifizierten Sicherheitschef einzustellen. Und nun war es Efraims Aufgabe, einen zu finden.
Efraim wusste genau, wonach er suchte.
Nach einer guten Führungskraft.
Ein Team funktionierte nur, wenn der Teamleiter eine anerkannte, durchsetzungsfähige Person war, jemand mit Integrität und einem Gefühl für Prioritäten und strategische Entscheidungen. Doch vor allem musste die Führungskraft respektiert werden. Keine Belobigungen der Welt konnten es wettmachen, wenn der Teamleiter Eigenschaften hatte, die bei denjenigen Respektlosigkeit erzeugten, die eigentlich angeleitet und zusammengehalten werden sollten.
Bisher war es ihnen schwergefallen, eine Person zu finden, die derartige Qualitäten besaß. Immer hatte irgendwas gefehlt – meist die Integrität oder hinreichende Erfahrung auf operativem Gebiet. Ein Bewerber nach dem anderen war ausgeschieden, und nun lief Efraim Kiel allmählich die Zeit davon.
»Wir haben doch einen Kandidaten, der für den Auftrag der ideale Mann wäre. Warum können wir den nicht nehmen?«, fragte der Generalsekretär der Salomongemeinde, der Efraim gegenübersaß.
»Weil er seinen Dienst nicht vor dem Sommer antreten kann«, antwortete Efraim. »Das ist zu spät. Die Gemeinde kann kein halbes Jahr auf einen Sicherheitschef verzichten, das geht einfach nicht.«
Er wandte den Blick zum Fenster und sah auf den Schnee hinaus, der aus den dunklen Wolken am Himmel fiel und den Boden weiß puderte. Stockholm im Januar war so anders als Tel Aviv. Dort hatte er nur wenige Abende zuvor noch draußen gesessen und Wein getrunken. Natürlich pflegten auch die Schweden ihre Traditionen und Rituale. Efraim hatte gehört, dass sie allen Ernstes ab und zu im Schnee saßen, Würstchen grillten und heiße Schokolade tranken. Selbst wenn man davon absah, dass er kein Fleisch aß und dass er es generell nie fertigbringen würde, Milch und Fleisch zu vermischen, hielt er das doch für eine lächerliche Sitte.
»Wir müssen einen anderen finden«, fuhr er fort und bemühte sich um einen diplomatischen Tonfall. »Jemanden mit breiter Erfahrung, der sofort anfangen kann.«
Der Generalsekretär blätterte in den Bewerbungen, die vor ihm lagen. Es waren nicht unbedingt viele eingegangen, doch rein zahlenmäßig hätte es ausreichen müssen, um jemanden zu finden. Efraim wusste, dass der Generalsekretär in den vergangenen Monaten einiges hatte bewältigen müssen: Sowohl die Gemeinde als auch die Salomonschule hatten neue Räume bezogen, die in zwei unterschiedlichen Gebäuden einander direkt gegenüberlagen. Es war kein weiter Umzug gewesen – schließlich hatten sie auch zuvor schon an der Artillerigatan residiert. Trotzdem hatte das Ganze Zeit und Nerven gekostet. Es wäre für alle Beteiligten am besten, wenn sie endlich zur Ruhe kämen.
Wenn doch nur ihr Lieblingskandidat früher anfangen könnte!
Nicht einmal für die Lösung, den Posten übergangsweise bis zum Sommer zu besetzen, konnte Efraim sich erwärmen. Außerdem würden sie selbst dafür einen soliden Interimskandidaten brauchen. Eine Gemeinde ohne Sicherheitschef war einfach zu verwundbar und nackt.
Ohne es erklären zu können, hatte Efraim das bestimmte Gefühl, dass ausgerechnet diese Gemeinde es allein nicht lange schaffen würde. Ruhelos streckte er die Hand nach den Bewerbungen aus, die er inzwischen beinahe auswendig kannte.
»Heute ist übrigens noch eine weitere Bewerbung eingegangen«, sagte der Generalsekretär zögerlich. »Oder vielmehr mehrere … und zwar von einer Beraterfirma, die sich auf strategische Sicherheitsarbeit spezialisiert hat.«
Efraim zog die Augenbrauen hoch. »Ach ja?«
»Meiner Meinung nach kommt nur einer der Kandidaten infrage. Aber einerseits ist die Bewerbung zu spät eingetroffen. Andererseits weiß ich nicht recht, ob die betreffende Person wirklich so passend wäre.«
Dass die Bewerbung nach dem Bewerbungsschluss gekommen war, fand Efraim unerheblich. Die Frage der Eignung war natürlich etwas ganz anderes.
»Warum sollte er nicht passen? Oder sie?«
»Er. Es ist ein Mann. Und er ist keiner von uns.«
»Sie meinen, er ist ein Goi?«
»Ja.«
Also ein nicht jüdischer Kandidat für den Posten als Sicherheitschef einer jüdischen Gemeinde.
»Warum erwähnen Sie seine Bewerbung, wenn er doch nicht zu uns passt?«
Der Generalsekretär stand wortlos auf und verließ den Raum, um kurz darauf mit einem Pappordner in der Hand wiederzukommen. »Weil er gewisse Qualitäten und Erfahrungen besitzt, die mich neugierig gemacht haben, vor allem im Hinblick auf eine vorübergehende Besetzung der Stelle. Und das ist ja bekanntermaßen unsere derzeitige Situation. Ich habe seinen Hintergrund überprüft und ein paar wichtige Details in Erfahrung gebracht.«
Der steife Pappordner wechselte den Besitzer, und eine neue Idee nahm Gestalt an.
»Ein früherer Polizist, an die vierzig Jahre alt. Frau und zwei kleine Kinder. Wohnt draußen in Spånga. Als er seinen Job verloren hat, sind sie rausgezogen. Wehrpflicht bei der Marine, scheint dann mit dem Gedanken geliebäugelt zu haben, Offizier zu werden, denn er ist beim Militär geblieben. Danach ist er an der Polizeihochschule angenommen worden und innerhalb der Behörde schnell aufgestiegen. Wurde sehr jung zum Kriminalinspektor befördert und musste nur wenige Jahre Streife fahren, bis er für ein besonderes Ermittlerteam der Stockholmer Polizei rekrutiert wurde, das von einem Kriminalkommissar namens Alex Recht geleitet wurde.«
Efraim sah von den Papieren auf. »Alex Recht. Woher kenne ich den Namen?«
»Weil er im Herbst im Zusammenhang mit der Flugzeugentführung in den Zeitungen erwähnt wurde. Sein Sohn war der Kopilot.«
»Ah, richtig.«
Efraim nickte. Die Flugzeugentführung war sogar in der israelischen Presse erwähnt worden.
Er konzentrierte sich wieder auf die Unterlagen. Was der Generalsekretär aufgezählt hatte, stimmte mit dem überein, was der Mann selbst in seiner Bewerbung geschrieben hatte.
Nur eine Information fehlte.
»Sie haben erwähnt, dass er bei der Polizei entlassen wurde.«
»Ja.«
»Und trotzdem könnten Sie sich vorstellen, ihn einzustellen? Ist Ihnen nicht klar, dass man sich in einem Land wie Schweden richtig danebenbenehmen muss, um den Dienst quittieren zu müssen?«
Doch, das war dem Generalsekretär klar.
»Ich würde behaupten, dass in diesem Fall mildernde Umstände vorliegen.«
»Und die wären?«
Der Generalsekretär machte eine Kunstpause. »Er ist aus dem Dienst entlassen worden, weil er während eines Einsatzes den Mörder seines Bruders erschossen hat.«
Efraim sah den Generalsekretär lange an, ehe er den Blick wieder auf die Bewerbung des Mannes richtete.
Peder Rydh.
Könnte er der Mann sein, den die Gemeinde so dringend brauchte?
Im selben Moment wurden sie von der Assistentin des Generalsekretärs unterbrochen, die anklopfte und hereinkam. »Bitte, kommen Sie, etwas Schreckliches ist passiert. Die Schule hat gerade angerufen – eine der Erzieherinnen aus der Tagesstätte ist erschossen worden!«
DERNOTRUFAUSDERSALOMONSCHULEauf Östermalm war erst gar nicht zu verstehen gewesen. Eine Erzieherin war erschossen worden. Vor den Augen einiger Kinder und diverser Eltern. Wahrscheinlich von einem Heckenschützen, der sich gegenüber auf einem Dach befunden haben musste.
Unbegreiflich.
Für Kriminalkommissar Alex Recht war die Salomongemeinde eine fremde Welt. Er wusste nur, dass es eine der jüdischen Gemeinden Stockholms war. Außerdem verstand er nicht, warum der Fall dieser erschossenen Erzieherin auf seinem Schreibtisch gelandet war. Wenn das Verbrechen antisemitischer Natur war, dann musste es eigentlich von der besonderen Abteilung der Kriminalpolizei untersucht werden, die auf sogenannte Hate Crimes spezialisiert war. Womöglich musste sogar die Säpo, die schwedische Sicherheitspolizei, eingeschaltet werden. Warum also ausgerechnet Alex’ Arbeitsgruppe, die gerade erst frisch zusammengestellt wurde und immer noch nicht zur Gänze auf größere Herausforderungen eingestellt war? Und trotzdem – wer hatte einen Grund gehabt, am helllichten Tag vor einer ganzen Ansammlung Erwachsener und Schulkinder eine Erzieherin zu erschießen?
»Ihr neuer Typ«, sagte Alex’ Chef und ließ einen Computerausdruck auf dessen Schreibtisch fallen. »Das ist kein Hate Crime, auch wenn es bereits so in den Abendausgaben der Zeitungen steht. Das hier steht in Verbindung zum organisierten Verbrechen, und ich bin mir ganz sicher. Wenn du da ein paar Steine umdrehst, wirst du herausfinden, dass die Weste dieses armen Fräuleins nicht halb so blütenweiß war wie der Schnee, in dem sie jetzt liegt.«
Alex griff sich den Ausdruck, einen Auszug aus dem Strafregister. »Ist das ihr Lebensgefährte?«
»Yes.«
Allzu bekannte Wörter drängelten sich auf dem Papier: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Nötigung, Bedrohung von Beamten, Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwerer Diebstahl, bewaffneter Raubüberfall, Kuppelei.
»Haben wir denn über die Frau selbst auch etwas gefunden?«
»Nicht das Geringste. Sie kommt nicht mal im Verdachtsregister vor.«
»Dann kann sie trotz allem eine reinweiße Weste und einfach nur einen ausnehmend schlechten Männergeschmack gehabt haben. Und Pech.«
»Das wirst du sicher herausfinden. Ich bin gespannt, ob es um sie oder um ihren Typen gegangen ist. Möglicherweise ja auch um beide. Ach, und beeil dich ein bisschen.«
Alex hob den Blick vom Papier. »Haben wir es eilig?«
»Die Salomongemeinde ist in Sicherheitsfragen ziemlich engagiert. Die werden nicht auf unsere Antwort warten, wenn wir nicht schnell genug sind, sondern eigene Ermittlungen starten. Wie auch immer, werden sie politische Maßnahmen einfordern und das in aller Öffentlichkeit.«
Alex strich sich übers Kinn. »Aber doch nicht, wenn wir publik machen, dass ihr Fräulein mit einem kriminellen Schwergewicht zusammenlebte, oder?«, fragte er. »Das würde doch eher so aussehen, als würden sie potenziell gefährliche Personen einstellen. Das kann ja keine gute Werbung für sie sein.«
Sein Chef war schon wieder auf dem Weg aus dem Zimmer. »Wie recht du hast. Sieh zu, dass du so schnell wie möglich Kontakt zu ihnen aufnimmst. Fahr rüber und quatsch mit ihnen. Und nimm Fredrika mit.«
»Die hat heute Nachmittag frei«, sagte Alex. »Aber ich rufe sie heute Abend an und setze sie ins Bild.«
Der Chef runzelte die Stirn. »Das ist natürlich deine Sache. Aber ist das hier nicht Grund genug, sie anzurufen und zu fragen, ob sie kommen kann? Ich meine, wenn sie denn in der Stadt ist?«
»Natürlich ist sie in der Stadt«, erwiderte Alex. »Und natürlich kann ich sie anrufen. Aber sie wird nicht rangehen.«
»Ist irgendwas passiert?«
»Sie hat Orchesterprobe.«
»Orchester? Was spielt sie denn?«
»Geige. Und ich weiß, dass ihr das guttut. Deshalb werde ich da auch garantiert nicht reinfunken.«
Fredrika Bergman war zwei Jahre lang weg gewesen. Jetzt endlich war sie wieder zurück. Bei der Polizei auf Kungsholmen. Bei Alex. Wo sie seiner Meinung nach die ganze Zeit über hingehört hätte. Da würde er nicht wegen irgendwelcher Probenzeiten einen Streit vom Zaun brechen.
Er musste mit der Sache allein anfangen. Die Erzieherin hatte mit einem Mann zusammengelebt, der in gefährlichen Fahrwassern unterwegs gewesen war – geradezu eine Einladung für jeden Ermittler.
»Erklär mir bitte noch, warum das hier bei mir gelandet ist«, sagte Alex. »Organisiertes Verbrechen gehört nicht zu meinem Aufgabengebiet.«
»Die Polizei Östermalm hat um Verstärkung auf Ermittlerseite gebeten«, erwiderte sein Chef. »Ich habe ihnen zugesichert, dass du ihnen unter die Arme greifst. Wenn sich die Verbindung zum organisierten Verbrechen als belastbar erweist, kannst du die Sache an die Kripo übergeben.«
Wie einfach das klang. Den Fall nur weiterschieben. Aber das würde verdammt noch mal nicht leicht werden. Alex erinnerte sich noch gut an das Ermittlerteam, das er früher geleitet hatte. Es war wie eine Qualle zwischen Reichs- und Landeskripo und der Stockholmer Polizei herumgetrieben. Auf dem Papier hatte es zur Stockholmer Behörde gehört, aber in Wirklichkeit hatten sie gleich mehreren Herren gedient, was Alex insgeheim gefallen hatte, und wenn er hätte entscheiden dürfen, dann hätte die neue Gruppe nicht wesentlich anders ausgesehen.
»Ich schicke eine Streife raus, um ihren Lebensgefährten einzusammeln, sofern er denn zu Hause ist«, kündigte Alex an. »Ich will hören, was er sagt, und ihn als Verdächtigen ausschließen.«
»Ich glaube nicht, dass er es selbst gemacht hat«, gab sein Chef zu bedenken. »Das wäre zu simpel.«
»Denke ich auch. Das stinkt nach Rache oder irgendeinem anderen Scheiß. Trotzdem müssen wir mit dem Kerl reden, verdammt. Wenn einer weiß, wessen Kugel sie da abbekommen hat, dann er.«
NUREINESTUNDEWARESher, seit sie das Polizeigebäude auf Kungsholmen verlassen hatte, um zur Orchesterprobe zu gehen. Nur eine Stunde – und schon gab es keinen Job mehr, keine Familie oder Freunde. Zumindest nicht hier. Nicht in dem leeren Raum, der um sie herum entstand, sobald sie die Geige auf der Schulter zurechtlegte und unters Kinn klemmte.
Die Musik trug sie fort, als würden ihr Flügel wachsen. Sie schwebte über allen anderen und tat so, als wäre sie allein im Universum. Ein gefährlicher Gedanke. Solisten machten sich in größeren Ensembles meist nicht gut. Doch für einen Augenblick – einen verdammten Augenblick – wollte Fredrika Bergman den Geschmack des Lebens verspüren, das sie nie hatte leben dürfen, und einen Schemen jener Frau entdecken, die sie nie geworden war.
Die dritte Woche der neu-alten Ära. Ihr ganzes erwachsenes Leben lang hatte Fredrika um die Laufbahn als Geigerin getrauert, die sie niemals hatte einschlagen können. Und sie hatte nicht nur getrauert, sondern vielmehr regelrecht mit dem Scheinwerfer nach einer Alternative gesucht. War in den Ruinen all dessen, was einmal ihres gewesen war, einer verlorenen Seele gleich herumgewandert und hatte sich gefragt, wohin sie aufbrechen sollte.
Als Kind, als Jugendliche hatte sie einzig und allein für die Musik gelebt. Die Musik war ihre Bestimmung, ohne sie war das Leben nicht viel wert gewesen.
Es kommt immer anders, als man denkt.
Es kann besser werden, doch meist wird es schlechter.
Manchmal wurde sie von Erinnerungen überwältigt, die ebenso unwillkommen waren wie Regen an einem Sommertag. Die Erinnerungen an ein Auto, das ins Schleudern gerät, auf die Gegenfahrbahn rutscht, kollidiert und sich dann überschlägt. Mit Kindern auf dem Rücksitz, Eltern vorn und Skiern auf dem Dach. Sie konnte sich noch gut an die gewalttätigen Sekunden erinnern, als alles auseinandergerissen worden war – und an die Stille, die darauf gefolgt war. Die Narben hatte sie immer noch. Jeden Tag sichtbar auf ihrem Arm. Weiße Linien, die bezeugten, warum sie nicht mehr imstande war, die notwendige Anzahl Stunden pro Tag zu üben. In einem verzweifelten Affekt hatte sie damals die Geige auf den Friedhof der Vergangenheit geworfen und war zu jemand anderem geworden.
Doch mittlerweile spielte sie wieder. Ihre Mutter war es gewesen, die das Streichquartett gefunden hatte. Die gesagt hatte: »Hier, Fredrika, das ist deine Chance.« Als hätte Fredrika, die mit einem fünfundzwanzig Jahre älteren Mann verheiratet war und zwei kleine Kinder hatte, jede Menge Zeit übrig, die genutzt werden wollte.
Doch wer sucht, der findet, und nun gab es seit drei Wochen wieder die Musik in ihrem Leben. Zum ersten Mal seit zwanzig Jahren empfand Fredrika etwas, was an Harmonie erinnerte. Der Mann und die Kinder taten das ihre, damit sich ihr Herz ganz fühlte. Bei der Arbeit lief es gut, und auch das war nicht immer so gewesen. Es war ein stockender Prozess gewesen, bis es endlich so weit gewesen war. Der Fall mit dem entführten Flugzeug vor einigen Monaten war allerdings ein Wendepunkt gewesen. Fredrika war von ihrem damaligen Arbeitgeber, dem Justizministerium, vorübergehend zur Polizei zurückgeschickt worden. Und da erst hatte sie erkannt, dass sie dort hingehörte und dort bleiben wollte.
Bei der Polizei. Seit dem ersten Januar war sie wieder da. Bei Alex Recht in einem neu formierten Ermittlerteam, das in weiten Teilen an dasjenige erinnerte, dem sie vor einigen Jahren angehört hatte.
So viel war gleich und doch so vieles anders.
Harmonie. Ein Wort, das ihr noch vor wenigen Jahren Übelkeit verursacht hätte. Doch jetzt nicht mehr. Nun hatte das Wort eine neue Bedeutung bekommen, legte sich wie Watte um ihre Seele und brachte ihren Blick zum Glühen. Fredrika Bergman hatte ihren Frieden gefunden.
Zumindest fürs Erste.
ESHATTETATSÄCHLICHEINMALEINEjüdische Linie in Alex’ Familie gegeben, doch die war schon vor mehreren Generationen durchbrochen worden. Seither bekannte sich niemand aus seiner Verwandtschaft mehr zum Judentum, und der einzige Hinweis, den es noch gab, war der Nachname. Recht.
Nichtsdestotrotz hatte er jetzt, da er sich zur Salomongemeinde auf Östermalm begab, das Gefühl, der Name würde ihm gewisse Vorteile verschaffen, als würden seine jüdischen Wurzeln ausreichen, um ihn Menschen näherzubringen, denen er sich zuvor nie zugehörig gefühlt hatte.
Die Luft war kalt und feucht, als er an der Nybrogatan aus dem Auto stieg. Verdammtes Scheißwetter. Januar, wie er schlimmer nicht sein konnte.
Die Polizei Östermalm hatte das Areal rund um die erschossene Frau weiträumig abgesperrt. Trauben von Menschen hingen neugierig über dem Plastikband. Dass Blut und Tod jedes Mal so viel Aufmerksamkeit auf sich zogen! Dass es so viele Menschen schamlos zum Elend drängte, nur damit sie ein Gefühl von Sicherheit verspürten, selbst nicht betroffen zu sein.
Schnell begab er sich zu der Absperrung, wo jüngere uniformierte Kollegen standen, die wahrscheinlich zur Polizei Östermalm gehörten. Einst war auch er so gewesen wie sie. Jung und begierig, immer bereit, die Uniform überzustreifen und loszuziehen, um die Straßen sicherer zu machen. Wie sehr war er seit jener Zeit desillusioniert worden.
Sie grüßten einander, und die Kollegen stellten ihn dem Generalsekretär der Gemeinde vor. Der Mann schien unter der Last der kaum eine Stunde alten Tragödie schwer gebeugt zu sein, und seine Stimme trug kaum, als er sprach.
»Keiner der Zeugen darf den Ort verlassen«, sagte Alex und betonte das erste Wort mit aller Kraft, die ihm zur Verfügung stand. »Wie ich gehört habe, haben sowohl Kinder als auch Eltern mit angesehen, was passiert ist. Niemand darf nach Hause gehen, ehe wir ihn befragt oder zumindest seine Kontaktdaten aufgenommen haben.«
»Das ist bereits geregelt«, warf einer der Kollegen aus Östermalm ein. Er klang kurz angebunden, und Alex wusste intuitiv, dass er sich danebenbenommen hatte. Wer war er, dass er hier einfach so hereinstiefelte und Befehle erteilte? Sie hatten um seine Hilfe, nicht um sein Kommando gebeten.
»Um wie viele Zeugen handelt es sich?«, fragte er und hoffte, dass seine Stimme jetzt milder klang.
»Drei Eltern und vier Kinder im Alter zwischen eins und vier. Und dann natürlich eine Reihe von Menschen, die im Moment des Geschehens zufällig auf der Straße vorbeigegangen sind. Ich habe diejenigen, die sich selbst gemeldet haben, gebeten hierzubleiben, kann aber natürlich nicht garantieren, dass das alle waren.«
Das würde leicht zu klären sein. Alex hatte bereits gehört, dass der Eingang zur Salomonschule per Video überwacht wurde. So würden sie sich schnell einen Überblick verschaffen können, wie viele Leute sich zum Zeitpunkt des Verbrechens rund um den Eingang befunden hatten.
»Wer ist Ihr Sicherheitschef?«, wandte Alex sich an den Generalsekretär.
»Im Moment haben wir keinen … Das Sicherheitsteam verwaltet sich im Augenblick selbst, bis wir die Vakanz wieder besetzt haben.«
Alex sah zu der Toten. Der fallende Schnee schien sein Bestes tun zu wollen, um den Tatort zu bedecken – vergeblich. In dem warmen Blut, das aus ihrem Körper gesickert war, schmolzen die Schneeflocken immer noch so schnell, als wären sie auf einem Heizkörper gelandet. Die Frau lag auf dem Bauch, mit dem Gesicht zum Boden. Der Schuss hatte sie in den Rücken getroffen, als sie sich zum geöffneten Schuleingang umgedreht hatte, um eines der Kinder herauszurufen. Alex schickte einen stummen Dank gen Himmel, dass die Kugel keines der Kleinen erwischt hatte.
»Die Eltern haben ausgesagt, dass nur ein einziger Schuss gefallen sei«, sagte der Kollege von der Polizei Östermalm.
Alex sah erneut zur Leiche. Offensichtlich war nicht mehr als ein Schuss nötig gewesen.
»Lassen Sie uns reingehen und im Warmen weitersprechen«, schlug der Generalsekretär vor und schritt von Alex gefolgt durch die Tür zum Gemeindehaus.
Ein weiterer Mann tauchte auf und stellte sich als der Rektor der Salomonschule vor.
»Ich muss wohl kaum betonen, dass wir über diese Tat in höchstem Maße bestürzt sind und dass wir erwarten, dass dem Fall vonseiten der Polizei die allerhöchste Priorität eingeräumt wird«, sagte der Generalsekretär.
»Natürlich«, versicherte Alex, und es war ihm ernst damit.
Ein geplanter Mord am helllichten Tage mitten in der Innenstadt war schließlich nichts Alltägliches.
Im Arbeitszimmer des Generalsekretärs ließen sie sich nieder. Die Wände waren in gleichmäßigen Reihen mit Bildern aus unterschiedlichen israelischen Städten geschmückt – Jerusalem, Tel Aviv, Haifa, Nazareth. Alex war mehrere Male in Israel gewesen und erkannte praktisch jedes Motiv wieder. Im Fenster thronte eine große Menora und breitete ihre sieben Arme aus. Eines der klassischen Symbole des Judentums. Alex fragte sich unwillkürlich, ob er selbst auch eine besaß. Die würde dann wohl in einem der Kartons auf dem Dachboden liegen.
»Was können Sie mir über das Opfer erzählen?«, fragte Alex und versuchte, sich wieder an den Namen der Frau zu erinnern. »Josephine Fridh. Wie lange war sie schon bei Ihnen angestellt?« Er hatte sich an den Rektor gewandt, um eine Antwort zu erhalten.
»Zwei Jahre.«
»Und mit welcher Altersgruppe hat sie gearbeitet?«
Alex wusste so gut wie nichts darüber, wie Tagesstätten organisiert waren, ging aber davon aus, dass die Kinder nach wie vor dem Alter nach in Gruppen eingeteilt waren. Seine eigenen Kinder waren längst erwachsen und selbst Eltern. Manchmal, wenn er sich ihre Gespräche über Kitas und Schulen und das Abholen und Hinbringen anhörte, fragte er sich, wo er selbst gewesen war, als sie klein gewesen waren. Denn er war verdammt noch mal nicht bei ihnen gewesen, so viel war klar.
»Mit der Kleinkindgruppe. Ein bis drei Jahre. Zusammen mit zwei Kolleginnen war sie für zehn Kinder verantwortlich.«
»Ist sie oder die Schule früher schon mal bedroht worden?«
Der Rektor warf dem Generalsekretär einen herausfordernden Blick zu.
»Wie Sie sich wahrscheinlich denken können, besteht für jüdische Einrichtungen, ganz gleich wann oder wo, immer eine gewisse Gefahr. Aber nein, wir haben in der letzten Zeit keine konkreten Drohungen erhalten, sofern man den Vandalismus, den wir hier ständig erleben, nicht als Bedrohung ansehen will, versteht sich. Was wir allerdings tun – auch wenn sich das nicht gegen konkrete Personen richtet.«
»Ich weiß, dass Sie den Bereich vor Ihren Einrichtungen genau überwachen. Haben Sie dort etwas Besonderes beobachtet, was Sie uns gern mitteilen würden?«
Die Antwort lautete wieder Nein. Alles war ruhig gewesen.
»Und Sie?«, fragte der Generalsekretär und beugte sich über den Schreibtisch. »Natürlich befinden sich die Ermittlungen gerade erst am Anfang, aber haben Sie trotzdem vielleicht schon Hinweise erhalten, die interessant sein könnten?«
Irgendetwas im Tonfall des Mannes ließ Alex aufhorchen.
Er beschloss, mit einer Gegenfrage zu kontern, die er sowohl an den Rektor als auch an den Generalsekretär richtete. »Was wissen Sie über Josephines private Situation?«
Ein fahles Lächeln wanderte über die Miene des Rektors.
»Sie war achtundzwanzig Jahre alt. Die Tochter zweier Gemeindemitglieder. Ich bin seit vielen Jahren mit den Eltern befreundet, und ich kenne Josephine, seit sie klein war. Ein prima Mädchen.«
Aber. Es gab immer ein Aber.
»Aber?«
»Sie wirkte ein wenig verloren … Es hat ein bisschen gedauert, bis sie ihren Weg im Leben gefunden hatte. Aber ich habe keine Sekunde gezögert, ihr den Job anzuvertrauen. Sie war fantastisch mit den Kindern.«
Ein wenig verloren? Das konnte alles sein, von »Sie hat eine Bank überfallen, es aber nicht böse gemeint« bis »Sie ist zweimal auf diversen Schiffen um die Erde gereist, ehe ihr klar wurde, was sie mal machen will, wenn sie groß ist«. Alex konnte Worte wie »verloren« nicht recht einordnen. Das war eine neue Idee, erfunden von einer Generation mit zu vielen Wahlmöglichkeiten und verschrobenen Erwartungen an das Leben.
»Das glaube ich gern«, erwiderte Alex. »Da Sie ihre Eltern so gut kennen, nehme ich an, dass Sie auch wissen, dass sie mit einem Mann zusammengelebt hat, der fünfzehn Jahre älter war als sie und wegen einer Reihe schwerer Verbrechen verurteilt wurde?«
Die Reaktion überraschte Alex.
Davon hatten sie keine Ahnung gehabt. Oder doch?
Alex betrachtete denjenigen der beiden, der am wenigsten erstaunt aussah. Den Generalsekretär. Doch er war auch derjenige, der am meisten zu verlieren hatte, sobald er den Eindruck erweckte, nicht zu wissen, was in seiner Gemeinde vor sich ging.
»Das muss ein Missverständnis sein«, sagte der Rektor. »Wir wussten nicht einmal, dass sie mit jemandem zusammenlebte.«
Dem Melderegister zufolge hatten die beiden tatsächlich erst wenige Monate zusammengewohnt.
»Ihre Eltern werden aber doch gewusst haben, mit wem ihre Tochter die Wohnung teilte, oder?«, fragte er den Rektor.
»Davon gehe ich aus. Aber ich weiß nicht recht, wie oft sie einander sahen …«
Alex entschied augenblicklich, dass er auch die Eltern sprechen wollte. »Wo kann ich ihre Eltern erreichen?«
»Sie wohnen in der Sibyllegatan. Aber ich weiß, dass sie zum Krankenhaus fahren wollen, sobald sie dort ist. Sie wollen sie sehen, oder was immer man da macht …«
Man sah. Man fühlte. Man versuchte zu begreifen.
Man ging unter und kaputt.
»Geschwister?«
»Ein Bruder. Er wohnt in New York.«
Dann hatten die Eltern also noch ein Kind, das lebte. So etwas tröstete ihn immer ein wenig. Nicht weil er auf irgendeine Weise glaubte, dass ein Kind durch ein anderes ersetzt werden konnte. Erst wenige Monate zuvor war er selbst nah dran gewesen, seinen Sohn zu verlieren. Nichts hätte einen solchen Verlust wiedergutmachen können.
Nichts.
Alex hasste es, sich an jene Stunden zu erinnern, als alles unsicher gewesen war und niemand gewusst hatte, wie es enden würde. Und fast noch mehr hasste er die Erinnerung an das Nachspiel, das sie alle so viel Kraft gekostet hatte. All die Wochen der Frustration, die Kleinarbeit, die erforderlich gewesen war, um den Sohn wieder nach Hause zu holen. Endlose Konferenzen in der Regierungskanzlei und ermüdende Marathonreisen in die USA, wo man ihn kaum ins Land lassen wollte.
Kaum merklich schüttelte er den Kopf. All das lag endlich hinter ihm.
»Ich erwarte, dass Sie mit allem, was Sie von mir gehört haben, diskret umgehen«, sagte er und erhob sich, um zu zeigen, dass die Besprechung beendet war.
»Selbstverständlich. Geben Sie Bescheid, wenn wir Ihre Arbeit auf irgendeine Weise unterstützen können«, sagte der Generalsekretär und reichte ihm die Hand.
Alex ergriff sie. »Ich melde mich bei Ihnen.«
»Das werden wir ebenfalls tun«, erwiderte der Generalsekretär. »Wie gesagt, sind wir dabei, einen neuen Sicherheitschef einzustellen, und da ist in einer der Bewerbungen Ihr Name als Referenz aufgetaucht.«
»Ach ja?« Alex war erstaunt.
Der Generalsekretär nickte. »Peder Rydh. Aber wie gesagt – wir lassen von uns hören.«
Peder Rydh.
Ein Name, der immer noch schmerzte.
Ein Kollege, den er immer noch vermisste.
Als Alex kurz darauf auf der Nybrogatan stand, fragte er sich, warum er so besorgt war.
Es war, als würden ihm die Schneeflocken zuflüstern: Dies ist erst der Anfang. Du hast ja keine Ahnung, was dir noch bevorsteht.
DERFALLENDESCHNEEERINNERTEANKonfetti aus Glas. Simon unterdrückte den Impuls, die Zunge rauszustrecken, um ein paar Kristalle darauf landen zu lassen. Die Kälte zwang ihn, auf der Stelle zu treten. Dass Abraham aber auch immer zu spät kommen musste! Er glaubte offensichtlich, er könnte sich alles erlauben. Wie oft hatte Simon nicht schon allein dagestanden und auf ihn gewartet: an Bushaltestellen, vor der Schule, vor der Tennishalle und an einer Million anderer Orte. Wenn er das zusammenrechnete – worin er ziemlich gut war –, dann würde sicherlich ein ganzer Tag daraus werden, den er inzwischen schon damit verbracht hatte, auf seinen Freund sauer zu sein, nur weil der niemals pünktlich kommen konnte.
Und der sich nie entschuldigte.
Einfach immer nur lächelte, wenn er dann endlich auftauchte.
»Wie lange stehst du denn schon hier?«, sagte er dann gerne mal, wenn sie sich trafen.
Als hätte er keinen Schimmer, wann sie sich hatten treffen wollen oder dass sie eine bestimmte Uhrzeit ausgemacht hatten.
Dieses Gefühl der Erniedrigung belastete Simon öfter, als er sich eingestehen wollte. Er wusste nicht mal mehr, warum es so selbstverständlich sein sollte, dass Abraham und er Freunde waren. Nicht einmal ihre Eltern hatten mehr so viel miteinander zu tun wie früher. Und in der Schule gehörten sie unterschiedlichen Cliquen an. Wenn er es sich recht überlegte, hatten sie eigentlich nur mehr das Tennisspielen gemeinsam, und auch das hatte sich in letzter Zeit verändert. Zwar gingen sie noch zusammen hin, aber seit der Trainer Simon beiseitegenommen und ihm gesagt hatte, er solle zusätzliche Trainingsstunden bekommen, um sich weiterzuentwickeln, hatte Abraham sich zusehends zurückgezogen. Und so spielten sie nicht mehr miteinander, sondern mit den anderen Jungen.
Simon vermied einen offenen Konflikt mit Abraham, und dies hauptsächlich aus einem Grund: weil der Freund, ganz gleich ob in der Schule oder auf dem Tennisplatz, nicht verlieren konnte. Abraham musste immer recht behalten.
Um jeden Preis.
Und so stand Simon wieder einmal herum und wartete auf ihn. An der Bushaltestelle am Karlavägen, mit dem Tennisschläger auf dem Rücken.
Fünf Minuten, dachte er. Wenn er in fünf Minuten nicht da ist, haue ich ab.
Und zu seinem Erstaunen merkte er, dass er es diesmal wirklich ernst meinte.
Das Maß war voll. Er hatte schon zu oft auf Abraham gewartet. Sogar sein Vater hatte ihm schon gesagt, dass er Abraham Grenzen setzen müsse.
Die Minuten schlichen dahin, und der Schnee fiel immer dichter. Und dann noch der Wind. Es war kalt, richtig kalt.
»Entschuldigung, wie spät ist es?«
Die Stimme war von der Seite gekommen und gehörte einer älteren Frau mit einer großen lilafarbenen Mütze auf dem Kopf. Sie sah freundlich aus.
Simon schob Jackenärmel und Handschuh zur Seite und warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Fünf nach vier.«
»Danke. Dann kommt der Bus sicher jeden Augenblick«, sagte die Frau.
Das würde er ganz sicher tun – und dann würde Simon zusehen, dass er mitfuhr. Er richtete sich gerade auf und versuchte, ruhiger zu atmen. Diesmal würde er es schaffen. Einfach in den Bus steigen und losfahren. Abraham mit der gleichen Lässigkeit in die Augen sehen, mit der er ihm selbst so oft begegnet war, und dann irgendwas sagen in der Art wie: »Ach so, hast du gemeint, wir würden zusammen fahren?«
Ein paar Minuten später sah er den Bus kommen. Die Frau mit der Mütze sah erleichtert aus und machte einen Schritt vor bis zur Bordsteinkante. Doch Simon folgte ihr nicht.
Die Entschlossenheit fiel von ihm ab und landete im Schnee unter seinen Stiefeln.
Ein paar Minuten hin oder her – war es denn wirklich wert, deshalb zu streiten?
Seine Wangen brannten vor Scham und Selbstverachtung, als der Bus hielt und die Türen aufglitten. Er rührte sich nicht vom Fleck, sondern blieb wie festgefroren auf dem Bürgersteig stehen.
Wie schwach er war.
Kein Wunder, dass Abraham ihn verachtete.
Wütend stampfte er mit dem Fuß auf.
Der Bus verschwand in einer Wolke aus Schnee.
Und Simon stand müde immer noch an der Haltestelle.
Im selben Moment sah er das Auto. Es fuhr so langsam, dass es fast heranzuschweben schien. Irgendwer saß auf dem Beifahrersitz und winkte. Zögernd, mit einer vorsichtigen Handbewegung.
Erstaunt sah er sich um, doch außer ihm stand an der Haltestelle niemand mehr. Er war es und niemand anders, dem diese Hand zuwinkte.
Erst als der Wagen vor ihm anhielt, sah er, wer auf dem Beifahrersitz saß.
Abraham.
Die Scheibe glitt herunter.
»Tut mir leid, dass ich zu spät bin«, sagte er. »Wir werden gefahren, spring einfach hinten rein.«
Simon brachte kein Wort heraus. Er konnte nicht sehen, wer am Steuer saß.
»Spring rein!«, sagte Abraham noch einmal.
Oder bat er ihn sogar?
Simon war verunsichert. Die Stimme des Freundes war merkwürdig schrill, sein Gesicht wie erstarrt.
»Jetzt komm schon.«
Die Scheibe glitt wieder hoch. Ein paar Hundert Meter hinter dem Auto zeichnete sich ein weiterer Bus ab.
Simon spürte das Gewicht der Tasche auf der Schulter. Es wäre wirklich angenehm, gefahren zu werden. Aber vor allen Dingen ahnte er intuitiv, dass Abraham ganz offensichtlich nicht allein in diesem Auto sitzen wollte. Also öffnete er die Tür und setzte sich auf den Rücksitz.
Erst als der Wagen losrollte, begriff er, was soeben geschehen war.
Abraham hatte gesagt: »Tut mir leid, dass ich zu spät bin.«
Tut mir leid.
Ein Satz, den Simon noch nie von ihm gehört hatte.
In ihm erwachte ein Gefühl, das so stark war, dass er es fast mit Händen greifen konnte.
Raus aus dem Auto. Sie mussten raus aus dem Auto.
DIENYBROGATAN, KURZNACHSECHSUhr abends. Dunkel und fast menschenleer. Der Anruf war vor weniger als einer Stunde eingegangen. Ein Mann, der Englisch sprach, hatte sich als Verantwortlicher für die Stellenbesetzung in der Salomongemeinde auf Östermalm vorgestellt. Es gehe um die Stelle als Sicherheitschef. Ob Peder womöglich noch am selben Abend zu einem Gespräch kommen könne?
Natürlich konnte er. Peder Rydh war zu einem Mann geworden, der nicht Nein sagte.
Einst hatte er alles besessen, jetzt fast gar nichts mehr.
It was all that I wanted, now I’m living without.
Jedenfalls, wenn man die Jungen und Ylva nicht mit einrechnete. Aber das tat er natürlich. Kein Tag verging, an dem Peder nicht seinem Unglücksstern dankte, dass er zumindest seine Familie hatte behalten dürfen. Obwohl er nahe dran gewesen war, auch sie zu verlieren.
Seit er aus dem Polizeidienst entlassen war, war alles aus dem Ruder gelaufen, und zwar rasend schnell.
Er war in einen Abgrund gestürzt, so tief, dass er nicht einmal geahnt hatte, dass es so etwas gab. Hatte sich im Dreck gewälzt, dem sich nicht einmal ein Schwein genähert hätte. War um vier Uhr morgens besoffen nach Hause gekommen und hatte im Flur die Schuhe der Kinder vollgekotzt. War in Ylvas Schoß zusammengebrochen und hatte geweint, bis nichts mehr übrig war.
Sie hatte sich vorgebeugt und ihm ins Ohr geflüstert: »Du kannst versuchen, was du willst, Peder, aber ich verlasse dich nicht. Nicht noch einmal.«
Die Therapie war gut, aber teuer. Sie war Bestandteil des Abschiedspakets gewesen. Zum Glück. Wenigstens warfen sie ihn nicht ohne Fallschirm aus zehntausend Meter Höhe ab.
Er hatte immer noch Schlafstörungen. Nur manchmal gelang es ihm, eine ganze Nacht durchzuschlafen. Endlos lange Stunden hatte er schon hellwach in seinem Bett gelegen und an die Decke gestarrt.
Hätte er etwas anders machen können?
Hatte er wirklich eine Wahl gehabt?
Stets kam er zu demselben Schluss. Nein, er hätte nichts anders machen können. Nein, er hatte keine Wahl gehabt. Und deshalb gab es auch keinen Raum für Reue und ein schlechtes Gewissen.
»Warum empfinde ich keine Schuld?«, hatte er seinen Therapeuten gefragt. »Ich habe einen Mann vorsätzlich erschossen. Mit drei Schüssen. Zwei davon ins Herz.«
»Natürlich empfinden Sie etwas«, hatte der Therapeut erwidert. »Das unterscheidet Sie von dem Mann, den Sie erschossen haben. Sie empfinden etwas und wissen, dass Sie falsch gehandelt haben.«
Niemand, den Peder kannte, betrachtete ihn als einen Mörder. Er war verwirrt gewesen und hatte nicht für seine Taten verantwortlich gemacht werden können. So hatte es zumindest das Gericht entschieden. Der Mann, der ermordet worden war, hatte selbst einen großen Teil der Schuld daran getragen, wie alles gekommen war. Doch der Staatsanwalt war damit nicht zufrieden gewesen. Er war fest entschlossen gewesen, Peder wegen Totschlags oder vorsätzlichen Mordes verurteilen zu lassen, und hatte das Urteil des Landgerichts angefochten. Doch auch in der nächsten Instanz war Peder freigesprochen worden.
Bei der Polizei war es anders gewesen. Dort hatten sie nicht darüber hinwegsehen können, dass er sich eigenmächtig in die Situation begeben hatte, die letztlich dazu geführt hatte, dass er einen Verdächtigen erschoss. Sein Verhalten hatte von mangelndem Urteilsvermögen gezeugt, das wiederum – zusammen mit einem ganzen Haufen altem Mist – ausreichte, um ihn vorzeitig aus dem aktiven Dienst ausscheiden zu lassen, wie es so schön hieß.
Vielleicht hätte er den Beschluss anfechten können.
Alex hatte es sogar angesprochen, und da hätte Peder besser zugehört. Aber Alex hatte auch noch eine Menge anderer Sachen gesagt. Peder solle sich zusammenreißen und aufhören zu jammern. Doch diese Forderungen waren viel zu schnell nach allem gekommen, was geschehen war, so als hätte Alex erwartet, dass Peder wie eine Maschine reagierte. Doch das konnte er nicht.
Tut mir leid, dich zu enttäuschen, Alex. Ich habe sowohl ein Herz als auch ein Gehirn, und ich kann verdammt noch mal nicht aufhören, so zu fühlen, wie ich es tue.
Zum Teufel mit der Polizei! Für Leute mit Peders Hintergrund gab es auch noch andere Möglichkeiten. Die Sicherheitsbranche boomte, und immer mehr Leute wurden eingestellt. Es war nicht schwer gewesen, dort einen Fuß in die Tür zu bekommen. Derzeit gehörte Peder nicht weniger als zwei Beraterbüros an, die ihn abwechselnd mit verschiedenen Aufträgen versorgten. Eines davon hatte seine Unterlagen an die Salomongemeinde geschickt, wo ein Sicherheitschef gesucht wurde. Und das kam Peder nur gelegen. Zwar wusste er nichts über die Gemeinde, doch das klärte sich meist schnell, wenn man erst mal vor Ort war. Und wenn es einem gut gefiel, dann musste man nur den nächsten Schritt gehen.
Alex hatte Peder geholfen, indem er sich als Referenz für seine Bewerbungen zur Verfügung gestellt hatte. Und nach allem, was geschehen war, bekam Peder fast alle Aufträge, um die er sich bewarb. Das hieß, Alex musste schon etwas Gutes über ihn sagen, wenn sie bei ihm anriefen.
Das würde er hoffentlich auch diesmal wieder tun.
Aus den Nachrichten hatte Peder schon erfahren, dass vor der Salomonschule auf Östermalm eine Erzieherin erschossen worden war. Er hatte versucht, sich auf das Treffen vorzubereiten, indem er alles las, was er über das Attentat in Erfahrung bringen konnte. Doch Informationen schienen immer noch Mangelware zu sein. Die Frau war in den Rücken geschossen worden. Nicht die geringste Spur eines Verdächtigen.
Einen Moment lang hatte er sogar erwogen, einen seiner ehemaligen Kollegen anzurufen, um weitere Fakten zu erfragen, doch dafür war es wahrscheinlich noch zu früh. Außerdem wusste er nicht, wen er hätte anrufen sollen. Es war schon lange her, dass er Bescheid darüber wusste, welcher Kollege mit welchem Fall betraut worden war.
Als er bei der Gemeinde ankam, wurde er bereits erwartet. Ein Wachmann verlangte seinen Ausweis zu sehen, und ehe er weiter ins Haus gehen durfte, musste er einen Metalldetektor passieren. Auf der anderen Seite der Straße standen Absperrungen, und Polizisten marschierten im Schnee herum. Die Tote, von der Peder im Radio gehört hatte, war weggeschafft. Im Weiß des stetig fallenden Schnees war immer noch Blut zu sehen.
Roter Schnee.
Für Stockholm ungewöhnlich. Wahrscheinlich für jeden Ort.
Peder wurde in einen kleineren Raum geführt, in dem zwei Männer auf ihn warteten. Der eine war es, der ihn angerufen hatte.
»Efraim Kiel. Wie gut, dass Sie so kurzfristig kommen konnten.«
»Kein Problem. Ich dachte mir schon, dass es eilig ist.«
Der andere Mann war der Generalsekretär der Gemeinde. Peder war erstaunt über den Titel. Er hatte gedacht, nur große Organisationen wie die Vereinten Nationen hätten Generalsekretäre.
»Sie haben gehört, was geschehen ist?«, fragte Efraim Kiel.
Peder nickte. »Wie weit ist die Polizei mit ihren Ermittlungen?«, fragte er.
In Kiels Augen blitzte Freude auf. »Das fragen wir uns auch«, erwiderte er. »Nein, das war ungerecht formuliert. Wir denken, dass wir einen guten Kontakt zur Polizei haben, und man scheint dort bereits gewisse Gedanken formuliert zu haben, in welcher Richtung sie nach einem Täter suchen werden. Bisher sind wir zufrieden.«
»Wer leitet die Ermittlungen?«
»Kriminalkommissar Alex Recht«, antwortete Efraim Kiel. »Derselbe Polizist, den Sie auch als Referenz in Ihrer Bewerbung genannt haben.«
Peder musste schlucken. Die Situation hier war neu für ihn. Ein paar Jahre zuvor wäre Peder nicht derjenige gewesen, der hier auf einem Stuhl saß und Fragen über eine Ermittlung stellte, die Alex leitete. Da wäre er selbst Teil des Ermittlerteams gewesen.
Er hatte so viel verloren.
»Er ist gut. Alex Recht«, brachte er hervor.
»Das ist auch unser Eindruck.«
Es wurde still, und Efraim Kiel sah Peder lange an.
»Ich möchte Ihnen gegenüber ganz offen sein«, sagte er schließlich. »Wir haben noch einen anderen Kandidaten, der perfekt für die Stelle wäre, aber der kann erst im Sommer anfangen, und so lange kommt die Gemeinde nicht ohne Sicherheitschef aus, vor allem nicht vor dem Hintergrund dessen, was heute passiert ist.«
Peder wartete auf die Fortsetzung.
»Wenn Sie sich vorstellen könnten, eine befristete Anstellung bis zum 15. Juli zu akzeptieren, dann gehört die Stelle Ihnen. Unter zwei Bedingungen.« Efraim Kiel hielt zwei Finger in die Luft.
»Die wären?«
»Zum einen, dass Sie Ihre Arbeit umgehend antreten – am liebsten schon morgen. Zum anderen, dass Sie – ungeachtet Ihres Hintergrundes – imstande sind, gute Beziehungen zur Polizei zu unterhalten.«
»Das dürfte kein Problem sein«, erwiderte Peder mit rauer Stimme. »Momentan bin ich mit den letzten Arbeiten an einem Auftrag für ein größeres Unternehmen beschäftigt, doch das schlägt nur noch mit vereinzelten Stunden zu Buche. Und was die Polizei angeht … Auch das dürfte kein Problem sein.«
Kiels Formulierung »ungeachtet Ihres Hintergrundes« hatte ihn stutzig gemacht. Was wusste er davon? Offensichtlich ziemlich viel. Und trotzdem wollten sie ihn auf einem derart heiklen Posten haben.
Als könnte er seine Gedanken lesen, sagte Kiel: »Wir wissen, dass Sie bei der Polizei entlassen worden sind, und wir wissen auch, warum. Im Hinblick auf die Umstände haben wir keine Probleme damit. Ich hoffe, Sie verstehen mich richtig?«
Ohne dass ihm bewusst gewesen wäre, wie angespannt er dagesessen hatte, war Peder schlagartig erleichtert. »Sicher.«
»Wir werden im Laufe des Abends per Telefon die Referenzen überprüfen, die Sie angegeben haben, und wenn Sie nichts anderes hören, dann rechne ich damit, dass Sie morgen früh um acht Uhr hier erscheinen. Wir haben viel zu tun, und Sie werden sich in viele neue Routinen einfügen müssen.«
Ein altbekanntes Gefühl ergriff Peder. So nah war er der Polizeiarbeit lange nicht mehr gewesen. Das Adrenalin begann zu fließen, und sein Puls beschleunigte sich.
An seinem neuen Arbeitsplatz war ein Mord begangen worden, und sein Arbeitgeber hatte kein Problem damit, dass er den Mörder seines Bruders erschossen hatte.
Das sagte ihm einiges über die Erwartungen, die man an ihn stellte.
Das sagte ihm überhaupt sehr viel.
Möglicherweise hatte Peder einen Ort gefunden, an dem er sich wohlfühlen konnte.
WENNESNICHTSOGLATTgewesen wäre, wäre sie wegen des Schnees und der Kälte am liebsten heimgerannt, nach Hause zu Spencer, nach Hause zu den Kindern. Mit dem Geigenkasten in der Hand. Doch ihr Kopf wusste besser als ihr Herz, was vernünftig war, und mahnte sie, langsam zu gehen.
Hundert Meter von zu Hause entfernt klingelte ihr Handy.
»Fredrika Bergman?«
»Alex hier. Hast du meine Nachrichten abgehört?«
Nein, sie hatte die Mailbox noch nicht abgehört, aber sie hatte gesehen, dass er angerufen hatte. Es war ihr einfach zu eilig gewesen, nach Hause zu kommen, sodass sie sich nicht darum geschert hatte, was Alex an ihrem freien Tag von ihr wollte.
Ich bin mit Spencer verheiratet. Nicht mit meinem Job.
Spencer mit dem hoch aufgeschossenen Körper und dem Blick, der direkt in sie hineinschauen konnte.
»Gibt’s was Besonderes?«, fragte sie, damit Alex zumindest den Eindruck hatte, sie wäre interessiert, auch wenn es sich in Wahrheit anders verhielt.
»Das kann man wohl sagen. Vor der Salomonschule auf Östermalm ist vor ein paar Stunden eine Erzieherin erschossen worden.«
Fredrika hielt inne. »Brauchst du mich?«
»Wenn du Zeit hättest, wäre es mir sehr recht, wenn du mit mir zu ihren Eltern fahren könntest.«
»Ich komme. Ich muss nur eben nach Hause und die Geige abstellen.«
»Dann warte ich auf dich.«
Als sie nach Hause kam, war Spencer mit den Kindern im Badezimmer. Sie konnte sie vom Flur aus durch die geöffnete Badezimmertür sehen. Ihr Sohn saß in der Badewanne, die Tochter voll bekleidet auf der Toilette, als handelte es sich dabei um einen Stuhl. Spencer kniete mit dem Rücken zu ihr vor der Badewanne. Sein Hemd war zerknittert, die Ärmel hochgekrempelt.
Wer hatte ihr nicht alles gesagt, dass es nie funktionieren würde – sie würde alles allein machen müssen, weil Spencer zu alt wäre, um ihr noch eine Hilfe zu sein. Jemand in seinem Alter hätte nicht mehr genügend Energie für kleine Kinder.
Und wer hatte sich nicht alles getäuscht. Fredrika hatte schon Leute in ihrem eigenen Alter kennengelernt, die ihr älter vorgekommen waren als Spencer. Es war nicht die Anzahl Jahre, die zählte, sondern die Lebenseinstellung.
»Hallo«, rief sie, ließ Tasche und Geige auf den Fußboden gleiten, entledigte sich ihrer Schuhe und betrat das Badezimmer, wo sie hinter ihrem Mann in die Hocke ging und die Arme um ihn schlang. Nur einen kurzen Moment der Nähe, dann würde sie sich um den Mord kümmern, von dem Alex berichtet hatte. Eine Frau war erschossen worden. Mitten in der Stadt.
Spencers Körper fühlte sich an wie ein Teil ihres eigenen. Sie brauchte ihn nur wenige Sekunden zu berühren und wusste augenblicklich, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Das Gefühl war so stark, dass sie selbst erstarrte und sich nicht einmal mehr nach den Kindern ausstreckte.
»Hallo«, erwiderte er.
Saga begrüßte sie wie das fröhliche Echo ihres Vaters und winkte energisch mit einem Buch. Isak planschte in der Wanne und schien in seine ganz eigene Welt versunken zu sein.
»Ist irgendwas passiert?« Ohne zu wissen, warum, hatte sie die Stimme gesenkt.
Er antwortete nicht, sondern streckte nur seine Hand in die Badewanne und angelte eine Shampooflasche heraus, die Isak ins Wasser geworfen hatte.
»Warum antwortest du mir nicht?«
»Fredrika, wir müssen reden. Wenn die Kinder schlafen. Es ist nichts Ernstes …«
Ihre Arme rutschten ab. Er hatte sich immer noch nicht zu ihr umgedreht.
Fredrika war niemals empfindsamer für Widerstände, als wenn sie glücklich war.
Das Gefühl herannahender Probleme war so überwältigend wie ein übler Geruch.
»In Ordnung«, sagte sie. »Aber Alex hat gerade angerufen. Ich muss erst noch eine Stunde arbeiten.«
»Arbeiten? Heute Abend?«
»Tödliche Schüsse an der Salomonschule auf Östermalm.«
»Ich weiß. Aber was hast du damit zu tun?«
»Offenbar ermitteln wir in dem Fall.«
»Seit wann arbeitest du mit Hate Crimes?«
Er hob ihren pitschnassen Sohn aus der Wanne und wickelte ihn in ein Handtuch. Er hatte sie immer noch nicht angesehen.
»Ich gehe hier nicht weg«, sagte sie kurz entschlossen, »ehe du mir erzählt hast, was los ist.«
Isak riss sich los und rannte nackt aus dem Badezimmer. Mit einem Quietschen rutschte die Tochter von der Toilette und folgte ihm. Bruder und Schwester. Fredrikas und Spencers Kinder. Noch so eine Sache, die man nicht verstehen konnte. Dass man neue Menschen machen konnte. Biologische Magie.
Er kniete immer noch vor der Wanne, während Fredrika mittlerweile aufgestanden war.
»Jetzt sag schon, was passiert ist!«
Es geschah nur selten, dass sie die Stimme erhob, aber jetzt war sie sauer.
Oder hatte sie Angst?
Er hob den Blick und sah sie an, wie er es schon so oft getan hatte. Doch nur einen Moment lang, dann schlug er wieder den Blick nieder.
»Ich bin heute zu einer Konferenz eingeladen worden«, erklärte er.
»Und?«
Sie hatte nicht mal ihre Jacke ausgezogen. Schweiß rann ihr über den Rücken.
Spencer erhob sich. »Sie haben mir ein Angebot gemacht, und wir müssen uns sofort entscheiden. Ernst hat einen Schlaganfall gehabt.«
Verwirrt trat Fredrika einen Schritt zurück. Ein Angebot? Ernst, Spencers Professorenkollege, hatte einen Schlaganfall gehabt. Und was bedeutete das?
»Und?«, fragte sie wieder.
Spencer streckte sich nach einem Handtuch aus und wischte sich die nassen Hände ab.
»Ernst hätte nach Jerusalem reisen sollen, als einer der Hauptdozenten eines Kurses an der Hebrew University. Jetzt kann er natürlich nicht mehr fahren.«
»Und da bist du an seiner Stelle gefragt worden?«
»Ja. Es geht um einen zweiwöchigen Kurs.«
Zwei Wochen. Das war eine lange Zeit. Trotzdem war Fredrika augenblicklich ruhiger. Sie hatte mit schlimmeren Neuigkeiten gerechnet.
Ich muss aufhören, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen.
»Und wann wäre das?«, fragte sie.
»Wenn, dann reise ich am Sonntag.«
»Am Sonntag? In vier Tagen?«
»Ja.«
»Aber, Spencer, das geht doch nicht.«
»Nein, ich weiß.«
Aber du möchtest gerne, oder?
Natürlich wollte er. Die Frage war nur, ob es gemein wäre, wenn sie Nein sagte.
Sie schüttelte den Kopf. »Lass uns darüber reden, wenn ich zurückkomme.«
Sie ging in den Flur, schlüpfte wieder in die Schuhe und nahm die Handtasche vom Boden. Spencer stand hinter ihr, als sie die Hand auf die Türklinke legte.
»Du weißt, dass ich dich liebe, oder?«, fragte er.
Sie lächelte, zeigte es ihm aber nicht.
So leicht kommen Sie mir nicht davon, Herr Professor.
»Irgendwie hatte ich so ein Gefühl – aber nett, dass du mich noch mal daran erinnert hast.«
Sie drehte sich um, immer noch mit der Hand auf der Klinke.
Er verzog den Mund. Allein seine Erscheinung verursachte ihr weiche Knie. Es gab nicht viele Männer über sechzig, die so aussahen wie Spencer.
Wenn sie und die Kinder ihn nur noch viele Jahre jung halten könnten!
Ihr Handy klingelte, und sie holte es aus der Jackentasche.
Es war Alex. Sie drückte das Gespräch weg.
Ging zu Spencer und küsste ihn.
»Wir sehen uns später«, sagte sie.
»Das hoffe ich wirklich«, sagte er. »Alles andere wäre eine Katastrophe.«
Sie ließ die Familie wieder allein und warf die Wohnungstür hinter sich zu.
Draußen auf dem Bürgersteig rief sie Alex an. »Ich nehme mir ein Taxi und bin in zehn Minuten vorm Präsidium.«
DUNKELHEITUNDKÄLTE.
Und Angst. Weil alles zu spät war. Weil er etwas Dummes getan hatte.
Simon und Abraham hockten hinten in einem Lieferwagen, der mitten in einem Wald stand, und der Mann, der sie eingeschlossen hatte, würde nicht vor dem nächsten Tag wiederkommen. Das bedeutete, dass sie eine ganze Nacht in diesem kalten Wagen allein sein würden.
Beide Jungen weinten. Ein erschöpftes Weinen. Wenn sie sich nur nicht in das Auto gesetzt hätten! Wenn sie nur den Bus genommen hätten!
Wann immer Simon an die Fahrt aus der Stadt zurückdachte, dann sah er aus irgendeinem Grund die Scheibenwischer vor sich. Sie waren hin und her über die Windschutzscheibe gewandert, um für den Fahrer die Sicht frei zu machen, von dem Simon nur den Nacken hatte sehen können.
Dabei hatte er gefühlt, wie die Fessel um seine Handgelenke scheuerte. Als sie noch kleiner gewesen waren, hatten Abraham und er einmal Krieg gespielt. Abraham hatte sich über Simon geworfen und ihm mit einem Springseil die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Es war kein lustiges Spiel gewesen, und sie hatten es auch nie wieder gespielt. Im Auto war es alles andere als ein Spiel gewesen. Da waren seine Hände wirklich gefesselt worden.
Und Simon war zu Tode erschrocken.
Warum nur hatte er nicht den Bus genommen und war weggefahren?