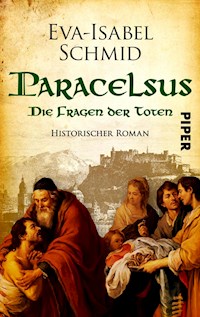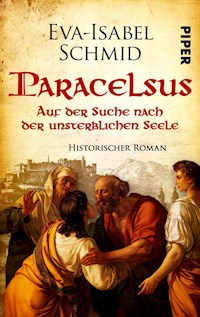
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Paracelsus-Dilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Wer mit dem »Medicus« mitgefiebert und für »Game of Thrones« gebrannt hat, der wird Paracelsus liebenBasel im Spätmittelalter auf dem Sprung zur Renaissance. Der junge Medizinstudent Paracelsus und sein Freund Caspar erhalten von der katholischen Kirche eine Sondergenehmigung zum Sezieren von Leichen. Zu nur einem Zweck: Sie sollen die Existenz der menschlichen Seele beweisen. Als der grausame neue Bischof die Macht erlangt, werden die beiden der Ketzerei beschuldigt. Ihre Forschung wird verboten. Während Caspar sein Leben nun der Medizin widmet, wendet sich der ehrgeizige Paracelsus dem Okkultismus zu. Die zwei Freunde finden sich gefangen in einem Netz aus Inquisition, politischen Intrigen und einem blutigen Bürgerkrieg.»Die Autorin versteht es, die Welt und das Weltbild des Paracelsus uns heutigen Menschen näherzubringen.« ((Leserstimme auf Netgalley))»Insgesamt ein toll erzählter, spannender historischer Roman, den man nicht beiseite legen mag. Großartig! Uneingeschränkte Leseempfehlung!« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Paracelsus – Auf der Suche nach der unsterblichen Seele« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© 2020 Piper Verlag GmbH, München
Redaktion: Ulla Mothes
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Paracelsus
Paracelsus
Caspar
Jacob
Caspar
Margret
Paracelsus
Caspar
Jacob
Paracelsus
Margret
Paracelsus
Caspar
Jacob
Paracelsus
Caspar
Paracelsus
Wilhelm
Laurencz
Jacob
Margret
Laurencz
Jacob
Paracelsus
Jacob
Jacob
Paracelsus
Jacob
Caspar
Laurencz
Paracelsus
Jacob
Caspar
Laurencz
Margret
Laurencz
Caspar
Paracelsus
Caspar
Simon
Caspar
Margret
Paracelsus
Caspar
Paracelsus
Jacob
Paracelsus
Caspar
Paracelsus
Jacob
Paracelsus
Jacob
Laurencz
Paracelsus
Laurencz
Caspar
Laurencz
Caspar
Laurencz
Paracelsus
Dank
Meinem geliebten Florian
Für seine fürsorgliche Unterstützung
Bei diesem Buch
Und an jedem Tag
Paracelsus
»So helft ihm doch! Tut doch endlich etwas!«
Die Bauersfrau rannte unablässig in ihrer kargen Stube hin und her und hörte nur auf, sich zu bekreuzigen, um Paracelsus zu beschimpfen.
Der Junge am Boden röchelte. Und wimmerte. Blau waren seine Lippen. Er war ganz blass. Und schwitzte stark.
Der Bauer stand reglos in einer Ecke und war in sich zusammengesackt. »Er ist mir vom Karren gefallen! Direkt auf die Egge! Tausend Mal habe ich ihm gesagt, er soll die Sachen nicht auf dem Felde liegenlassen, und aufgeräumt hat er trotzdem nie! Und dann ist er einfach draufgefallen!«
Der Bauer schluchzte. Er starrte ungläubig auf den Boden und schüttelte unentwegt den Kopf.
Paracelsus schielte entnervt zu ihm hinüber. Das hatte der Mann ihm auf dem Weg hierher schon ein Dutzend Mal erzählt. Der Bauer war mit seinem Jungen schon beim Morgengrauen auf dem Feld gewesen und hatte Paracelsus direkt aus dem Bette nach außerhalb, ins Basler Umland, gezerrt. Und doch wiederholte er es unablässig. Fast als müsse er sich selbst wieder und wieder erklären, wie es denn zugegangen sei.
»Wir hätten einen richtigen Arzt holen sollen! Und nicht – ihn!« Die Bäuerin warf Paracelsus einen vernichtenden Blick zu.
»Einen richtigen Arzt können wir uns aber nicht leisten, Weib!«, raunzte der Bauer.
Paracelsus ignorierte sie beide. Spätestens seit seiner Zeit in Salzburg brachte ihn nichts mehr so leicht aus der Ruhe. Dennoch – seine Hände wurden feucht, als er sich das Kind, das da am Boden lag, genauer ansah. Sein Puls raste. Verzweifelt japste der Junge nach Luft. Er mochte sieben oder acht Jahre alt sein, jetzt aber hatte er das Gesicht eines Kleinkindes. Paracelsus besah den Hals des Jungen. Die Blutgefäße traten deutlich hervor.
Was war das bloß?
»Bitte, bitte! Rettet mein Kind! Er ist mein Ältester! Mein einziger Sohn! Wie sollen mir denn die Töchter helfen?«
Der Bauer verließ seine Ecke nicht. Zwei der Mädchen harrten verstört bei der Feuerstelle aus und senkten schuldbewusst ihr Haupt, die dritte Tochter war noch ein Säugling und lag auf einem Strohbettchen in einer selbstgezimmerten Wiege.
Paracelsus besah die Einstichstelle der Egge: Ein kleines Loch in dem Brustkorb des Jungen. Es blutete. Aber nicht sehr. Wie konnte diese unscheinbare Wunde solch ein Leiden erklären?
Irgendetwas … Paracelsus hätte schwören können, er hätte es gerade gehört.
»Da lag ein Riesenstein im Weg! Dieses Mistvieh von einem Ochsen hat uns über den einzigen Stein weit und breit gezogen!« Heiße Tränen liefen jetzt über das rote Gesicht des Bauern. »Da hat der Karren geruckelt, und dann ist er einfach runtergefallen! Direkt auf die verfluchte Egge!«
Paracelsus beugte sich über den Jungen. Dessen Augen starrten schon ins Leere. Kaum mehr war er bei Bewusstsein. Er hustete.
»Große Steine sind gefährlich. Für die Achsen der Karren. Deshalb hab ich alle aufgesammelt! Ich halte meine Felder sauber. So etwas gibt es bei mir nicht.«
Da! Paracelsus horchte auf. Da war es wieder! Was war das?
»Aber dann holst du diesen Stümper herbei! Einen Studenten! Nicht mal einen richtigen Arzt!« Die Bauersfrau spuckte aus. »Für dein eigen Fleisch und Blut!«
Eines ihrer Mädchen wollte zu ihr und schrie auf, als sie weggestoßen wurde. Der Bauer rief seiner Frau Rechtfertigungen entgegen. Die Bauersfrau keifte zurück. Das Mädchen war gefallen und bejammerte lautstark sein aufgeschürftes Knie. Der Säugling war aufgewacht und schrie.
»Jetzt reicht es! Verdammt noch eins!« Zornig sah Paracelsus hoch. Seine bräunlich-grünen Augen funkelten. »Ihr haltet jetzt endlich Euer Mundwerk!«, bellte er dem Vater entgegen.
Dann wandte er sich an das Weib: »Und Ihr bringt jetzt sofort Eure Mädchen nach draußen! Sie haben hier nichts zu suchen! Ihr dürft dann wieder herein, wenn Ihr stillschweigen könnt! Ansonsten bleibt an der frischen Luft und betet für Euer Kind! Dann richtet Ihr zumindest keinen Schaden an!«
Der Bauer nickte schuldbewusst und wimmerte nurmehr leise. Die Bäuerin starrte Paracelsus mit offenem Munde an. Dann huschte sie mit dem Säugling hinaus. Die anderen beiden Töchter folgten ihr wie die Küken der Henne.
Paracelsus befühlte den Brustkorb des Jungen. Er war seltsam geschwollen. Die Rippen zeichneten sich nicht mehr ab, obgleich er zaundürr war. Ein Tropfen Schweiß von Paracelsus’ Stirn tropfte auf die Haut des Bauernjungen. Seine Finger waren schon blau. Die Zeit rann ihm davon! Woher nur kam dieses Geräusch? Paracelsus legte sein Ohr auf die Brust des Jungen. Das war es nicht. Im Gegenteil – Paracelsus hörte gar nichts! Dort, wo seine Lunge sein sollte. Keine Atmung. Nichts. Allein sein Röcheln wurde immer lauter und sein Atem immer schneller!
Aber – doch! Paracelsus legte sein Ohr nun direkt über die Einstichstelle. Da hörte er ein Saugen. Ein Pfeifen. Unbestimmt.
Paracelsus runzelte seine Stirn. So etwas hatte er noch nie gesehen. Misstrauisch hielt er seinen Zeigefinger über die Wunde. Ein Luftzug! Ganz leicht. Kaum spürbar. Und doch – bei jedem verzweifelten Atemzug des Kleinen! Allein heraus kam sie nicht mehr …
Paracelsus schluckte. Ob in Tübingen, Leipzig oder München, an keiner Hochschule hatte man ihm von so etwas berichtet. In keinem seiner Bücher hatte er davon gelesen.
»Was meint Ihr, Doktor?« Die Stimme des Bauern war kloßig. Nun störte sie Paracelsus nicht mehr. Die Bäuerin war zurück, blieb aber brav und schweigend im Türrahmen stehen.
»Ich denke, Euer Junge wird sterben.«
Die Bäuerin seufzte auf und blickte zum Himmel.
»Außer ich hole die überschüssige Luft aus ihm heraus.«
»Überschüssig?« Nun war das Weib wieder zum Leben erwacht. »Ja, seht ihn Euch doch an! Sieht er aus, als hätte er zu viel an Luft?« Jetzt stürzte sie zu ihrem Buben und strich ihm über seine nasse Stirn.
Paracelsus hörte sie kaum. Ein Moment des Zögerns. Dann griff er entschlossen zu seinem Skalpell. Gnadenlos funkelte es im düsteren Zimmer auf.
»Nein! Das dürft Ihr nicht!« Die Bäuerin griff nach Paracelsus’ Arm. Ihre Fingernägel rammten sich in seine Haut wie die Krallen eines Raubvogels. Entgeistert sah sie auf die Klinge.
»Sonst wird er sterben, guter Mann.« Flehend blickte Paracelsus über seine Schulter zu dem Bauern. Eine Diskussion mit der Mutter brachte gar nichts.
Der Vater atmete durch. Schluckte.
»Lass ihn, Weib!«
»Er bringt ihn um«, antwortete die Frau.
»Ja, sieh ihn dir doch an! Was sollte es denn schlechter machen? Zum Mittagessen ist er längst gewesen!« Der Bauer verließ nun seinen Zufluchtsort und zerrte die Frau von dem Kinde weg. Sie schrie und fluchte. Der Bauer musste sie nach draußen schleifen.
»Wenn du mein Kind abstichst, töte ich dich!«, kreischte die Bäuerin, sich windend in den Armen ihres Mannes.
»Bleib da draußen, Weib! Oder ich schlag dich heut’ noch tot!« Der Bauer knallte die Türe zu. Und nickte angstvoll zu Paracelsus. »Tut, was Ihr denkt, Doktor. Meinen Segen habt Ihr.«
Paracelsus holte tief Luft. Dann legte er den rechten Arm des Jungen nach oben, um ihn aus dem Weg zu haben.
»Braucht Ihr was?«, fragte der Bauer besorgt.
Paracelsus schüttelte nur seinen Kopf. Er hatte sein Werkzeug bei sich. Extra für ihn angefertigt, von einem dankbaren Schmied aus Kleinbasel, dem er regelmäßig seine Feigwarzen wegschnitt.
Die Klinge in seiner Hand zitterte. Paracelsus konnte sie kaum ruhig halten! Dennoch setzte er beherzt einen tiefen Schnitt unter der Achsel des Jungen. Eine Daumenlänge lang, entlang der Rippen. Ungefähr auf Höhe der Brustwarze. Die Haut klaffte sofort auseinander. Und mit ihr das wenige Fett, das der Junge in seinem mageren Leben angesammelt hatte. Es blutete. Der Junge aber zuckte nicht einmal. Er spürte es nicht mehr. Dann nahm Paracelsus eine große, kupferne Zange. Sie war für das Präparieren seiner Leichen gedacht. Eigentlich. Die Enden waren gebogen und stumpf, um das Gewebe nicht zu beschädigen. Damit spreizte er die Muskelfasern vorsichtig auseinander. Er musste in den Brustkorb gelangen! Ohne den Jungen dafür gänzlich aufzuschneiden.
Immer weiter ließ er die Zange sich vorwühlen. Durch das Fleisch. In den Jungen hinein. Es war Metzgersarbeit! Paracelsus hörte den Bauern würgen. Fast erging es ihm ebenso.
Jetzt höhlte er sich seinen Weg zwischen den Rippen mit dem bloßen Finger. Es reichte nicht! Er kam nicht durch! Der Junge lag im Sterben! Ratlos sah er zu dem Vater auf. Der war kaum noch anwesend inzwischen. Mit verhangenem Blick stand er da und musste sich selbst stützen. Der Versuch eines Gebetes wanderte leise über seine Lippen.
»Gott, vergib mir!«, rief Paracelsus aus. Er bekreuzigte sich. Dann nahm er ein spitzes, schräg angesägtes Kupferröhrchen hervor. Er hatte es sich für den Aderlass anfertigen lassen, als er noch daran geglaubt hatte. Paracelsus atmete durch. Presste es zwischen die Rippen und rammte es in des Kindes Brust. Das Gewebe gab nach.
Der Bauer kam zu sich. Schrie auf. Der Jungenkörper zuckte zusammen. Dann – zischte es! Paracelsus konnte die Luft durch das Röhrchen entweichen spüren.
»Gelobt sei Gott, der Herr!«, flüsterte er zu sich selbst.
Jetzt musste er nur noch das Röhrchen fixieren und die eigentliche Wunde verschließen. Dann wäre das Schlimmste vorüber.
Paracelsus musste sich beeilen. Die Toten erwarteten ihn.
Paracelsus
Paracelsus lehnte sich weit aus dem obersten Fenster im Dachgeschoss der Universität zu Basel und rang nach Luft. Dieser beißende Gestank war nicht zu ertragen! Die Übelkeit trieb ihn, oft unter dem spöttischen Gelächter seines Mitstreiters, immer wieder ans Fenster. Nur um dort seine Nase nicht sehr viel Besserem auszusetzen:
Zu den Füßen des ehrwürdigen Gebäudes bahnte sich Vater Rhein träge und friedlich seinen Weg. Im Hochsommer war die Lebensader der Stadt jedoch mehr eine grünlich-braune Kloake denn ein majestätischer Fluss. Das warme Wasser konnte kaum die Fäkalien von Menschen, Schweinen und Rindern abtransportieren. Zusätzlich dazu Schutt, Tierkadaver und Unrat jeglicher Art. Aus ganzen sechzehn Dohlen nahm der Fluss das Abwasser der Stadt auf, ebenso die Färber- und Gerberabfälle aus den Armenvierteln der Steinenvorstadt und der Flanknerstraße. Die obere School, ein riesiges Schlachthaus, war geschickt über einen Nebenarm gebaut worden, um die Schlachtabfälle einfach nach unten ins Wasser werfen zu können. Am nahen Münsterhügel ergoss sich die stinkende Brühe also in den Rhein. So reichte im Sommer das Wasser kaum, um den ganzen Abfall wegzuschwemmen.
Sicherlich, es gab Gesetze gegen diese Art der Müllentsorgung. Ebenso einige Bauvorhaben zum Schutz des lebenswichtigen Gewässers. Aber Erstere scheiterten am Pragmatismus und Zweitere am Geiz der Basler Bevölkerung. Aufgetrieben von der gnadenlosen Hitze waberte so eine stinkende Dunstwolke über dem Fluss, stieg hinauf am alten Gemäuer der Universität zu ihrem anatomischen Theater und – zu Paracelsus’ Riechorgan.
Die Sonne brannte auf dessen braune Locken. Das Gesicht des angehenden Arztes war markant, die Wangenknochen hoch und die grünlich-braunen Augen leuchteten stets, ganz so, als würden sie fortwährend etwas Wunderbares entdecken. Allein seine Nase war etwas schief, was ihn für immer an eine unschöne Prügelei in einem Wirtshaus in Wien erinnern sollte. Und das sehr schöne Weib, für das er sie angezettelt hatte …
Paracelsus lächelte zufrieden zum weiten Horizont empor. Wahrlich, es war eine Zeit des Aufbruchs! Christoph Kolumbus hatte eine neue Welt entdeckt. Johannes Gutenberg den Buchdruck erfunden. Martin Luther in Wittenberg und Huldrych Zwingli in Zürich predigten eine neue Kirche. Und Paracelsus war mitten im Geschehen! Basel war die größte Stadt der Schweiz und galt spätestens seit der Ankunft des Erasmus von Rotterdam als humanistisches Zentrum und Hauptstadt Europas.
Paracelsus ließ seinen Blick über die mittelalterliche Stadt schweifen: Enge Häuser vor schmalen, grünen Gärten schienen sich umeinander zu winden und um jeden Zentimeter kostbaren Bodens zu ringen. Verschachtelte Gässchen bogen sich schlecht gepflastert, geschunden von Wagen, Kutschen, Tierhufen und aufgeregt umhertrampelnden menschlichen Füßen. Spitz zulaufende Dächer konkurrierten mit einigen kleineren Türmchen und Giebeln, überragt von den imposanten Kirchtürmen der Clara- und Theodorskirche.
An Paracelsus’ Ohren drangen die Rufe der Marktfrauen und das Lachen der Kinder, das Knarren von Rädern und Hufgeklapper. Die Glocken des benachbarten Münsters läuteten unablässig, um freudig die Wahl des neuen Bischofs zu verkünden.
Drinnen ertönte ein dumpfer Schlag. Dann ein lautes Klirren. Paracelsus fuhr herum.
»Caspar! Verdammt! Pass doch auf!«
»Entschuldige vielmals«, antwortete Caspar verlegen und setzte ein gewinnendes Lächeln auf. Er war sein bester Freund und für Paracelsus wie ein kleiner Bruder, der ständig Unsinn anstellte.
Caspar hatte den Meißel noch in der Hand und zuckte schuldbewusst mit den Schultern. Eine noch fast frische Leiche – ein stattlicher Mann von gut zwei Zentnern – war ihm soeben vom Seziertisch gefallen. Gemeinsam mit allerlei Messern, Lanzetten, Spachteln und Pinzetten, die nun verstreut auf dem Boden lagen. Paracelsus verzog angewidert sein Gesicht. Auch eine große Schüssel hatte der Tote mit sich gerissen, das Destillat verteilte sich gerade über die Fliesen. Und mit ihm eine zerstückelte Leber, die Gallenblase und eine der Nieren.
Paracelsus seufzte auf. »Wenigstens nicht sein Gedärm«, murmelte er mürrisch in sich hinein. Den Steinboden von eröffnetem Dickdarm zu säubern, war für ihn die bislang schlimmste Prüfung seines gesamten Medizinstudiums gewesen. Er hatte sich anschließend sechs Stunden lang übergeben.
»Erst kommst du Stunden zu spät. Jetzt genießt du die Aussicht. So werden wir niemals fertig, Paracelsus!«
Wann immer Caspar sich über seinen Freund aufregte, nannte er ihn bei seinem Spitznamen. Das verfehlte seine Wirkung nie: Paracelsus ärgerte sich grün und schwarz.
Getauft war Paracelsus auf den Namen Theophrastus Bombastus von Hohenheim, stellte sich selbst den Menschen als Theo vor und musste sich nun mit einem ihm verhassten Spitznamen arrangieren. Der sich mehr und mehr einbürgerte.
Caspar hatte ihn nach einer durchzechten Nacht erfunden, in der sich Theo stundenlang über die medizinischen Vorlesungen aufgeregt hatte. Im Speziellen über die lateinische Sprache, in der sie gehalten wurden. Lieber hätte er deutsch gesprochen und gehört und wurde nicht müde, dies zu betonen. Paracelsus nun war nichts weiter als eine lateinische Abwandlung seines Familiennamens. Was Theo rasend machte – und Caspar mehr als amüsierte.
»Theo, los! Nun hilf mir doch endlich!« Caspar blies genervt seine Wangen auf und begann, an der Leiche zu zerren. Paracelsus verdrehte die Augen. »Er läuft uns doch nicht davon, Mann.« Widerwillig griff er den Toten bei den Achseln. Der Verwesungsgeruch traf ihn abermals wie ein Schlag.
Vor einem knappen Jahr war es noch erträglicher gewesen. Damals waren sie im Keller des unteren Flügels einquartiert gewesen und hatten die Sektionen bewusst im dunklen Kämmerlein durchgeführt, damit nur keiner Anstoß daran nehme. Eine Entlüftung im engeren oder weiteren Sinne hatte es zwar auch dort nicht gegeben – die Luft war ebenso stickig gewesen – aber der Gestank der Leichen war in den kühleren Kellergemäuern doch um ein Vielfaches weniger beißend gewesen.
Dann aber hatte Bischof von Utenheim aus einer Laune heraus beschlossen, dass seine Schützlinge so nah wie möglich bei Gott arbeiten sollten. Im Dienste des Herrn. Weshalb Paracelsus und Caspar sich nun bei brütender Hitze zehn Stunden am Tag ein kleines Labor unter der Dachschräge mit fünf bis acht verwesenden Körpern teilten. Den Misserfolgen des klösterlichen Spitals entsprechend. Stehende Luft reagierte überhaupt nicht auf geöffnete Fenster, musste Paracelsus feststellen.
»Du sollst ziehen, verdammt!«, rief er und stemmte sich gegen den Toten.
»Das tu ich doch!«, schrie Caspar und stöhnte.
Die Leiche landete wieder auf der Bahre. Zu schmal für diesen Mann.
»Ich mach das, Junge.« Paracelsus griff sich den Meißel und schlug mit aller Kraft zu, um ihn in die Schädelkalotte des Toten zu treiben. Eine bessere Möglichkeit, den massiven menschlichen Schädel zu eröffnen, hatten die Kollegen bislang nicht gefunden. Kreisrund arbeitete er sich vor.
»So!«, rief er schließlich aus. Er lächelte stolz. Endlich hatte er es geschafft, die Kalotte abzunehmen, und das Gehirn von der Schädelbasis gelöst. Nun hielt er es, nassgeschwitzt und außer Atem, aber dennoch triumphierend in die Luft. Caspar wandte sich angewidert ab. Paracelsus lachte und balancierte das Organ ausgelassen unter seiner Nase umher.
»Hör gefälligst auf damit! Das ist widerlich«, mokierte sich Caspar.
»Ach, komm schon.« Paracelsus warf das Gehirn in die Luft und fing es wieder auf. Caspar würgte.
»Dann schlüpf doch unter den Unterrock deiner Mutter und überlass den Männern diese Arbeit.«
Paracelsus selbst schreckte mittlerweile vor gar nichts mehr zurück. Er hatte die letzten zwei Jahre als hochoffizieller Bediensteter des Fürstbischofs viel gesehen. Hunderte von Körpern hatte er gehäutet, aufgeschnitten und zerlegt. Jetzt übergab er sich bloß noch selten und schloss nurmehr vereinzelt die Augen, während er das Skalpell führte. Einzig seine Gebete für die Toten wurden niemals weniger. Wenn Caspar nicht hinsah.
»An das Gehirn werde ich mich niemals gewöhnen«, jammerte der. »Diese Konsistenz! Wie ein hart gekochtes Ei.«
Caspar rümpfte die Nase. Paracelsus aber blickte auf Caspars Leiche. Es war eine ältere Frau, noch verschmutzt von der Arbeit auf dem Felde. Sie sah ängstlich aus. Und irgendwie gelb. Caspar hatte die ersten Schnitte – von den beiden Schlüsselbeinen schräg in Richtung Brustbein und dann hinunter zum Schambein hin – schon gesetzt. Als Nächstes würde er den Bauchraum eröffnen.
»Junge, da ist mir das hier wahrlich lieber«, rief Paracelsus aus und strich sanft über die Hirnwindungen. Sie sahen aus wie die Oberfläche einer Walnuss, weshalb er postulierte, dass der Genuss dieser Frucht unterstützend für die Hirnleistung sei und Kopfschmerzen bekämpfen könne.
»Dann lass uns mal sehen, was wir da drinnen finden.« Paracelsus pfiff gut gelaunt durch seine geschürzten Lippen. Er würde den restlichen Körper noch säuberlich präparieren müssen, aber das Gehirn interessierte ihn am meisten. Er verzog sich mit dem entnommenen Organ, einem langen, scharfen Präpariermesser und einem Apfel in den hinteren Teil des Labors.
Gerade trennte Paracelsus versiert beide Gehirnhälften voneinander ab, als Jacob Göttisheim – der Dekan der medizinischen Fakultät – den Sektionssaal betrat.
»Theophrastus, Caspar! Gott sei gegrüßt.«
Sofort ließ Caspar sein Messer sinken, eilte zum Dekan und begrüßte seinen obersten Lehrmeister mit einem devoten Kopfnicken. Paracelsus blieb sitzen. Misstrauisch beäugte er Göttisheim. Noch nie war er zu ihnen nach oben gekommen.
Der Dekan trat nervös von einem Bein aufs andere.
»Ich habe euch eine Mitteilung zu machen, welche euch wahrlich nicht erfreuen wird.« Er bemühte sich um einen geschäftsmäßigen Tonfall, brach dann aber bekümmert ab.
Caspar trat beunruhigt näher. Theo hielt liebevoll sein Gehirn in der Hand und ließ sich nichts anmerken. Dennoch waren seine Muskeln gespannt.
Göttisheim holte so tief Luft, wie es ihm und seinem Magen möglich war: »Leider sind die Umstände dieses Treffens …«
Der Dekan unterbrach sich erneut. Der Gestank machte dem alten Herrn zu schaffen. Fast hätte Theo schmunzeln müssen und biss sich auf die Lippen. Göttisheim schluckte einige Male hastig und zog ein parfümiertes Seidentaschentuch unter dem weiten Ärmel seines scharlachroten Talars hervor.
Die anderen Professoren und Würdenträger der Universität trugen ihre Amtstracht nur bei feierlichen Anlässen. Dekan Göttisheim aber hatte wohl zu viele Opfer gebracht, um sie nicht jeden Tag zur Schau zu tragen. Er war kein Adliger und auch nicht reich geboren. Ein Jude noch dazu! Er habe sich selbst – aus eigener Kraft – den Weg ins Bildungsbürgertum erkämpft, so hatte er Paracelsus stolz erzählt. Als Sohn eines einfachen Stadtschreibers die Doktorwürde zu erlangen, war gewiss kein Spaziergang gewesen. Nun hatte Göttisheim es bis zum Dekan der ältesten Universität der Schweiz gebracht und wollte, dass man ihm das ansah.
Göttisheim räusperte sich und nahm einige tiefe Atemzüge mit Salbei- und Lavendelduft.
»Meine Herren, wie ihr ja sicher wisst, ist unser gesegneter Bischof von Utenheim letzten Dienstag von seinen heiligen Ämtern zurückgetreten. Das Domkapitel hat sich unlängst, heute in den frühen Morgenstunden, auf einen Nachfolger geeinigt. Diese Woche noch werden sie Philipp von Gundelsheim offiziell wählen.«
Der Dekan atmete nochmals angestrengt in sein Taschentuch. Er sah gehetzt aus. »Ich komme gerade aus einer unschönen Unterredung mit selbigem. Leider …«
Abermals stockte der Akademiker. Traurig sah er von Paracelsus zu Caspar und dann zu Boden. Paracelsus bemühte sich, möglichst gleichgültig auszusehen. Dennoch spitzte er argwöhnisch seine Ohren.
»Leider teilt unser gesegneter neuer Bischof und Reichsfürst die Auffassung seines Vorgängers zu unseren Studien nicht.«
Göttisheim sah sich in dem stickigen Raum um. Die Leber und große Teile des anatomischen Bestecks lagen noch auf dem Boden. Caspar sah peinlich berührt zu Paracelsus. Der setzte einen geraden Schnitt in den Frontallappen des Gehirns vor ihm, um seine Anspannung zu überspielen. Ihm stockte der Atem.
»Er befiehlt euch, ich darf zitieren, eure ketzerische Arbeit sofort einzustellen.« Der Dekan atmete aus.
»Was?« Paracelsus sprang so plötzlich auf, dass sein Stuhl umfiel. Er umklammerte das Gehirn vor ihm wie einen Schatz. »Das kann er nicht machen!«, schrie er entrüstet. »Wir dienen der Wissenschaft! Wir dienen der Forschung! Wir dienen Gott!«
»Theophrastus, beruhigt Euch!« Auch Göttisheim hatte seine Stimme erhoben, obschon das nicht seine Art war. Paracelsus löste das in den Menschen aus. Der Dekan fixierte das Gehirn in dessen Hand.
»Von Gundelsheim sieht das anders. Er sagt, wir vergehen uns hier an Gott und seinen Untertanen. Mir passt das auch nicht, das können meine werten Herren mir glauben, aber wir müssen uns fügen!«
»Bei allem Respekt, Herr!« Caspar sah mit offenem Mund abwechselnd zu Göttisheim, seiner Leiche und zu Paracelsus. Er bemühte sich um einen sanfteren Ton, aber auch seine Stimme überschlug sich: »Wir haben damals den Auftrag vom Bischof persönlich bekommen. Und jetzt soll alles, wofür wir in den letzten zwei Jahren gearbeitet haben, plötzlich falsch sein?«
»Es ist nicht falsch, es ist Blasphemie. Seit heute Morgen. Das Wort des Fürstbischofs ist Gesetz.«
Der Dekan starrte Caspar einen Moment lang direkt in die Augen. Dann wandte er sich ab und murmelte, mehr zu sich selbst, als zu den Studenten: »Es ist ja nicht so, als ob ihr großartig etwas gefunden hättet, in all den Monaten.«
»Wie bitte?« Caspar deutete mit ausgestrecktem Zeigefinger auf das kleine Tischchen in der Ecke, auf dem sich all seine anatomischen Skizzen, Schemata und Zeichnungen stapelten. Während Paracelsus selbst wie besessen die Gehirne studiert hatte, hatte sein Freund in stundenlanger Feinarbeit neue Arterien und Sehnen isoliert und kunstvoll aufgezeichnet. Penibel genau hatte er die Funktionsweise von Muskeln und Gelenken erklärt. Caspars Blick war triumphierend und flehend zugleich.
»Ich höre nicht auf. Keinesfalls!«, rief Paracelsus. »Dann mach ich halt unentgeltlich weiter, ich brauche die Münzen der Kirche nicht. Und die Euren auch nicht!« Trotzig verzog er sein Gesicht und stapfte wie ein Kleinkind mit einem Bein auf, das Organ in seiner Hand fester umklammert denn je.
Jacob Göttisheim hielt, halb geduckt, einige Schritte auf ihn zu. Vor lauter Aufregung vergaß er, durch sein Taschentuch zu atmen. Er versuchte zu flüstern und schrie dennoch: »Ja glaubt Ihr denn, dass es hier um ein paar Gulden geht? Um Eure Anstellung?« Der Dekan starrte seinen besten Studenten an, als wäre dieser dem Wahnsinn verfallen.
»Nein, meine Herren!« Der alte Mann rannte nun kopfschüttelnd und wild gestikulierend in dem beengten Labor auf und ab.
»Theophrastus, seht Ihr denn nichts vor lauter Sturheit? Es geht um Ketzerei! Ja, glaubt Ihr denn, ein zukünftiger Fürstbischof, Domherr und Beschützer der Stadt, gebraucht so ein Wort leichtfertig? Der hat mich noch vor seinem Amtsantritt zu sich zitiert, so sehr echauffiert er sich über eure Studien. Er sagt, ihr vergeht euch am Fleische Jesu höchstpersönlich!« Der Dekan schnaufte durch. Er musste würgen. »Herrgott, der verbrennt uns alle auf dem Scheiterhaufen, wenn wir nicht aufpassen.« Göttisheim sah seine Schützlinge eindringlich an. »Hattet ihr hier schon einmal eine Leiche, die den Feuertod starb? Kein schöner Anblick, das sage ich euch, meine Herren Studenten! Kein schöner Anblick.«
Die Angst war dem Dekan ins Gesicht geschrieben. Paracelsus sah es ganz deutlich in seinen Augen. Er kannte den Ausdruck von den Toten. Der Griff um das Organ in seinen Händen lockerte sich unmerklich. Zum ersten Mal seit langer Zeit war Paracelsus sprachlos.
Göttisheim starrte ihn genau so lange an, bis er sicher sein konnte, dass seine Worte Gehör gefunden hatten. Ein Trick, den er sich im Laufe der Jahre beim Umgang mit den heranwachsenden Burschen angewöhnt hatte. Dann wandte er sich unvermittelt ab. »Ich schicke heute Nachmittag ein paar Kohlenberger vorbei, die das alles hier entsorgen.«
Beim Hinausgehen blickte er nochmals über seine Schulter. »Und das war es dann mit unseren Seelen.«
Paracelsus seufzte lautstark, streckte sich demonstrativ und lächelte: »So, wie geht’s jetzt weiter mit uns beiden Hübschen?«
Liebevoll setzte er das Gehirn wieder zurück auf das kupferne Tablett und trennte sorgsam das Kleinhirn ab. Eine einzelne kleine Träne sammelte sich in einem Augenwinkel. Er versuchte, sie vor Caspar zu verbergen.
»Was machst du?« Caspar baute sich vor dem Tischchen auf und stemmte die Arme in beide Hüften. »Was um alles in der Welt tust du da?«
Paracelsus sah ihn unschuldig an. »Ich arbeite.«
Ein weiterer geübter Schnitt, der den Temporallappen abtrennte, folgte. Seine Hände zitterten. Stumm schluchzte Paracelsus in sich hinein.
»Spinnst du, Mann! Hast du Göttisheim nicht gehört? Wo warst du denn gerade?« Caspar stützte sich mit beiden Armen auf den Tisch und beugte sich vor. »Theo! Hör auf!«
»Nein.« Paracelsus sah nicht hoch. Dann würde Caspar seine Tränen sehen.
»Komm schon, Kamerad!« Caspar klopfte einige Male mit der Faust auf den Tisch. »Heute Abend ist das alles sowieso weg. Lass uns wenigstens die Skizzen und das Besteck in Sicherheit bringen.«
»Deine Skizzen interessieren mich einen Fliegenschiss«, murmelte Paracelsus ganz ruhig, ohne den Blick von seiner Arbeit abzuwenden. Sein Herz schmerzte in seiner Brust.
»Die nehmen dir die Leichen weg! Was willst du denn dagegen machen, hä?«
»Ich lasse sie nicht rein.«
Paracelsus blickte noch immer nicht auf, nahm aber das längste Messer auf dem Tisch und fuchtelte damit in der Luft herum. Er war verzweifelt.
Caspar beäugte ungläubig die scharfe Klinge.
»Du Narr! Bringst dich noch ins Gefängnis! Uns beide!« Caspar sprang mit einem Satz nach vorn und fegte mit einer Hand das Tablett mit chirurgischem Besteck vom Tisch. Der Aufschlag lärmte. Paracelsus sah hoch. Ausdruckslos.
Caspar bemühte sich um einen versöhnlichen Gesichtsausdruck und flüsterte nach einer Weile: »Die zünden uns an, Theo.«
Paracelsus ließ Pinzette und Hirnstamm fallen. Wasser sammelte sich in seinen Augen. Er wusste, dass Caspar recht hatte. Und Göttisheim auch. Gegen das bischöfliche Wort war nicht anzukommen.
»Zum Henker! Verdammt!« Wenn er jetzt sowieso als Ketzer galt, konnte er auch fluchen, so viel er wollte.
Theo fuhr hoch und ging Leiche für Leiche in dem kleinen Zimmer ab, ohne etwas Bestimmtes mit ihnen zu tun. Die Arbeit hier hatte seinem Leben einen Sinn gegeben! Das war seine Chance gewesen! Und jetzt war alles für die Katz!
»Hör mal. Wir können doch weiter gemeinsam forschen, wir beide«, versuchte ihn Caspar aufzumuntern. »Ich wollte schon längstens alle Heilpflanzen katalogisieren. Das wäre sinnvoll.«
»Ich möchte keine Pflanzen malen!« Paracelsus griff sich eine Knochensäge, nur um sie laut krachend auf eine Bahre zu werfen.
Caspar hob einige von Paracelsus äußerst lieblos angefertigte Zeichnungen hoch. »Wir haben doch so viel erreicht«, sprach er mitleidig.
»Nichts! Nichts haben wir erreicht!« Jetzt schrie Paracelsus, so laut er nur konnte. Vor Wut schäumend trat er gegen die Schale am Boden, in der die Leber gelegen hatte. Er ließ seinen Tränen freien Lauf.
»Wir haben sie noch nicht gefunden, Caspar.«
Caspar runzelte die Stirn. »Was?«
Er trat auf Paracelsus zu und ergriff ihn sanft an beiden Schultern.
»Unsere Seelen, Caspar! Wir haben sie nicht gefunden. Und jetzt nehmen sie uns die Körper weg.«
Paracelsus schluchzte laut. Caspar schüttelte ihn sanft, wie man es mit den Verrückten machen sollte.
»Theo, das kann doch nicht … Das ist doch nicht dein Ernst!«
Caspar ließ seinen Kumpan los und suchte Schutz in der Nähe seiner anatomischen Skizzen. »Sich von der Kirche für die Suche nach der menschlichen Seele bezahlen zu lassen, ist das eine. Sie wirklich finden zu wollen, etwas anderes. Paracelsus! Ich dachte, da wären wir uns einig.« Caspar atmete durch. »Es ging doch um die Erlaubnis zu forschen. Um das hier!« Er hielt Theo einige seiner Zeichnungen vor die Nase. »Nicht um Aberglaube und Hokuspokus!«
Fassungslos starrte Caspar seinen Freund an.
»Das ist kein Hokuspokus!« Paracelsus raufte sich verzweifelt sein Haar. Wie konnte er es nur erklären?
»Ich bin … sieh doch!« Er nahm die Schädelkalotte zur Hand und hämmerte mit seinen Knöcheln dagegen. »Ich weiß, dass es sie gibt. Und ich weiß, dass sie da drin ist! Irgendwo! Versteckt!«
Paracelsus nickte eifrig, um sich selbst davon zu überzeugen. Er schlug mehrmals mit dem Knochen auf die Kante einer Bahre.
»Da drin! Meinst du, Gott hätte den Schädelknochen so massiv gemacht, wenn sie nicht da drin wäre? Nicht mehr als das?« Er nahm einen Teil des Frontallappens in die Hand und streckte Caspar die unscheinbare Masse entgegen.
Paracelsus’ Lippen begannen zu zittern. Verzweifelt schüttelte er seinen Kopf.
»Ich kann sie finden, Caspar. Ich weiß, dass ich unsere Seelen finden kann.« Er fühlte sich wie ein kleines Kind, das sehr, sehr einsam war. Caspar seufzte auf.
»Komm, Theo.« Er nahm seinen Freund am Arm und platzierte ihn unter dem offenen Fenster. Paracelsus bemerkte es kaum. Er hatte den Gestank vergessen.
Caspar hob zwei lose Fliesen an und holte einen noch halb vollen Beutel mit Esther Göttisheims selbstgebranntem Zwetschgenschnaps hervor. Margrets und Laurencz’ Mutter. Das Versteck war genial, Margret hatte die Idee gehabt.
Hätte der Dekan gewusst, dass sie hier regelmäßig Schnaps tranken, hätte er sie aus dem anatomischen Theater geworfen. Hätte er gewusst, dass sie hier regelmäßig den Schnaps seiner eigenen Frau tranken, hätte er sie von der Universität geworfen.
Caspar nahm einen großen Schluck, hustete kurz und reichte den Beutel seinem Freund. Paracelsus nahm schweigend davon und sackte in sich zusammen. Er fühlte sich leer. Und hilflos.
»Theo. Das ist nicht das Ende der Welt. Wir haben unschätzbare Erkenntnisse für die Medizin gewonnen! Ich kann nicht begreifen, dass dir das so gleichgültig ist.«
Paracelsus schielte zu Caspar hinüber. Der blickte routiniert auf das Häufchen Elend neben sich. Es war nicht das erste Mal, dass Paracelsus mit viel Schnaps und gutem Zureden von Caspar getröstet werden musste.
Paracelsus trank, schlug gegen die Wand und trank erneut. Unvermittelt sprang er auf.
»Du hast recht, Caspar. Das ist nicht das Ende der Welt. Der Bischof kann mich mal!«
Er schmiss den Beutel gegen die Wand. Der fiel zu Boden. Der Schnaps ergoss sich über die vergessene Gallenblase. »Alles für die Katz hier!«
»Herzlichen Dank auch, Paracelsus! Ich wollte ohnehin nichts mehr trinken«, fauchte Caspar und bückte sich, um den Rest Schnaps zu retten.
Paracelsus strich sich die unzähmbaren Locken aus den grünlich schimmernden Augen. Sie hatten ihr Feuer wiedergefunden.
»Oh, mein Guter, du kriegst noch mehr als genug.« Paracelsus lachte laut auf und reichte Caspar seine Hand, um ihn hochzuziehen. »Wir haben gerade unsere Anstellung verloren. Und ich den Sinn meines Lebens. Komm, lass uns feiern! Geht alles auf mich! Wir stoßen an! Auf den neuen Bischof! Auf die Toten!«
Caspar
Caspar hatte sich nur mit viel Mühe und etwas Gewalt aus den enthusiastischen Armen seines Freundes losreißen können. Den ganzen Nachmittag hatte er damit zugebracht, zwischen anatomischem Theater und der Domuncula posterior, ihrer Studentenunterkunft, hin und her zu laufen. Um seine kostbaren Skizzen und das wertvolle anatomische Besteck in Sicherheit zu bringen vor den achtlosen Händen der Kohlenberger.
Bald hatte er alles säuberlich in einer großen Truhe neben seinem Strohbett verstaut, die sich nun nur noch mit Mühe schließen ließ. Alsdann hatte er sich in einer kleinen Waschschüssel zumindest Gesicht und Hände gewaschen und anschließend ein paar Bissen trockenes Brot mit gewürzten Linsen heruntergewürgt, gemeinsam mit seinen Kommilitonen, auf dass sein späteres Fehlen nicht gleich schon auffiele. Schlimm genug, dass Paracelsus nicht in der kleinen, dunklen Gemeinschaftskammer beim Abendessen zu finden war. Das war nämlich verboten, es gab feste Essenszeiten mit Anwesenheitspflicht. Aber die Kommilitonen hatten sich allesamt daran gewöhnt, dass Paracelsus ihnen nur manchmal beiwohnte, und waren eigentlich recht froh darüber. Ohne ihn gab es weniger Streit.
Die Professoren sahen darüber hinweg, wegen Paracelsus’ guter Noten und der glänzenden Karriere, die sie ihn anstreben sahen. So waren alle Beteiligten mit der Lösung ganz zufrieden, und Paracelsus’ Fehlen wurde schon lange nicht mehr gemeldet.
Allein Caspar war heute Abend etwas nervös, weil Theo schon eine Weile ohne ihn im Wirtshaus saß und er sich allein hinausschleichen musste. Was seinen Nerven nicht gut bekam nach diesem Tag.
Die Domuncula posterior war ein kleines Haus mit Garten, direkt angrenzend an das Hauptgebäude der Universität. Die Studenten durften dort verbilligt schlafen und essen. Um den Preis ihrer Freiheit: Punkt acht wurde das eiserne Gartentor verschlossen und die Herren Studenten hatten zu Hause zu sein und sich ihrer Literatur zu widmen. Kerzen aus Hammeltalg waren hierfür bereitgestellt. Einige Kommilitonen hielten sich daran und benutzten sie.
Das Tor war jedoch lediglich eine mentale Hürde. Mit etwas Geschick konnte ein gesunder Mann darüberklettern und nur beim Rückweg – nach allzu viel süßem Wein oder schalem Bier – kam es hin und wieder zu kleinen Unfällen. Welche die Mediziner dann hilflos zur Kenntnis nahmen. Wunden heilen konnte noch keiner von ihnen. Außer Paracelsus.
Caspar fasste sich schließlich ein Herz und schlich in den kleinen Garten davon. Lautlos und geduckt. Mit zwei Tritten kletterte er rasch über das Tor und schlenderte jetzt unauffällig, aber zügig, in die beginnende Dämmerung.
Abends wurde Basel angenehm ruhig. Fast friedlich. Caspar liebte seine Stadt um diese Zeit! Die Hektik, das Geschrei und das Getrappel des Tages flauten langsam ab. Nur vereinzelt zog nun ein Ochse gemächlich einen letzten Karren oder es tänzelte ein stolzes Pferd mitsamt Reiter über das Kopfsteinpflaster. Ein Mädchen versuchte noch die letzten übriggebliebenen Eier zu verkaufen. Ein paar Hunde bellten unschlüssig. Einem Huhn war die Flucht geglückt, und es gackerte und pickte nun verwirrt in der Gosse nach Futter. Mit sinkender Temperatur klarte die Luft unmerklich auf, und der üble Fäkaliengestank wurde ab und an von den würzigen Aromen schmackhaft zubereiteter Speisen überdeckt. Aus den kleinen Kaminen stieg Rauch auf, genährt von offenen Feuerstellen für die Zubereitung von Eintöpfen, gekochtem Gemüse oder – mit etwas Glück – gebratenem Fleisch mit Zwiebeln.
Caspar passierte das Rheintor mit seinen Gefängniszellen und sinnierte wie immer über deren Insassen nach. Was hatte sie dazu verleitet, gegen Gottes- und Menschengesetz zu verstoßen? Gab es Unschuldige unter ihnen? Wie würde ihre Strafe aussehen? Er passierte die Brücke, vorbei an der kleinen Kapelle, dem Käppelijoch, welches ihm sofort traurige Antwort gab: Das Käppelijoch war Gebetshaus und Hinrichtungsstätte zugleich. Gestern erst war die letzte Kindsmörderin hier ertränkt worden. Das Käppelijoch, so liebreizend es auch aussah, kannte kein Erbarmen.
Begnadigt wurde nur, wer beim Erreichen der Stadtgrenze lebend aus dem Fluss gefischt werden konnte. Dann galt die Gnade als Wille Gottes. Caspar sah den glitzernden Wellen des Rheins nach. Oft hatte er Leichen seziert, die Gott für schuldig befunden hatte. Würde dieses Schicksal auch ihnen blühen? Wenn Paracelsus sich mit dem neuen Bischof anlegte? Der Seelen wegen? Theo war kühn und dumm genug dafür!
Das Wirtshaus Zum Goldenen Ochsen lag auf der anderen Rheinseite in Kleinbasel. Dorthin gingen die Studenten und die Lehrlinge, bevor sie einer Zunft beitreten konnten, weil es an diesem Ufer billiger war und die Essensportionen größer. Golden war im Ochsen aber nichts, außer der Name. Die Wirtsstube und die darüberliegenden Fremdenzimmer lagen in einem schmalen Fachwerkhaus mit hohem Schindeldach. Schlampig verfüllter Lehm wurde von dunklen Holzbalken durchzogen. Der Boden des Goldenen Ochsen bestand lediglich aus gestampfter Erde. Über manche Stellen waren mehr oder weniger sorgsam einige Binsen gestreut worden. Dennoch standen die Gäste bei Regenwetter im Matsch.
Trotz aller Mängel breitete sich in Caspar ein Gefühl des Wohlbefindens aus, als er durch die enge Tür hereintrat. In der Mitte des Gastraumes loderte ein Feuer und verlieh ihm Gemütlichkeit. Beruhigend züngelten die Flammen einen großen, gusseisernen Kochtopf empor, dem Geruch nach gefüllt mit Hühnerbrühe. In der restlichen Stube waren Binsenlichter verteilt, die den Gastraum zwar nicht gerade hell erleuchteten, aber darauf legten die meisten Gäste ohnehin keinen großen Wert.
Der Schein des Feuers glänzte auf Caspars hellbraunen Locken. Das Gesicht des Mediziners war freundlich und fast kindlich geblieben. Und doch zeugten seine filigranen Gesichtszüge von einem messerscharfen Verstand, die blauen Augen strahlten wach und verständig.
Caspar gefiel die beschauliche Stimmung hier. Rauch und verschüttetes Bier zogen ihm sofort in die Nase. Und auch sonst fühlte es sich beruhigend heimisch an, Paracelsus saß nämlich wie üblich an dem Tisch mit dem lautesten Gelächter und dem geringsten Abstand zum Tresen.
Laurencz hatte gerade einen Witz erzählt. Paracelsus trank schon seit dem frühen Nachmittag Bier und Schnaps in sich hinein und schüttelte sich daher geradezu vor Lachen, während seine Hand langsam über Margrets Oberschenkel glitt. Caspar konnte nicht anders, sein Blick verharrte auf dieser Hand. Fast unmerklich runzelte er seine Stirn. Er biss sich auf die Unterlippe.
Margret und Paracelsus hatten nie darüber gesprochen. Es natürlich auch nicht abgestritten. Es kam innerhalb ihrer Vierergruppe ganz einfach niemals zur Sprache. Und doch wusste es Caspar. Er spürte es. Sie scherten sich beide viel zu wenig um Konventionen und Sitten, um es nicht zu tun. Warum Margrets Zwillingsbruder, stark wie ein Stier und völlig vernarrt in seine hübsche Schwester, sich deshalb nicht mit Theo anlegte, war Caspar ein Rätsel. Sicher, man suchte nicht gern Streit mit Paracelsus, obwohl er eigentlich von eher schmächtiger Statur war. Aber es war wie eine brennende Lunte in ein Fass mit Schwarzpulver zu werfen. Die Explosion konnte gewaltig sein. Darüber hinaus hatte Laurencz in ihrer Gruppe vermutlich schlichtweg zu viel Spaß, um sich das zu verderben, und so ließ er die beiden in Ruhe, bei was auch immer.
»He, da ist er ja endlich!« Theo hatte seine Hand von Margrets Rock gelöst und winkte Caspar fröhlich zu.
»Mann, was ist mit dir? Willst du hier nur rumstehen oder auch was mit uns trinken?«
Theo lallte schon ein wenig, lächelte Caspar jedoch herzlich an. Sein Blick strotzte so vor Leben und Energie, dass man nie wusste, ob er sich nun über die Maßen freute, eine brillante Idee hatte oder gerade wahnsinnig wurde. Meistens traf alles zugleich zu, hatte Caspar herausgefunden.
Laurencz stand auf, um ihn zu umarmen. Margret küsste ihn auf die Wange. Caspar wurde rot. Sie war neben der Wirtin die einzige Frau in der Stube, und ihre üppigen Hüften sowie ihr pralles Dekolleté zogen recht viel Aufmerksamkeit auf sich.
»Jetzt setz dich, Kamerad! Wir feiern heut.« Theo zog ihn hinunter auf einen leeren Stuhl und stellte ihm einen randvollen Krug Bier vor die Nase.
»Auf eure Entlassung«, rief Laurencz und prostete Caspar zu.
»Auf die Toten.« Margret lächelte fröhlich und nahm einen großen Schluck. Wenn sie Alkohol trank, röteten sich ihre Wangen, und ihre Lippen erschienen noch voller als gewöhnlich.
Caspar stutzte. Als er vor vier Jahren ihre Bekanntschaft gemacht hatte, war ihm so etwas noch nicht aufgefallen. Damals hatte Margret gerade angefangen, sich in die Medizinvorlesungen zu schleichen. Sicher, sie würde niemals an einer Prüfung teilnehmen oder einen Abschluss erreichen können. Aber wer konnte der Tochter des Dekans der medizinischen Fakultät verbieten, sich in den Hörsaal zu stehlen? Da sich Laurencz vehement weigerte, auch nur eine Sekunde lang seine Nase in ein Buch zu stecken, tolerierte es Göttisheim.
Also war Margret weit und breit die einzige Frau auf dem Campus und ihre Freundschaft zu den beiden Medizinern leicht erklärt: Paracelsus war der einzige Bursche überhaupt gewesen, der es gewagt hatte, mit der schönen Frau zu sprechen. Und nicht peinlich berührt zu Boden gesehen hatte beim Anblick eines Weibes innerhalb der universitären Gemäuer. Schnell waren sie ins Gespräch gekommen, hatten sich angefreundet und – mehr.
Caspar leerte den halben Krug auf einmal. Dabei stand er seinem besten Freund nicht nach.
»Und wisst ihr, wo er die Sau versteckt hat?« Laurencz sah die Gruppe erwartungsvoll mit großen Augen an. Paracelsus grinste. »In seinem Schlafzimmer. Zugedeckt mit dem Bettzeug seiner Frau. Hahaha!« Margret prustete vor Lachen, Laurencz klopfte sich herzhaft auf die Schenkel. »Er dachte, da würd keiner nachsehen! Hahaha! Aber dem Schwein war’s zu heiß, da hat’s zu laut gegrunzt. Hahaha! Der Hauptmann hat solche Augen gemacht!« Paracelsus kippte fast vom Stuhl. »Ich hab die Sau runtertragen müssen. Kein Mensch weiß, wie er sie die Treppe raufbekommen hat. Hahaha!«
Seitdem sich Laurencz der Stadtwache angeschlossen hatte, unterhielt er die Gruppe gern mit mehr oder weniger amüsanten Geschichten von törichten Räubern, geahndeten Affären oder zänkischen Nachbarschaftsquerelen.
Dekan Göttisheim hätte für seinen einzigen Sohn natürlich lieber eine Akademikerlaufbahn auserkoren, dachte sich Caspar. Statt Medizin wohl auch eher die Juristerei. Laurencz aber war ein Raufbold, wie er im Buche stand. Ärger schien bei seinen hormongefluteten Muskeln ohnehin unvermeidbar, und so musste Göttisheim hoffen, dass sein Sohn zumindest auf der richtigen Seite stünde, wenn es einmal darauf ankam.
Caspar schmunzelte leicht und trank seinen Krug aus. Er war noch nicht betrunken genug und dachte an das Käppelijoch. Der arme Tropf. Viehdiebstahl war eine ernste Sache.
Theo hatte rasch sein Gleichgewicht wiedererlangt und schlug mit der Faust laut auf den Tisch. »Wirtin! Wir brauchen Fleisch. Meine Freunde haben Hunger. Und noch mehr Bier. Rasch! Wollt Ihr, dass wir unter Eurem Dach verhungern und verdursten?«
Die rotbackige Wirtin verdrehte ihre Augen, schickte sich aber an, eine neue Runde zu bringen. Sie war Paracelsus’ Ton gewohnt und ignorierte ihn. Er war ein guter Kunde.
Seit geraumer Zeit schon hatte er samstags einen eigenen Stand auf dem Markt und verkaufte dort genügend Tinkturen und Salben, um einer der besten Gäste im Goldenen Ochsen zu sein. Spendabel wie er war, finanzierte er den Rest der Gruppe gleich mit.
Paracelsus’ Heilmittel waren großteils nicht anders als die der Apotheken. Hinter seinem bunten, zerfransten Vorhang aber säuberte Paracelsus sorgfältig faulige Wunden, schiente fachmännisch gebrochene Arme, spaltete eitrige Abszesse und stach routiniert den Star.
Für solche Anliegen war sich die Schweizer Ärzteschaft ansonsten zu schade, fühlte sich nicht zuständig oder schreckte aus Ekel davor zurück. Etliche fürchteten schlicht einen Konflikt mit der Kirche – chirurgische Eingriffe waren den Ärzten verboten. Sie überließen es den Badern, sich die Hände schmutzig zu machen. Oder einfachen Wundärzten, die nie eine Universität von innen gesehen hatten.
Nicht so Paracelsus. Nur deshalb kauften seine Patienten vor lauter Dankbarkeit innerhalb von Stunden den ganzen Stand leer.
Ein großes Stück gebratener Hammel in Dunkelbiersud wurde serviert. Der Geruch ließ Caspar das Wasser im Munde zusammenlaufen. Besser als die Linsen in der Domuncula, fürwahr! Der Tisch mampfte glücklich das zähe, aber gut gewürzte Fleisch. Laurencz war nach einem Tag voll körperlicher Arbeit der dankbarste Esser und bekam ganz rosige Wangen. Paracelsus rülpste zufrieden. Margret berührte seinen Arm.
»Auf eure Seelen«, rief Caspar und leerte den zweiten Krug. Aus den Augenwinkeln sah er Paracelsus unmerklich zusammensacken. Margret ließ seinen Arm los. Sofort tat es Caspar leid, dass er damit angefangen hatte.
Margret sah betreten zu Boden. »Was wollt ihr denn jetzt machen, ohne Bischof von Utenheim?«
Paracelsus raufte sich die Haare und schüttelte traurig seinen Kopf: »Das weiß ich nicht. Alles für die Katz.« Er seufzte auf und starrte ins Leere.
»Ach, komm schon, Theo!« Laurencz nagte hastig seinen letzten Knochen ab und schnipste ihn achtlos auf den Boden. »Wer weiß denn schon, wie’s weitergeht? Am Ende ist von Gundelsheim schon nächstes Jahr die längste Zeit Bischof gewesen.«
Paracelsus sah ihn ungläubig an. Margret drückte ihre Schultern durch und beugte sich ein wenig vor. Mit gedämpfter Stimme flüsterte sie: »Er hat recht! Seitdem Luther seine Thesen an diese Kirchentür genagelt hat, ist alles möglich! Zwingli hat in Zürich immensen Zulauf, und er hat auch Freunde hier in Basel.«
»Das ist so ungewiss, darauf kannst du doch nicht bauen«, mischte sich Caspar ein. »Niemand weiß, wie so was ausgeht.«
»Wieso ungewiss? Die Leute haben die Schnauze voll von eurer Kirche. Und vom Papst«, antwortete Laurencz. Zu laut.
Mit einem Mal wurde der belebte Gastraum still. Alle Köpfe drehten sich in Richtung Laurencz. Der biss sich auf die Lippe. Die Christen waren sehr empfindlich, wenn es um ihren Papst ging.
»Psst!«, zischte Caspar. Zum zweiten Male an einem Tag sah er sich auf dem Scheiterhaufen und verfluchte die Auswahl seiner Freunde.
»Da sieh an! Der große Quacksalber und seine Gefolgschaft.« Ein stattlicher Bursche war aus einer Ecke der Wirtschaft gekommen und baute sich nun vor ihrem Tisch auf. »Könnt eure Fresse wieder nicht halten, oder?«
Es war Martin Clauberg, ein Medizinstudent aus einer der anderen Bursen. Er hatte ein grobes Gesicht mit einer flachen Nase. Caspar hatte ihn noch nie gemocht. Weitere Männer seines Tisches traten heran. Ihre Blicke waren düster. Ihre Fäuste geballt.
»Verzieh dich, Clauberg!«, rief Paracelsus und rutschte mit seinem Stuhl zurück, noch bevor Caspar ihn zu fassen bekam. »Bring lieber ein paar Menschlein ins Grab mit deiner Stümperei.«
»Damit du ihre Körper schänden kannst, du Missgeburt?«, schrie ein anderer Student und baute sich neben Clauberg auf.
»Darf er ja nicht mehr«, antwortete Clauberg lachend. »Jetzt, da Utenheim weg ist, kehrt wieder Recht und Ordnung hier ein. Der neue Bischof wird dir was posaunen, von Hohenheim. Pass nur auf.«
Laurencz stützte sich auf den Tisch und winkelte sprungbereit die Beine ab. Caspar sah ihn ein Messer im noch verbliebenen Hammelfleisch fixieren und wünschte, er könnte Margret von hier wegschaffen. Fünf von Claubergs Anhängern hatten sich nun versammelt. Clauberg selbst war in Fahrt gekommen.
»Wie lange glaubst du denn, dass sich der Jude unter einem richtigen Bischof halten kann? Der wirft diesen stinkenden Dekan raus, bevor er Scheiße schreien kann! Und dann fliegst du von der Universität, Freundchen. Ohne deinen Doktortitel. Und das war’s dann mit dem Wunderheiler.« Clauberg funkelte Paracelsus feindselig an, der Rest der Gruppe lachte schadenfroh auf. Einer johlte.
Paracelsus erwiderte gespielt gelassen: »Das ist wirklich ein Jammer für die Basler. Wenn du erst mal an ihnen rumpfuschen darfst, sterben sie wie die Fliegen.«
Clauberg kniff die Augen zu kleinen Schlitzen zusammen. Die Wirtin eilte davon, um ihren Mann zu holen.
»Bei Gott, ich hoffe wirklich, er hängt dich auf. Dich und deine Judenhure!«
Laurencz sprang so blitzschnell auf, dass Caspar ihn nicht zurückhalten konnte. Er nahm seinen Stuhl und holte Richtung Clauberg aus. Paracelsus machte einen Satz nach vorn, schubste Margret zur Seite und eilte zu Laurencz. Clauberg drehte sich weg. Der Stuhl krachte auf seinen Rücken. Er jaulte auf. Und fiel auf alle viere. Paracelsus drosch mit seiner Linken auf Claubergs Nachbarn ein. Caspar blickte zum steckengebliebenen Messer im Hammel und hechtete um den Tisch herum. Clauberg richtete sich auf und erwischte Laurencz mit seiner rechten Faust am Kinn, sodass der rücklings auf den Tisch fiel. Paracelsus trat jemandem in den Bauch. Caspar teilte ungezielt einen Haken aus und wollte zu Laurencz. Und dem Messer. Wenn er töricht genug wäre, es zu benutzen …
Laurencz kämpfte mit Händen und Füßen gegen zwei Männer, die sich erbittert zu wehren versuchten. Die anderen Gäste jubelten. Einer warf einen Tisch um. Geschirr zersprang. Die Wirtin fluchte. Der Wirt eilte herbei.
Dann – knallte es in Caspars Schädel. Der Schmerz war hell. Und beißend. Sein Jochbein pochte! Blut lief über sein Auge. Caspar konnte es fühlen. Warm. Und schwer. Er taumelte. Zwinkerte. Und fiel.
Er hörte, wie Paracelsus aufschrie. Sah verschwommen, wie er auf sein Gegenüber eindrosch und dann auf ihn zu rannte. Caspar versuchte, sich aufzurichten, aber ihm war schrecklich übel und schwindelig. Er blinzelte nach oben: Einer packte Paracelsus. Clauberg hielt ihn fest. Ein Dritter ergriff einen Zinnkrug. Massiv. Mit spitzem Deckel.
»Nein!«, schrie Caspar am Boden. »Theo!«
Laurencz boxte sein Gegenüber. Aber kam nicht von ihm los. Der Krug krachte auf Theos Schädel hinunter. Mit voller Wucht. Und der Spitze voran. Dumpf war der Aufschlag. Und knatternd. Wie wenn Holz bricht.
»Theo!«, rief Caspar. Der verdrehte die Augen. Blut spritzte aus seinem Schädel. Er wurde ganz bleich. Margret kreischte. Der Wirt holte seine Axt. Sein Weib schrie auf. Theo sackte zusammen und verlor das Bewusstsein. Seine Gegner hielten ihn wie eine kaputte Puppe. Ratlos. Keiner setzte mehr nach. Im Gastraum war es auf einmal totenstill. Niemand jubelte mehr. Caspar spürte den Schmerz, als wäre es der seine.
Der Angreifer starrte fassungslos auf Theo hinab. Er ließ den Krug fallen. Sein Gesicht war voll von Theos Blut. Kurz suchte er Margrets Blick. Öffnete seinen Mund. Und schloss ihn wieder. Dann floh er. Niemand hielt ihn auf.
Clauberg selbst war kreidebleich geworden und schubste den bewusstlosen Paracelsus erstaunlich fürsorglich in Laurencz’ Arme. Dann rannten er und alle seine Kumpane dem Ersten hinterher. Flohen vor Laurencz. Und ihrem Gewissen.
»Raus hier, ihr Störenfriede!« Der Wirt fuchtelte mit der Axt in der Luft herum und wandte sich Caspar und Laurencz zu.
»Wir sind die Störenfriede?«, fragte Caspar und rappelte sich auf. Verzweifelt besah er Paracelsus. »Denen solltet Ihr nacheilen! Mit der Axt! Seht ihn Euch an!«
Der Wirt zuckte mit den Schultern und spuckte aus. Die Gäste murmelten altkluge Kommentare vor sich hin und glotzten dämlich. Keiner half ihnen. Sie wollten hier essen und trinken, der Rest scherte sie nicht. Die Wirtin fing an, die Scherben aufzusammeln. Sie jammerte kaum. Sie war es gewohnt.
Der Wirt stellte die Axt weg und stemmte mitleidslos die dicken Hände in die Hüften. »Ihr schafft den da jetzt nach draußen! Sofort! Und kommt mir nie wieder. Das ist ein anständiges Gasthaus.«
Margret riss die Türe auf, um den nächsten Streit zu vermeiden. »Kommt jetzt! Caspar, du musst ihn verarzten. Zu Hause.«
Laurencz und Caspar schleppten ihren blutüberströmten Freund keuchend durch halb Basel und über die Rheinbrücke. Laurencz schnaufte schwer. Caspar taumelte noch und stolperte ab und an. Er hatte wahrlich Mühe, Theo zu tragen, biss aber die Zähne zusammen.
Es war schon dunkelste Nacht. Der Mond spendete gerade genug silbernes Licht, um dem größten Unrat auf der Straße ausweichen zu können. Margret hielt Ausschau nach dem Nachtwächter. Eile war geboten. Sie hatten keine Zeit, unnötige Fragen zu beantworten.
»Wie heißt dieser Hundsfott, Caspar? Du kennst die doch alle. Wer war das?«, schrie Laurencz, außer sich vor Zorn.
»Psst! Sei leise! Wir brauchen jetzt nicht noch mehr Ärger«, flüsterte Caspar und blickte um sich.
Ein Betrunkener torkelte an ihnen vorbei, lallte Unverständliches, bemerkte sie aber kaum. Eine Hure bot am Flussufer ihre Dienste an und kreischte schrill auf, als sie nahe genug war, um Paracelsus’ Gesicht zu sehen. In der Ferne wieherte ein Pferd. Eine Tür knallte. Margret schluchzte. Ansonsten war das nächtliche Basel totenstill. Woher Laurencz den Atem nahm, weiterhin zu schimpfen, war Caspar ein Rätsel. Ihm war ganz schlecht vor Anstrengung.
»Ich bring sie um. Ich schwör’s. Clauberg heißt der eine, oder? Ich schlag ihm seinen Schädel ein!«
»Hör auf!«, rief Margret halblaut. Sie konnte gut schritthalten. »Du siehst doch, wohin das führt. Ich will dich nicht auch so sehen müssen.«
»Dann zeige ich sie an. Die werden allesamt vom Käppelijoch geworfen. Ich bin Mitglied der Stadtwache, verflucht noch eins!«
»Du hast doch selber angefangen! Glaubst du, die geben dir noch mal eine Waffe in die Hand, wenn du das jetzt an die große Glocke hängst?« Caspar rang nach Luft. Er war noch benommen von dem Schlag und lange nicht so kräftig wie Laurencz. »Und jetzt um Himmels willen sei leise! Der Nachtwächter steckt uns ins Loch, wenn er uns sieht.«
»Dieser vermaledeite Hund hat meine Schwester beleidigt. Und meinen Vater auch«, murrte Laurencz unbeeindruckt in die Nacht hinaus.
Caspar gab schließlich auf und ließ Laurencz die wüstesten Flüche gen Himmel schießen. Die Jungfrau Maria musste sich ihre Ohren heute zuhalten, dachte er. Dennoch kamen sie schneller voran, als man hätte meinen sollen, und schafften es schließlich, den leblosen Körper über das verschlossene Gartentor der Domuncula zu bugsieren. Fast lautlos schlichen sie durch den Garten und in ihre Stube. Nichtstudenten war der Zutritt zur Domuncula strengstens untersagt. Laurencz und erst recht Margret durften überhaupt nicht hier sein, schon gar nicht nachts. Aber keiner der beiden hätte Caspar jetzt mit Paracelsus alleingelassen, und Caspar war dankbar dafür.
Gemeinsam drapierten die Männer den bewusstlosen Körper auf sein Bett. Sofort färbte sich das Laken rot.
Kurz hatte Caspar überlegt, den Freund ins Hospital zu bringen. Dieses aber wurde von Mönchen und Nonnen geführt, und sie übernahmen auch die Patientenversorgung. Der Arzt ließ sich nur per Boten über die Kranken unterrichten und gab seine Therapieempfehlung schriftlich zurück. Niemals war er vor Ort. Paracelsus hatte sich letztes Semester wahnsinnig darüber aufgeregt und war mit Caspar und einigen Schützlingen der jüngeren Jahrgänge aufgebrochen, um sie direkt am Menschen zu unterrichten. Er hatte die Therapieschemata des zuständigen Arztes demonstrativ in der Luft zerrissen und den Schwestern selbst Anweisungen zur Pflege gegeben.
Nur Paracelsus schaffte es, eine Klosterschwester zum Fluchen zu bringen. Binnen kürzester Zeit war dort ein solcher Aufruhr entstanden, dass man sie schließlich hinausgeworfen hatte. Paracelsus hatte Hausverbot bekommen. Das hier war zwar wohl eine andere Situation, meinte Caspar. Aber Theo – sollte er überleben – hätte sich dort bestimmt nicht wohlgefühlt. Und die Meinung eines Mediziners wäre vermutlich erst eingetroffen, wenn sein Freund schon längst verblutet gewesen wäre.
Also lag es an Caspar. Er umrundete das Bett und begutachtete den leblosen Körper. Ratlos. Und ängstlich. Laurencz räusperte sich dezent. Margret keuchte. Caspar wurde an ihre Gegenwart erinnert und versuchte, fachkundig auszusehen. Es misslang. Die beiden starrten ihn an. Nervös wischte er sich den Schweiß von der Stirn.
Was würde Paracelsus jetzt tun? Der hätte sicherlich einen Weg zu seiner Rettung gekannt. Caspar – nicht.
»Was sollen wir tun, Mann! Sag!«, rief Laurencz.
Caspar sah Margrets zweifelnden Blick und riss sich zusammen. »Laurencz, du holst mir eine kleine Schale mit Wasser und die saubersten Tücher, die du finden kannst. Margret, koch Wasser auf!«
Caspar selbst kramte das anatomische Besteck aus seiner Truhe hervor, das er erst heute Nachmittag darin verstaut hatte – nicht ahnend, wie schnell er es wieder gebrauchen würde. Paracelsus rang nach Luft. Er atmete angestrengt.
»Halt durch, Bruder«, sprach ihm Caspar ermutigend zu. »Wir schaffen das. Wie immer.«
Caspar griff nach einem kleinen Skalpell und schnitt des Freundes Haar so nahe wie möglich an der Kopfhaut ab, um sich einen besseren Überblick über die Wunde machen zu können. Halbwegs saubere Tücher wurden rasch gereicht. Caspar versuchte, so viel Blut wie möglich aufzusaugen, aber sofort rann neues nach und verweigerte ihm die Sicht.
»Laurencz, drück so fest wie möglich drauf.« Caspar führte Laurencz’ Hand. Der gehorchte freudig. Das war eine Aufgabe, bei der er so gut wie nichts falsch machen konnte, und daher annähernd perfekt!
Caspar nahm die Wasserschüssel und stellte sie auf Theos Brust. Sie hob und senkte sich schnell, aber regelmäßig. Theo atmete. Noch. Laurencz starrte.
Caspar seufzte auf. Bloß gut, dass Theo sein ratloses Gesicht jetzt nicht sehen konnte. Bis ins Grab hinein hätte er ihn dafür verspottet!
Er löste Laurencz’ Hand und begutachtete die Wunde erneut. Es hatte funktioniert, das Blut floss jetzt nur noch in einem kleinen Rinnsal. Caspar sah, was er befürchtet hatte: Die Spitze des Kruges hatte ein Loch in Theos Schädelkalotte geschlagen! Unwillkürlich musste Caspar an ihre Anstrengungen im anatomischen Theater denken. Leicht war der Knochen nicht zum Bersten zu bekommen.
»Um Himmels willen!«, rief Caspar aus. Was bei allen Heiligen sollte er denn gegen ein Loch im Schädel tun? Caspar musste würgen.
»Was ist denn?«, fragte Laurencz besorgt. Im Grunde wollte er die Antwort aber gar nicht wissen und trat unsicher zwei Schritte zurück.
Der Schwindel setzte wieder ein. Caspar zitterte. Noch niemals hatte er chirurgisches Besteck an einem Lebenden verwendet. Und hier lag sein bester Freund. Mit einem Loch im Kopf. Er rieb sich die Augen und murmelte ein kurzes Gebet. Dann reinigte er die Wunde dürftig mit etwas kaltem Wasser und fing an, mit einer kleinen Pinzette die Knochensplitter zu entfernen. Kaum bekam er sie zu fassen, so unruhig war seine Hand. Caspar schwitzte. Theo röchelte. Wie sehr wünschte sich Caspar, es wäre andersherum. Paracelsus würde ihn irgendwie retten, und alles wäre wieder gut.
Caspar hatte gerade den letzten sichtbaren Splitter entfernt und zu einer Lanzette gegriffen, um damit die ausgefransten Wundränder entfernen zu können, als er aufschreckte.
Draußen im Gemeinschaftsraum erklangen aufgeregte Rufe und unsicher tapsende Schritte. Dazwischen Margrets Stimme: »Nein, ich gehe ganz bestimmt nicht! Wenn ihr den Pedell holen wollt, bitte. Der kann mich gern an meinen Haaren hinausschleifen.«
»Um Himmels willen. Nicht auch noch das.« Caspar stöhnte.
Hitziges Getuschel folgte.
»Ihr könnt da nicht rein, wir haben hier einen Notfall!«, rief Margret.
Jemand polterte gegen die Tür.
»Lasst Caspar in Ruhe arbeiten. Paracelsus liegt im Sterben.«
Das war das falsche Stichwort. Denn einen Augenblick später standen alle Bewohner der Domuncula in ihrem kleinen Zimmer. Und glotzten. Fragend, teils mitleidig, teils neugierig. Unschlüssig. Und hilflos.
»Helft ihm oder geht«, sagte Laurencz und baute sich vor den Studenten auf, während sich Margret mit einem dampfenden Topf Wasser an ihm vorbeidrängte.
Das waren die magischen Worte gewesen. Jeder wollte helfen. Ein knappes Dutzend engagierter Medizinstudenten, die sich alle nützlich machen wollten, verwandelten das Krankenzimmer in ein Wespennest. Jeder wollte schnellstmöglich etwas ganz Wichtiges holen oder suchen. Die Akademiker rannten kopflos umher und schubsten sich gegenseitig zur Seite. Jeder versperrte dem anderen den Weg. Einer rammte versehentlich das Krankenbett, und die Wasserschale auf Theos Brust fiel zu Boden.
Caspar, die Lanzette noch in der zitternden Hand, musste sich abenteuerliche Ratschläge anhören, wie der Kranke zu behandeln war. Herrman meinte, man müsse ihm Brechmittel einflößen, um schnellstmöglich die Schadstoffe aus seinem Körper zu befördern. Thomas glaubte gelesen zu haben, Paracelsus müsse jetzt Eselsmilch direkt aus dem Euter trinken, und starrte den Bewusstlosen erwartungsvoll an. Der junge Simon wollte ihm einen Einlauf mit Salz und Seife verpassen und eilte los, um eine Schweineblase dafür zu suchen. Wilhelm nahm die Anzahl der Buchstaben seines vollen Namens und berechnete mit einer komplizierten Formel, dass Paracelsus ohnehin sterben würde.
»Es reicht jetzt!«, schrie Margret endlich.
Die Prophezeiung von Paracelsus’ nahem Tode war zu viel für sie gewesen. Margret übertönte die Männer mühelos. »Caspar ist sein bester Freund. Er entscheidet, was getan werden soll.«
Die Burschen starrten das junge Weib mit offenen Mündern an. Laurencz stellte sich demonstrativ an ihre Seite, um seiner Schwester Autorität zu verleihen. Es gelang. Artig standen die Mitbewohner nun in Reih und Glied. Und warteten. Aller Augen waren auf Caspar gerichtet. Dieser starrte ausdruckslos zurück. Ihm war nicht wohl. Er war nicht Paracelsus. Und hatte keine Ahnung.
»Nehmt eure Astrologiebücher und berechnet mir die genaue Position von Merkur und Jupiter zur Sonne. Bitte.«
So. Das war schwer! Damit sollten sie nun eine gute Weile beschäftigt sein. Hatten die Studenten erst einmal angefangen, die Planeten zu befragen, hörten sie so schnell nicht wieder auf damit. Die Berechnungen waren so kompliziert, dass sie sich ständig in Widersprüche verstrickten und jeder auf ein anderes Ergebnis kam. So endete es immer. Und sie mussten von vorn beginnen. Gut so, dachte sich Caspar. Jupiter und Merkur waren ihm gerade herzlich egal. Er blickte auf Paracelsus’ Schädel. Er musste dieses Loch stopfen. Wie auch immer.
Dankbar für ihre Aufgabe liefen die Studenten hinaus. Medizin war viel aufregender, wenn es um einen echten Patienten ging, den es zu retten galt!
Caspar blickte mit leeren Augen zu Margret und Laurencz.
»Ich habe keine Ahnung, wie ich ihm helfen soll«, gestand er und ließ die Schultern hängen.
Margret fing an zu weinen.
Laurencz trat auf Caspar zu: »Dann denk nach, Mann! Du bist Arzt.«
»Nein.« Caspar schüttelte seinen Kopf. »Ich bin Medizinstudent. Ich habe meine Zeit mit Leichen und Bücherlesen verbracht. Nicht mit Löchern in Köpfen.«
Laurencz verdrehte ungeduldig die Augen. Margret besah ihn mit strengem Gesicht.