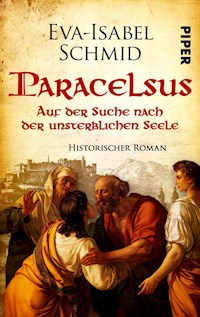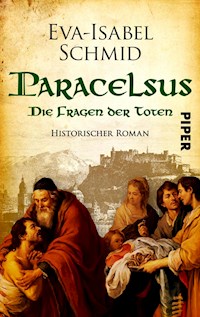
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper Schicksalsvoll
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Paracelsus' Suche nach der menschlichen Seele fordert ihren Tribut – der große Roman um den berühmten Arzt für alle Leser von Noah Gordon und Ken Follett Der junge Paracelsus ist endlich Arzt beider Arzneien. Eines aber lässt ihm keine Ruhe: Er will die menschliche Seele finden. Verfolgt vom uralten Zauberorden des roten Gürtels begibt er sich auf Wanderschaft – quer durch Europa. Immer mit dem Ziel, das Geheimnis doch noch zu lüften. Währenddessen wütet in Basel die Pest. Paracelsus' Freund Caspar muss als Stadtarzt hilflos mitansehen, wie die Seuche Hunderte seiner Patienten dahinrafft. Als sich der nunmehr berühmte Paracelsus zurück in seine Heimat wagt, kommt es im allgemeinen Chaos plötzlich zu einer Reihe von mysteriösen Todesfällen. Verzweifelt sucht Caspar nach dem Mörder. Die ungleiche Freundschaft wird auf ihre größte Zerreißprobe gestellt. Dies ist Teil 2 der Paracelsus-Reihe »Die Autorin lässt den Leser ganz tief in das Mittelalter eintauchen.. Und wieder erzählt sie eine überaus spannende Geschichte um den Renaissance Arzt Paracelsus.« ((Leserstimme auf Netgalley)) »Mit Paracelsus begleitet man einen sehr interessanten Charakter und man kann den Pesthauch in Basel beinahe riechen. Eine tolle Geschichte, die ich gern uneingeschränkt weiterempfehle.« ((Leserstimme auf Netgalley))
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Paracelsus – Die Fragen der Toten« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Redaktion: Ulla Mothes
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Covermotiv: Bilder unter Lizenzierung von Shutterstock.com genutzt
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Paracelsus
Paracelsus
Mira
Paracelsus
Mira
Caspar
Simon
Caspar
Paracelsus
Margret
Caspar
Simon
Caspar
Paracelsus
Caspar
Paracelsus
Jacob
Paracelsus
Jacob
Mira
Paracelsus
Caspar
Margret
Paracelsus
Jacob
Caspar
Simon
Jacob
Magnus
Paracelsus
Margret
Paracelsus
Caspar
Paracelsus
Paracelsus
Caspar
Paracelsus
Caspar
Jacob
Caspar
Jacob
Caspar
Paracelsus
Caspar
Simon
Caspar
Margret
Jacob
Paracelsus
Caspar
Esther
Caspar
Heinz
Paracelsus
Caspar
Dank an:
Meinem geliebten Florian
Für seine fürsorgliche Unterstützung
Bei diesem Buch
Und an jedem Tag
Paracelsus
»Dottore! Avanti!«
Das junge Weib hatte mit ihren Fäusten so lange gegen die Tür des Gasthauses gehämmert, bis alle Bewohner hellwach gewesen waren. Sie hatte Paracelsus bei der Hand gepackt und ihn noch im Nachtgewand mit sich gezerrt. Jetzt zog sie ihn in eine schäbige Trattoria in einem der ärmeren Viertel Ferraras, direkt am Wasserlauf des Pos.
»No! Non lo fare! No!«
Paracelsus’ Augen weiteten sich, als er den Gastraum betrat. Ein junger Bursche lag da, rücklings auf einem breiten Tisch, und zappelte um sein Leben. Fünf Männer hielten ihn. Er wehrte sich erbittert. »Per favore! No!«
Der Bursche war ganz blass. Schweiß rann über seine Stirn. Eindrücklicher als die Panik in seinen Augen war nur die Blutlache unter ihm. Das Bein war schon mit einem breiten Ledergürtel abgebunden, dennoch tropfte unablässig frisches Blut zu Boden. Der Stadtarzt stand vor dem Burschen und hatte die Knochensäge schon gezückt. Gnadenlos funkelte sie im Kerzenschein.
»No! Per favore! No«, wimmerte der Bursche wieder, bevor man ihm den Beißkeil zwischen die Zähne zwang. Dann waren es nur noch verzweifelte Laute.
»Dottore, helft meinem Liebsten! Wir wollen heiraten. Und der will ihm sein Bein wegschneiden!« Das Weib ließ Paracelsus’ Hand noch immer nicht los. Ihre Lippen zitterten.
»Und damit hat er recht, Teuerste«, antwortete ein schwer schnaufender Simon und drängte sich mit Paracelsus’ Arzttasche in den Gastraum. Erschrocken starrte er auf das verwundete Bein.
»Nein, bitte.« Die Fingernägel der Frau bohrten sich jetzt in Paracelsus’ Arm. »Dann ist er ein Krüppel. Wird nie unsere Familie ernähren.« Sie schluchzte. Paracelsus schluckte.
Betreten sah er an der Frau vorbei, hinüber zu dem ernst dreinblickenden Stadtarzt mit der Knochensäge in der Hand. Und dann zu dem Glüheisen, mit dem er den Stumpf danach ausbrennen wollte. Schon knarzte es in der Feuerstelle.
»Wartet! Lasst ihn mich erst besehen.«
Paracelsus eilte zu dem sich windenden Patienten und versuchte, alle Autorität aufzubringen, die ein Mann ohne Hosen nur haben konnte. Er drängte den Stadtarzt unwirsch zur Seite und betrachtete die blutende Wunde. Die weiße Haut klaffte weit auseinander. Die dicken Muskelbäuche waren zerfetzt. Darunter – sickerte das Blut hellrot. Paracelsus wurde heiß.
»Wie ist das denn zugegangen?«, murmelte er in sich hinein.
»Er hat sich gestritten! Mit einem Fremden, einem Wanderarbeiter aus dem Süden, glaube ich«, antwortete das Weib aufgeregt. »Über irgendetwas. Dann zieht der auf einmal ein Beil! Rammt es ihm in sein Bein vor lauter Wut.« Die Stimme des Weibes bebte. »Wer tut denn so was? Wer bringt ein Beil mit in ein Wirtshaus, sagt es mir?«
»Simon, gib mir eine Kompresse«, sprach Paracelsus tonlos. Der hatte sie schon griffbereit, er war jetzt lange genug mit ihm unterwegs. Paracelsus presste sie auf die Wunde. Sofort war sie durchtränkt.
Paracelsus’ Hand wurde weggestoßen:
»Ich bin der Arzt dieser Stadt. Nach mir wurde geschickt, mitten in der Nacht. Und Ihr lasst mich jetzt meine Arbeit tun.«
Der Mediziner baute sich düster dreinblickend vor Paracelsus auf. Der sah ihn nicht einmal an. Seine Augen waren allein auf die Wunde gerichtet. Es war eine nasse Höhle aus zerschnittenem Gewebe, nichts weiter.
»Ihr tretet jetzt sofort von meinem Patienten zurück«, versuchte es der Stadtarzt erneut.
Paracelsus kniff die Augen zusammen. Er tat sich schwer, irgendeine Struktur in all dem Blut zu erkennen. Seine Poren öffneten sich. Sein Atem beschleunigte. »Ich kann nichts sehen, Simon.«
»Verschwindet, sofort.« Der Arzt wurde lauter.
Paracelsus und Simon tupften und pressten jetzt beide, dennoch war das Blut nicht aufzuhalten. »Simon, ich kann überhaupt nichts sehen.« Paracelsus’ Schläfen fingen an zu schmerzen. »So kann ich ihm nicht helfen.«
»Geht beiseite, sage ich!«
Paracelsus schielte zu dem Gesicht des Burschen hinauf. Seit er die Knochensäge nicht mehr vor sich sah, kämpfte er nicht mehr gegen die Arme an, die ihn hielten. Jetzt waren seine Augen glasig. Sein Flehen wurde leiser. Fast waren seine Schreie Paracelsus lieber gewesen. Dem Jungen ging die Kraft aus.
»Ihm läuft die Zeit davon«, flüsterte Simon. »Er verblutet.«
»Infatti!«, rief der Arzt aus. Jetzt rempelte er Paracelsus an. »Der da ist mein Patient.« Der Bursche wimmerte durch den Beißkeil. »Und Ihr vergeudet wertvolle Zeit.« Der Arzt hielt die Knochensäge demonstrativ in die Luft. Das Weib schrie auf. »Was ich mit ihm treibe, geht Euch gar nichts an. Also entfernt Euch jetzt, Ihr Stümper.«
Paracelsus duckte sich instinktiv vor der Knochensäge und öffnete den Mund zur Antwort, aber das Weib kam ihm zuvor:
»Ich habe ihn geholt. Paracelsus soll ihn behandeln, und nicht Ihr!«
»Der ist nichts weiter als ein Scharlatan mit großen Worten.« Der Arzt spuckte Paracelsus direkt vor die Füße. Der aber blieb gelassen. Er wusste, wie das hier ausgehen würde. Gut die Hälfte der Männer, die da in der Trattoria versammelt waren, hatte er schon von dem ein oder anderen Leiden befreit. Sofort ballten sich die ersten Fäuste.
»Sofia will ihn heiraten. Sie entscheidet.«
Ein Vieh von einem Mann mit grimmiger Miene und rauem Bart nahm dem Arzt die Knochensäge aus der Hand und schubste ihn, leicht, aber entschieden. Zwei weitere kamen aus einer Ecke auf den Stadtarzt zu.
»Porco cane«, fluchte der und spuckte Paracelsus abermals vor die Füße. »Dann lasst ihn verrecken, wenn Ihr wollt. Nessun problema!« Schimpfend suchte der Stadtarzt das Weite. »Dem Herzog selbst werde ich hiervon berichten, verlasst Euch darauf. Alfonso wird Euch aus der Stadt jagen, Paracelsus. Endlich!«
Der hörte nicht hin. Besorgt sah er zu der jungen Frau. »Ich kann Euch nicht versprechen, dass wir die Säge nicht gebrauchen werden. Eine Wunde dieser Art …«
Das Weib nickte traurig. Der Bursche aber spuckte den Beißkeil aus: »No! No! Bitte Paracelsus. Lasst mir mein Bein. Ich flehe Euch an!« Tränen sammelten sich in seinen Augen.
»Der Schwamm, Simon.« Sanft strich Paracelsus über die Stirn des Verwundeten, dann legte er seine Handfläche so ruhig wie möglich über dessen Augen, sodass er sie schloss. Den Schlafschwamm hatte Paracelsus in seiner eigenen Mixtur getränkt: Alraunenwurzel, Efeublätter, Maulbeeren, Mohnsamen und die Früchte der Schierlingspflanze. Behutsam drückte er ihn auf Mund und Nase des Verletzten. Der wehrte sich nicht und nahm fast dankbar einige Atemzüge. Seine Glieder zuckten. Er seufzte auf. Dann – erschlafften seine Arme unvermittelt. All seine Muskeln entspannten sich. Er war eingeschlafen.
Paracelsus wischte sich die braunen Locken aus der Stirn und besah nochmals das blutende Loch vor ihm. Doch, ein Bein mit so einer Wunde musste amputiert werden. Das stand außer Frage. Sonst würde der junge Mann sterben. Wobei … Paracelsus wurde hektisch.
»Simon, gib mir die Klemme.« Er sah hinter sich zu der bangenden Verlobten des Mannes. Ob sie ihn noch heiraten würde, wenn er ein Krüppel wäre?
»Die was?«, fragte Simon.
Paracelsus verdrehte die Augen: »Das metallene Ding, das aussieht wie eine Zange, aber sich verhakt, wenn man sie schließt.«
Simon kramte in der Tasche.
Paracelsus spreizte mit seinen bloßen Fingern die Muskeln auseinander. Das reichte. Das Beil des Angreifers musste die Arterie schon zur Genüge freigelegt haben. Bald glaubte er jetzt, sie weißlich schimmernd zu erkennen, genau über der Stelle, an der unablässig frisches Blut hervorsprudelte. Er kniff die Augen zusammen. Dann setzte er fast auf gut Glück die Klemme an. Sie verhakte sich – um irgendetwas. Der Verwundete stöhnte. Paracelsus atmete auf. Es funktionierte. Sofort ebbte der Blutstrom ab.
»Siehst du?« Paracelsus deutete auf das abgeklemmte Gefäß des Burschen. Er kannte den Anblick schon von den Toten damals, im anatomischen Theater. Simon aber staunte und nickte ehrfurchtsvoll.
»Und jetzt?«, hauchte der.
»Der Schnitt ist nicht groß. Wir könnten ihn einfach zunähen.« Paracelsus befühlte die durchtrennten Wände der Arterie und rätselte. »So wie Haut.«
»Du willst ein Gefäß zusammenflicken?« Fast lachte Simon auf. »Wie soll das denn halten?«
Paracelsus funkelte Simon an. Die Kürze der Nacht war vergessen. Fast gierig leuchteten jetzt seine grünlich-braunen Augen auf. »Wird es nicht, Junge.« Er lächelte schelmisch. »Außer die Nähte sind richtig gut.«
Er ließ sich von dem Weib einen Stuhl und ihren Segen geben und sah in die weit geöffneten Münder um ihn herum. Alsdann machte er sich an die Wunde.
»Simon, gib mir die dünnste Nadel und die feinsten Hanffasern, die wir haben.«
Der verzog zweifelnd sein Gesicht. Paracelsus griff mit einer feinen Pinzette nach der Gefäßwand. Mehrmals rutschte er ab. Seine Hände zitterten. Sein Herz schlug schnell. Wenn der Bursche es nicht schaffte, wäre es allein seine Schuld. Dann aber ließ sich das Gefäß greifen. Viel fester war es als bloße Haut. Er stach mit der Nadel hinein. Führte den Hanffaden hindurch. Atmete ein und wieder aus. Zog versuchsweise daran und nickte zufrieden. Es riss nicht. Vorsichtig führte er die Nadel zum anderen Ende der Arterie. Zog am Hanf. Die Gefäßwand hielt. Es gelang! Behutsam knotete er den ersten Stich.
Alle Kerzen des Gastraums brachte man ihm herbei. Simon beobachtete ihn gebannt. Einer der Männer stimmte ein Vaterunser an. Paracelsus kniff die Augen zusammen, um schärfer zu sehen. Stich um Stich setzte er. Millimeter für Millimeter. Langsam und bedächtig. Simon kaute vor Aufregung auf seiner Zunge herum. Einer der Männer wurde bleich und musste nach draußen. Ein anderer trat unnütz auf die Wand ein. Das Weib hielt liebevoll den Kopf ihres Verlobten. Paracelsus knüpfte feinste Knoten. Simon schnitt die Fasern ab. Mit jedem Stich schmiegten sich die Wundränder fester aneinander.
»Paracelsus, das Bein ist schon ganz weiß.« Simons blaue Augen schimmerten ängstlich. »Darf das weiß sein?«, flüsterte er fast unhörbar.
Paracelsus nickte, schielte aber besorgt zu dem schneeweißen Fuß des Schlafenden hinab. »Ich hab’s gleich.«
Er seufzte tief und setzte einen letzten Stich. Dann hielt er den Atem an und richtete sich auf. Sein Kiefer schmerzte. Seine Hände kribbelten. Seine Schläfen pochten. Keiner im Gastraum wagte noch zu atmen. Einer biss sich die Lippen blutig. Aller Augen waren auf die Klemme gerichtet. Ein Staubkorn fiel zu Boden. Man hörte es. Das war der Moment. Paracelsus löste die Klemme. Starrte auf das Gefäß. Zählte die Sekunden, wie zu Stein erstarrt.
»Ja!«, rief Simon aus. »Ja, ja!«, jubelte er.
Ja, das war es! Paracelsus blies heiße Luft durch seine Wangen. Kein Blut lief mehr nach! Der grimmige Mann mit dem Stoppelbart klatschte in die Hände. Das Weib schluchzte und sackte in sich zusammen. Die anderen Männer bekreuzigten sich. Paracelsus wollte seine Nadel in einen durchtrennten Muskel setzen, aber Simon ergriff seinen Arm.
»Das kann ich auch, Meister. Geh du dich waschen und zieh dich um. Oder willst du zu spät kommen zu deiner eigenen Feier?«
Paracelsus sah durch das Fenster nach draußen. Simon hatte recht. Eile war geboten. Der Morgen dämmerte bereits.
Paracelsus
»Also dürft Ihr Euch fortan, Paracelsus aus Einsiedeln, Doktor beider Arzneien nennen.«
Dekan Capolla legte Theo feierlich den roten Talar um. Der zupfte sofort an ihm herum. Er war nicht groß gewachsen und auch nicht von breiter Statur. Überall war der Mantel zu weit. »Ihr seid nunmehr Doktor der Medizin und Doktor der Chirurgie gleichermaßen.«
Der Applaus war schallend. Jahrzehntealter akademischer Staub wurde aufgewirbelt und tanzte fröhlich in der muffigen Luft umher. Wohlwollender Sonnenschein fiel durch die großen Fenster und machte den dunklen Stein der Wände glänzen. Zum Bersten voll war die kleine Aula der Universität zu Ferrara. So etwas vermochte nur Paracelsus: Normalerweise fanden sich zur Verleihung der Doktorwürden nur einige desinteressierte Professoren und Kommilitonen neben den stolzen Müttern und Vätern ein. Verhaltenes Klatschen gesellte sich sonst zu unschlüssigem Gähnen und ungeduldig scharrenden Füßen. Heute aber – drängten sich dankbare Bauern und verliebte Mägde dicht an dicht neben gönnerhaften Adligen und neidischen Medizinern.
Die Menge jubelte Paracelsus zu. Nun ja, ein Teil jedenfalls, musste sich Theo eingestehen. Gut die Hälfte fletschte erbittert die Zähne. Theo sah es wohl. Doch er lachte bloß in sich hinein. Ja, so mochte er das! Fluchen sollten sie, so laut sie wollten. Jetzt konnten ihm seine Widersacher endlich gleich sein. So wie ein jeder. Ab heute würde er sich nur noch vor seinen Patienten zu rechtfertigen haben. Nein, das scheute er nicht. Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Endlich war er ein richtiger Arzt. Niemand auf der Welt konnte ihm das wieder nehmen.
Die zwei Semester in Ferrara waren für Paracelsus und Simon wie im Rausch verflogen. Nachts hatten sie gefeiert und getrunken, so gut sie nur konnten, tagsüber hatten sie genauso eifrig die Universität besucht. Begeistert hatte Paracelsus hier die Vorlesungen gehört und nur die besten Noten erhalten. Sein Freund Caspar hätte ihn nicht wiedererkannt.
Hatte er hier seinen Professoren widersprochen, war er nicht des Saals verwiesen worden, wie so oft in Basel. Im Gegenteil, man hatte sich freudig der Diskussion gestellt. Paracelsus hatte sie gewonnen. Immer. Eine Handvoll wissbegieriger Studenten hatte sich so um ihn geschart, wie schon seinerzeit jenseits der Alpen. Diese hatten Paracelsus nur allzu gern zur Hand gehen wollen, bei was auch immer, und waren ihm auf Schritt und Tritt gefolgt. Oft war er vor ihnen davongelaufen. Hatte sich zuweilen vor ihnen versteckt. Weder hatte er sie seine Bücher tragen lassen wollen noch den Patenonkel von irgendjemandem kennenlernen. Auch wollte er keine Dirne aufs Zimmer gebracht bekommen. Simon schon. Er sonnte sich in Theos Ruhm. In Ferrara war er zum Mann geworden.
Anfangs hatte er nur schüchtern gelauscht, wenn Paracelsus eine Bauerntochter oder Hure mit in sein Bett gebracht hatte. Nach einigen Wochen hatte er unter seiner Decke hervorgelugt. Bald unverhohlen gestarrt. Dann hatten sie angefangen zu teilen. Das war nur gerecht, hatte Paracelsus bei sich gedacht und angestrengt versucht, nicht an Margrets rehbraune Augen zu denken.
Die Huren waren schließlich seltener geworden, mit der wachsenden Zahl von Paracelsus’ Bewunderern. Man konnte Theos Erfolg in seinen Laken riechen: Hatten die Mägde noch den Duft von Schweiß und Erde zurückgelassen, so war dieser sukzessive durch teures Parfüm wohlhabender Töchter – oder deren Mütter – ersetzt worden. Die beiden Männer hatten das Leben in vollen Zügen genossen.
Seit Paracelsus nach dem ersten Semester eine der hässlicheren Cousinen Herzog Alfonsos von einem schweren Asthmaanfall geheilt hatte, während ihr Leibarzt hilflos ihre blasse Hand gehalten hatte, hatte es kein Halten mehr gegeben.
Lange Schlangen hatten sich samstags vor seinem Stand auf dem Marktplatz gebildet. Arm und Reich sich die Füße in den schmerzenden Bauch gestanden. Simon hatte Schmiergelder annehmen wollen, um die betuchten Bürger vorzulassen, aber Paracelsus hatte es ihm verboten. Er hatte seine Prinzipien. Immer wieder hatten die reichen Patrizier nach dem Studenten geschickt und gern den fehlenden Abschluss zugunsten ihrer Heilung ignoriert, wie es der Dienstbote einstmals im Büro des Pedells vorausgesagt hatte.
Die eingesessene Ärzteschaft Ferraras hatte Gift gespuckt, aber das war Paracelsus gleich gewesen. Narren und Totengräber hatte er sie genannt und mit solch derben Witzen besehen, dass sie bald wieder eingeschüchtert in ihr Kämmerlein zurückgekrochen waren.
Der Buchdrucker von damals hatte sich tatsächlich breitschlagen lassen und Theos Kräuterbuch, das Herbarius gedruckt. Nicht gerade zu seinem Leidwesen: Das Buch war ihnen förmlich aus den Händen gerissen worden. Alle Leute in Ferrara, die lesen konnten, und weit darüber hinaus hatten Paracelsus’ Wissen mit Begeisterung verschlungen. So hatte es Paracelsus geschafft, binnen weniger Monate auch die gesamte Apothekerschaft der Stadt gegen sich aufzubringen. Auf den Feldern und Wiesen suchten die Kranken jetzt nach Heilpflanzen, anstatt für die teuren Arzneien aus den Regalen zu bezahlen. Paracelsus hatte die kleine Stadt erschüttert. Gehasst hatte man den Neuling mit der seltsamen Nase und den Rektor dringend ersucht, ihn von der Universität auszuschließen. Seit Theo aber eine durchreisende Gräfin aus Venedig mit zweiundvierzig Jahren doch noch hatte schwanger werden lassen, und diese Ippolito d’Este persönlich von dem neuen Wunderheiler erzählt hatte, waren alle Dämme gebrochen. Paracelsus war Ferraras Antwort auf alle Gebrechen dieser Welt. Er war unantastbar geworden.
Gemeinsam mit Niccolò Leoniceno hatte er zwei Schriften über die Syphilis verfasst. Jeder Medizinstudent Ferraras lernte sie auswendig. Und heimlich auch die Ärzteschaft.
Seit heute nun sollte Paracelsus ihr Mitglied sein.
Dekan Capolla überreichte Theo lächelnd sein Diplom mit dem Siegel der Universität darauf. Einen Moment lang überlegte Theo, ob sich der Dekan aufrichtig für ihn freute oder nur froh war, ihn endlich los zu sein. Er wusste es nicht. Dann besah er stolz sein Diplom:
Ex Labore Fructus.
Theo schmunzelte. Er zumindest hatte sein Ziel mit mehr Glück als Disziplin und mehr Einfallsreichtum als Beharrlichkeit erreicht. Der Weg zum Doktor hatte ihn ob seiner vielen Reisen mehr Zeit gekostet als den Dümmsten seiner Mitstudenten. Aber auch weitaus weniger Fleiß.
Allein eines ließ Theos Lächeln gefrieren: Bedächtig glitt sein Zeigefinger über die goldenen Lettern.
Paracelsus – stand dort geschrieben. Paracelsus hatte die Doktorwürde erreicht. Nicht er. Nicht Theo. Theophrastus von Hohenheim war ein Niemand. Und sollte es bleiben. Aus Angst vor der bischöflichen Inquisition hatte Theo seinen Geburtsnamen ablegen müssen und ihn seither nicht mehr verwendet. Nur enge Freunde nannten ihn noch bei seinem richtigen Namen. Und die hatte er hier nicht. Die waren zu Hause – in Basel.
Mira
Die glühende Sonne Siziliens brannte auf ihre schwarzen Locken. Ruhelos wanderten Miras dunkelblaue Augen über die schwarze, zerklüftete Steilküste, weit hinunter zur weißen Gischt der brechenden Wellen, vorbei an kristallklaren Wassermassen und endlos in die Ferne, hinüber zu einem blaugrauen Horizont.
Von dort würde er kommen. Die Segel waren vermutlich schon gesetzt. Und hatte der Hohepriester erst die Meerenge überquert, war sie tot.
Irgendwo südlich von Marsa Allah in der Nähe des alten phönizischen Tempels harrte sie nun aus, Tag für Tag, im Schatten des unheilvollen Gemäuers, in dem man ihr Todesurteil sprechen würde. Voll Stolz und Ehrfurcht für die eine Göttin Astarte hatten ihn ihre Vorfahren erbaut. Der Tempel war mittlerweile zu einer Ruine verfallen, und doch flüsterten seine Wände ihr alte Geheimnisse zu, verweilte sie in deren Schatten. Dunkle Flüche von einst waren tief in das Gestein geschmettert worden. Die Magie war noch lebendig in den verwilderten Tempelmauern. Astaroths Macht war ungebrochen. Mira konnte es deutlich fühlen. Ihre Nackenhaare stellten sich auf.
Hier sollte sie also sterben. Bald. Wohin sollte sie auch fliehen? Nichts war hier. Außer vereinzelte Gräser und vertrocknetes Gebüsch. Sand, Stein, und wieder Sand. Und Hitze.
Die Menschen hier lebten von dem Salz des Meeres, das sie in mächtigen Salinen in weißes Gold verwandelten, und von dem Thunfisch, den sie in ihren Netzen abschlachteten. Es gab die Tempelruine, trockene Lehmhäuser, wackelige Holzschuppen und misstrauische Blicke. Sonst nichts. Kein Eingeborener würde ihr Zuflucht gewähren. Nirgends konnte sie sich verstecken. Niemand würde ihr helfen. Deshalb ließ sich ihr Kerkermeister so gut wie nie blicken. Die Insel selbst war Miras Kerker.
Der König mochte sich Herrscher Siziliens und Neapels nennen. Hier regierte aber doch nur einer: der rote Orden. Miras Bruderschaft. Es war allzu deutlich zu erkennen, wenn man denn wusste, worauf man achten musste. Die Runen, die in die Häuserwände geritzt waren, erschienen klein und unscheinbar, aber sie waren da. Die Kirchen der Christen waren höher und schöner als Astartes Tempel, dennoch fand Mira auf jeder ihrer Schwellen eine geköpfte Taube oder die Haut einer Schlange an die Wand genagelt. Astartes Pentagramm hatte sie nun schon ein dutzend Mal verstohlen hinter irgendeinem dunklen Fenster aufblitzen sehen.
Sizilien war der Göttin von einst noch immer treu ergeben. Und ihren Priestern. Kein Schiff würde sie von hier fortbringen. Allein schwimmen konnte sie, weg von dieser verwunschenen Insel, bis ihre Arme zu schwach werden und ihre Lungen sich mit dem Salzwasser füllen würden.
Sie betrachtete die goldene Heiligenfigur in ihrer Hand mit Verachtung. Der heilige Petrus. Schutzpatron der Reuigen und Büßenden. Für Mira war er nur ein Mann mit einem Schlüssel. Zornig warf sie den Kirchenschatz in die Fluten. Er hatte ihr nicht geholfen.
Mira blickte rätselnd über ihre Schulter, zurück zu dem kargen Lehmhaus, in dem sie ihr Ordensbruder untergebracht hatte. Er war nicht da. Nur selten hatte sie ihn gesehen, seit er sie aus Basel hierher verschleppt hatte.
Viel später war er damals in Basel eingetroffen, als Mira es gedacht hätte. Die Zeit des Wartens damals die eigentliche Folter. Das Unveränderliche nicht verändern zu können, dem Unausweichlichen entgegensehen zu müssen. Ohne dass es kam. Dann aber hatte sie ihre Hände ganz freiwillig in seine Ketten gelegt, als sie gehört hatte, was ihr Ziel sei. Sie hatte vor den Hohepriester gewollt. Unbedingt sogar. Allein nun, da es nahte, erschien ihr der Entschluss dem Wahnsinn entsprungen.
Ein ermordeter Großmeister hätte den Hohepriester niemals dazu gebracht, sie selbst anzuhören. Astartes verschwundenes Buch – schon. Es dem weißen Arzt zu überlassen, war Mira damals als eine durchaus elegante Lösung erschienen. Weder war er grausam noch verschlagen, noch wollte er sich selbst bereichern. Wie so viele Männer ihres Ordens. Nur bei seiner Suche nach der menschlichen Seele schien er etwas zu ehrgeizig zu sein, und das war verzeihbar. Vor allem weil seine Bemühungen, Astarte anzurufen, ohnehin aussichtslos bleiben würden.
Mira hatte befürchtet, Paracelsus würde die Flucht misslingen. Dann wäre alles beim Alten geblieben. Ein neuer Großmeister als Miras Herr. Vielleicht machthungriger als Balthazar. Vielleicht dümmer. Und das Heiligtum ihrer Welt weiterhin geschützt durch unwürdige Hände. Mit Paracelsus’ Verschwinden aber hatte sich die Bruderschaft in ein Hornissennest verwandelt. Ihr größtes Heiligtum war weg! Man stritt sich, beratschlagte und plante. Flüsterte, wisperte und verzweifelte. Und hatte den Hohepriester herbestellt.
Damals hatte es in Miras Heimat Mord und Totschlag gegeben um dieses Buch, wo ein jeder wusste, wie kostbar es war und welche Mächte man mit ihm entfesseln konnte. Immer wieder war der Orden überfallen worden. Von Abtrünnigen, weltlichen Herrschern und habgierigen Ungläubigen. Von einem jeden, der um das Buch wusste. Bis der halbe Orden tot und seine Kampfkraft aufgebraucht gewesen war. Deshalb hatte der Hohepriester beschlossen, es in der Fremde zu verstecken. Wo kein menschliches Ohr jemals von Astarte gehört hatte. Es lag nun an Mira, ihm seinen Fehler vor Augen zu halten.
Ob sie das überleben sollte, wusste nur Astarte selbst.
Paracelsus
»Paracelsus, dich von deiner eigenen Feier zu schleichen.« Simon stolperte mit tadelndem Blick herein. Dann lachte er. Er brauchte eine Weile, bis er sich in der heillosen Unordnung ihres Zimmers zurechtfand: Theo lag – in seinen roten Talar geschmiegt – selig in seinem Strohbett. Ein leerer Beutel Rotwein diente als Kopfkissen. Überall auf dem Boden lagen Bücher und Pergamentrollen. Dazu leere Krüge und schmutzige Teller von den letzten Nächten. Ihre Vermieterin, eine kugelrunde Gastwirtin mit lauter Stimme und langsamem Verstand, schimpfte wohl aus gutem Grund mit ihnen. Trotzdem bezahlten sie keine Miete mehr, seit Paracelsus ihrem Mann ein Mittel gemischt hatte. Die Signora war wieder glücklich.
Simon entfernte angewidert ein paar Hühnerreste und zwei eingetrocknete Dosen mit Theos selbstgemischter Salbe von einem wackeligen Hocker und setzte sich: »Wie fühlt man sich als Doktor, Paracelsus? Im roten Talar?« Simon grinste. »Irgendein Unterschied?«
»Hauptsächlich betrunken«, antwortete Theo und legte den Arm über seine Augen. Es war Mittag. Die Sonne schien herein und blendete ihn.
»Also kein Unterschied«, antwortete Simon fröhlich. »Der Tag ist noch nicht vorbei, Mensch«, rief er und warf Theo einen Beutel auf die Brust. »Unsere Feier geht erst los! Ich hab unten zwei Dirnen gesehen, da fallen dir die Augen raus, Mann.«
Theo seufzte und setzte sich mühsam auf. Schon drehte sich das Zimmer.
»Herrje!« Er nippte und verzog seinen Mund. Es war Grappa. Der tat zwar seinen Zweck, aber der selbstgebrannte Zwetschgenschnaps von Esther Göttisheim war ihm doch lieber gewesen.
Simon lachte: »Du, ich hab mein letztes Hemd dafür hergegeben, weißt du?«
Theo nahm noch einen Schluck und zog eine Grimasse. »Danke, Junge. Das ist ein wirklich originelles Geschenk. Laurencz wäre stolz auf dich!«
»Ja, was soll man denn jemandem schenken, der schon alles hat? Ruhm und Geld und Weiber? Die Doktorwürde noch dazu? Was kann man sich sonst noch wünschen auf dieser Welt?«
Simon nickte Paracelsus anerkennend zu. Der seufzte lautlos. Ihm wäre da schon noch so manches eingefallen. Das meiste davon war weit weg. Daheim. In Basel.
»Nichts, Simon. Wahrlich. Ich bin wunschlos glücklich«, antwortete Paracelsus traurig und nahm einen großen Schluck Grappa. Er brannte in seiner Kehle.
Allzu oft hatte er daran gedacht, nach seinem Abschluss nach Basel zurückzukehren. Von Gundelsheim war vertrieben, es gab keinen Grund mehr, sich in der Ferne zu verstecken. Zu gern hätte er mit Laurencz bei einem kühlen Bier über eine seiner albernen Geschichten von der Stadtwache gelacht. Allzu gern hätte er Margret wieder in seine Arme genommen. Wie früher, bevor sie ihm das Herz gebrochen hatte. Ob Caspar ihr seinen Ring schon an den Finger gesteckt hatte? Er hatte nie zurückgeschrieben … So viel zu seinem besten Freund. In einem anderen Leben.
»Wunschlos, Paracelsus? Wirklich?«
Simon zwinkerte ihm zu. Die blauen Kinderaugen von einst strahlten, gerahmt von engelsgleichem Haar. Und doch – tiefer Ernst umspielte seine Lippen, zog sich weiter über die pausbäckig gebliebenen Wangen, hoch zu angespannten Schläfen und kräuselte Simons Stirn. Wie bei einem alten Mann, dachte Theo. Der sehr verbittert war. Paracelsus kannte diesen Gesichtsausdruck mittlerweile. Und er kannte das Gespräch, das folgen würde.
»Lass mich, Simon! Bitte nicht schon wieder, nicht heute.«
Theo warf Simon den Beutel Schnaps auf den Schoß und fiel in sein Bett zurück. Demonstrativ drehte er den Kopf weg, gegen die schlecht verputzte Wand.
»Damit es nicht bei Muskeln, Blut und Knochen bleibt.«
Simon zog eine wütende Grimasse. Theo musste ihn nicht ansehen, um das zu wissen. Er seufzte auf zur Antwort.
»Versprochen hast du es, Paracelsus. Versprochen!«
Simon versuchte, seinen fleckigen Wams vom Alkohol zu säubern, Theo hatte den Beutel nicht verschlossen.
»Ich bin dir nichts schuldig, und deshalb habe ich dir auch nichts versprochen.«
»Dann dir selbst! Dir selbst, Meister, hast du es versprochen.«
»Nenn mich nicht Meister.«
Simon warf den guten Schnaps in eine Ecke und sprang auf. Der Hocker fiel.
»Sobald du deine Doktorwürde erlangt hast, fangen wir wieder an zu suchen. Hast du gesagt.«
Der blonde Jüngling atmete schnell. Er bemühte sich um einen süßlichen Tonfall. Fast war es ein Flehen: »Unsere Seelen, Paracelsus. Unser aller Geheimnis. Unser Selbst.«
Simon machte eine lange Pause nach jedem Satz. Als würden seine Worte so an Bedeutung gewinnen.
»Ich will nur Hofarzt der Este werden und Lukrezia Borgia besteigen. Ist das wirklich zu viel verlangt?«
Theo krümmte seinen Körper in das Stroh wie ein Kleinkind, das schmollte.
»Also erstens: Wenn hier jemand Lukrezia Borgia besteigt, bin ich das.« Simons Lachen missglückte. Theo reagierte nicht. »Und zweitens kannst du an einem Hof, an dem ständig der Bischof ein und aus geht, keinen Dämon beschwören.«
»Sie ist die Göttin der Wahrheit. Und Hüterin aller Geheimnisse.« Theo wollte gähnen. Heraus kam ein Grunzen.
»Genau! Mit zwei Hörnern, einer Schlange und einem Höllendrachen.« Simon lachte auf. »Ich wünsche dir viel Spaß dabei, Ippolito d’Este und seinen Folterknechten zu erklären, weshalb sie kein Dämon ist.« Simon fuchtelte in der Luft herum, als würde Theo hinsehen. »Der Bischof ist Herzog Alfonsos Bruder, verdammt! Und deshalb kannst du auch kein Hofarzt sein. Sonst fängt der ganze Schlamassel von vorne an. Wie damals.«
»Dann lassen wir’s halt bleiben.« Jetzt setzte sich Theo auf. »Die Seelen wollen nicht gefunden werden. Und Astaroth will uns nicht helfen, sie zu suchen. Zumindest das haben wir gelernt.« Er pustete seine Wangen auf. Dasselbe Gespräch. Sich endlos wiederholend. Seit zwei Jahren.
»Dann misch weiter deine Abführmittel und hure nachts durch die Gassen!« Simons Kinderaugen waren voller Verachtung. Angewidert zog er die Lippe nach oben. »Wisch goldene Ärsche ab und werde selbst zu einem. Wenn dir das reicht für dein Leben. Ich dachte, du wärst ein größerer Mann, Paracelsus.«
Simon spuckte angeekelt aus. Lautlos verließ er ihr Zimmer. Er würde wieder nach Astaroths Buch suchen. Theo wusste es genau. Müde ließ er sich wieder auf sein Lager sinken und schloss die Augen. Simon würde es niemals finden. Theo hatte es gut versteckt.
Mira
»Zu den Füßen der Göttin wirst du geboren. An ihrem Busen wirst du leben. Durch ihre Hände wirst du sterben.«
Der Hohepriester stand vor dem Hauptaltar, der aufwendig mit Gravuren aus einer anderen Welt geschmückt war, und huldigte seiner Göttin. Der Rest der Ordensbrüder und ‑schwestern hatte sich um Mira geschart. Als wollten sie ihre Flucht verhindern. Sie schluckte lautlos und versuchte, nicht ängstlich auszusehen. Sie fühlte sich krank. Und blass. Bemüht stolz hob sie ihr Kinn.
Der Zerfall des Tempels tat der Stimmung der Nacht keinen Abbruch: Die Risse in den Wänden nutzten den Mondschein, um aus ihren Schatten Bilder zu zeichnen. Die dunklen Winkel erzählten Sagen und Geschichten aus längst vergangen Tagen. Das warme Licht der Fackeln ließ Astartes Siegel hoch oben am Hauptaltar leuchten. Es war aus purem Gold, der Hohepriester hatte es mitgebracht. Wertvoller war nur Astartes Buch. Mira zitterte.
»Im Licht der Göttin sollst du wirken. In ihrem Schatten Zuflucht finden. In ihrer Dunkelheit wirst du erlöst.«
Ehrfürchtig lauschte die Ordensgemeinschaft den Worten ihres Oberhaupts. Alle Köpfe waren respektvoll geneigt. Nur Miras nicht. Gebannt starrte sie auf den Opferstein vor ihr. Ihr war ganz schlecht. Für sie war er bestimmt. Nervös spielte sie mit ihrem roten Gürtel.
»In ihrer Liebe sei behütet. Durch ihren Zorn krümme dich. Durch ihre Gnade werde Licht.«
Um Mira herum fielen alle auf die Knie vor Demut. Sie nicht. Sie war eine gesalbte und geölte Priesterin der Göttin Astarte. Dem Rang nach war sie höher als die meisten hier – gewesen. Jetzt war sie eine Verräterin. Fast hätte sie sich bekreuzigt, wie sie es bei den Christen immer gesehen hatte. Sie widerstand rechtzeitig. Das wäre das Ende aller Verhandlungen gewesen. Der Opferstein schien sie auszulachen. Mira wankte.
»Also, wie kam mein Diener Balthazar ums Leben?«
Der Hohepriester unterbrach die Liturgie. Viel zu früh. Die Glaubensgemeinschaft schrak auf. Prompt waren aller Augen auf Mira gerichtet, außer die des Hohepriesters. Mira kam sich klein vor. Sie suchte nach Worten, die sie sich vor Monaten zurecht gelegt hatte.
»Balthazar, mein treuer Diener. Du erinnerst dich?«
Unvermittelt drehte sich der Hohepriester zu ihr um. Ihre Blicke trafen sich. Mira kannte ihn gut, von ihrer gemeinsamen Zeit in Damaskus her. Ein paar Mal hatte sie ihm beigelegen, als er noch nicht Hohepriester gewesen war, sondern nichts weiter als der Sohn seines Vaters. Mira schauderte. Er hatte sich verändert. Sie wollte antworten, aber die Angst schnürte ihr die Kehle zu. Der Opferstein war noch ganz rot von altem Blut. Mira würgte. Der Hohepriester kam näher.
»Balthazar. Sprich.«
Er klang mehr interessiert als verärgert, und doch zuckte Mira zusammen. Sie schämte sich sofort dafür. Ein fetter, niederer Priester grinste schadenfroh.
»Meister, es gibt vieles zu berichten.«
Der Hohepriester blieb vor dem Opferstein stehen und strich behutsam mit der Hand darüber, fast liebevoll. Miras Augen konnten nicht anders, als seiner Hand zu folgen. Sie öffnete ihren Mund. Ihr Herz schlug schneller. Ihre Knie zitterten.
»Balthazar.« Der Hohepriester wurde ungeduldig.
Mira atmete durch. Heiß war die Luft in ihren Lungen.
»Er kam im Streit mit einem Ungläubigen ums Leben, Herr.«
»Also warst du dabei?« Der Hohepriester zog einen silbernen Dolch hervor und spielte mit ihm, fast unschuldig. Miras Pupillen weiteten sich. Nein, er war nicht mehr der Jüngling von einst.
»Ja, Herr.«
Mira senkte ihr Haupt. Ihre Stirn lag in Falten. Das würde nicht gut ausgehen.
»Also …?« Die Stimme des Hohepriesters wurde lauter. Er ließ die Klinge des Dolches über den Opferstein gleiten. Ansonsten war der Tempel vollkommen still. Keiner gab einen Laut von sich.
Mira atmete schneller. Ihr schwindelte.
»Ich habe ihn getötet«, flüsterte sie und kniff ihre Augen zusammen.
Der Dolch hielt inne. Überrascht. Jemand schrie auf. Eine niedere Dienerin zuckte zusammen. Der Hohepriester verzog keine Miene.
»Dafür stirbst du«, rief der Großmeister aus Zypern. Er war mit dem Hohepriester angereist. Mira hatte ihn noch nie gemocht. Sie schluckte einige Male. Ihr Puls raste. Das war ihre Chance. Dafür hatte sie sich gefangen nehmen lassen.
»Ich habe ihn getötet, weil er unwürdig war. Ein Wurm, kein Magier. Nicht würdig dieses Ordens. Und eine Schande für Astartes Buch.«
»Es ist nicht an dir, das zu entscheiden!«, rief der zypriotische Großmeister. Viele pflichteten ihm bei. Mira kümmerte es genauso wenig wie den Hohepriester. Sie ließ ihn nicht aus den Augen. Nur ihn musste sie überzeugen, alle anderen waren ihr gleich.
Der Hohepriester umrundete den Opferstein langsam. Mira fing an zu schwitzen. Gleichzeitig war ihr bitterkalt. Sie wollte rennen und bewegte sich nicht.
»Was hast du damit gemacht?« Direkt vor Mira blieb er stehen. Ledrige Haut spannte sich über hohe Wangenknochen. Seine Augen funkelten gelblich. Im Gesicht des Hohepriesters war nicht zu lesen. Eine Träne lief über Miras Wange. Sie wagte nicht, sie wegzuwischen.
»Ich habe es beschützt. Wie ich es geschworen habe.« Fast versagte ihre Stimme. Mira sah zu Boden.
»Wo ist es?« Der Dolch fasste Miras Kinn. Der zypriotische Großmeister lachte. In des Hohepriesters Augen lag tödlicher Ernst. Mira sah Astarte vor sich.
»Balthazar hat Schindluder damit getrieben. Wollte es für seine eigenen Zwecke benutzen. Hat es entehrt. Und mit Mächten gespielt, die er nicht beherrschte.«
Hastig holte sie Luft. Dafür hatte sie alles riskiert. Sie kannte die Sätze auswendig, und doch fühlte sie jetzt nur Leere in ihrem Kopf.
»Der Nächste, den Ihr schicken würdet, wäre vielleicht ehrenwerter, vielleicht auch nicht. Es war zu ungewiss. Einen Brief zu Euch, um die halbe Welt, konnte ich nicht schicken.« Miras Stimme überschlug sich. Die Tempelgemeinschaft hielt den Atem an. »Wäre ich mit dem Buch geflohen, hätten sie mich als Verräterin getötet, ohne Euch zu unterrichten. Es wegzugeben war der einzige Weg, bei Euch Gehör zu finden.«
»Wo ist es?«, flüsterte ihr Meister.
»Ich habe es fortgegeben. Um es zu bewahren.«
Mira schloss die Augen. Das würde bitter werden. Verräterinnen ließ man ausbluten.
»Wo?«, hauchte der Hohepriester aus blassen Lippen.
»Ich habe es einem Einheimischen anvertraut. Einem Arzt. Er wird es hüten wie seinen Augapfel«, antwortete Mira und biss sofort ihre Zähne aufeinander. Das war der heikelste Teil.
»Einem Ungläubigen?«, rief der Hohepriester empört.
Mira verzog ihr Gesicht.
»Einem Ungläubigen hast du unser Heiligtum überlassen?«, schrie der Hohepriester wieder. Zornig schlug er einen Kreis um den Opferstein, als ob er nicht wüsste, wohin er wollte.
»Schande«, schimpfte der Zypriot. Die restlichen Rufe waren entweder erschrocken oder wütend. Oder beides.
»Einem Ungläubigen? Unseren Schatz?«
Der Hohepriester wurde immer lauter. Seine gelblichen Augen glühten. Mira biss in ihre Faust. Sie war des Todes.
»Ich kann es zurückholen, Herr. Ich weiß, wo er ist«, rief Mira verzweifelt. Der Hohepriester aber nickte nur. Ganz leicht. Da näherten sich vier junge Priester dem Weib.
»Nein, hört!«, rief sie schnell. Sie schlug um sich. »Hört mir zu!« Es half nicht. Zornige Arme ergriffen sie und zwängten Mira auf den Opferstein. Er war rau und kalt. Mira wand sich darauf. Mit aller Kraft. Sie trat nach einem ihrer Brüder und traf seinen Bauch. Einem anderen biss sie in den Arm. Der jaulte auf.
»Ich kann ihn finden! Er wird es mir geben, er vertraut mir.« Mira suchte den Blick des Hohepriesters, während sie dem fetten, niederen Priester ihre Fingernägel in die Hand rammte.
»Wie ist sein Name?«
Der Hohepriester baute sich vor Mira auf. Sofort hielt sie still. Kaum bekam sie noch Luft.
»Ich hole das Buch zurück. Und dann bringen wir es nach Hause«, stammelte sie aufgeregt. »Auf europäischer Erde kann es nicht länger verbleiben.« Mira keuchte. »Es ist in der Fremde zu unsicher. Es gehört in die Heimat. Ihr müsst es nach Hause holen.«
»Sein Name«, flüsterte der Hohepriester.
Mira roch den Schweiß der Männer, die sie hielten. Sie röchelte. Solange sie ihm den Namen nicht genannt hatte, konnte er sie nicht töten.
»Ihr müsst es Astarte zurückgeben. Nur ihr gehören die Formeln darin! Es muss in ihren Tempel. Keine Menschenhand darf es jemals wieder öffnen!«
Der Hohepriester nickte geschäftig. Dann trat er einen Schritt zurück.
»Stecht ihr die Augen aus.«
Zwei Männer mit gezückten Messern näherten sich dem Opferstein. Mira fing an zu zappeln. Vergebens. Sie kam nicht los.
»Nein! Herr, wartet!« Mira schlug ihren Kopf umher. Ein Ordensbruder ergriff ihn.
»Nein, bitte. Ich kann ihn finden. Ich kann das Buch zurückholen! Bitte!«
Mira konnte ihren Kopf nicht mehr bewegen, er war fest umklammert. Nur ihre Augen huschten unruhig umher. Sie sah die Klinge kommen.
»Sein Name«, befahl der Hohepriester.
Die Klinge war über Miras rechtem Auge. Sie kniff es instinktiv zusammen.
»Nein!«, schrie sie.
»Sein Name.«
Mira ballte ihre Fäuste. Ihr Körper wurde bretthart. Sie spürte etwas auf ihrem Augenlid.
Mira schrie auf.
»Paracelsus!«, hallte es durch den Tempel.
Caspar
»Weil ich sie doch nicht hören kann, Herr Doktor! Aber sie glaubt mir nicht. Sie sagt, ich höre ihr nicht zu. Immer schimpft sie mit mir! Sagt, ich mache nicht, was sie mir aufträgt! Sagt, sie hätte dann doch lieber den Oswald geheiratet. Dabei kann ich sie nicht hören. Das ist keine Ausrede, Herr Doktor. Ich höre sie wirklich nicht!«
Der alte Bauer war den Tränen nahe. Er schluchzte bitterlich.
»Und dabei mag ich sie wie am ersten Tage noch. Alles würde ich tun für sie, könnte ich sie doch nur verstehen! Ich weiß bloß nicht, was sie will!«
Caspar nickte verständig. Er legte eine Hand auf die Schulter seines Patienten und neigte dessen Kopf behutsam zur Seite. Mit einer Kerze beleuchtete er das Innere des Ohres. Es war voller Dreck. Caspar seufzte erleichtert.
»Das glaube ich Euch wohl. Ich kann Euch helfen.«
Der Bauer sah ihn mit großen Augen an. »Was hab ich denn?«
»Ohrenschmalz«, antwortete Caspar fröhlich, »und Sonstiges.«
Der Bauer lächelte ihn kurz an. Dann fing er vollends an zu weinen. Er war aus dem Umland gekommen, den halben Tag hatte er entschlossen auf seinem Ochsenkarren zugebracht, um in die Stadt zu gelangen. Und sein Eheleben zu retten. Caspar füllte eine Schale mit Wasser und nahm eine große Ohrenspritze aus Metall. Das Wasser förderte Unaussprechliches zutage. Die Pinzette erledigte den Rest.
Caspar flüsterte: »Und? Hört Ihr mich nun?«
»Ja«, antwortete der Bauer. Er strahlte. »Ja! Ich kann Euch verstehen. Deutlich!«
Caspar lächelte: »Ich gebe Euch noch Kamillenöl mit. Gebt zwei Tropfen am Tag hinein. Sie sind ein bisschen entzunden.«
»Danke, Herr Doktor.« Der Bauer sprang auf, wie neu geboren. »Den Oswald hätte meine Frau doch eh nicht haben wollen! Gott segne Euch.«
Caspar atmete zufrieden durch. Viele sollten nicht mehr kommen heute. Als Erstes am Morgen hatte er ein Bruchband in die Leiste gelegt. Dann zur Ader gelassen. Ein Klystier verabreicht. Auf das Operationsverbot der Kirche gepfiffen und Hämorrhoiden mit Hanffasern ligiert. Er hatte das Gift der Herbstzeitlosen für die Gicht gegeben und Mönchspfeffer gegen die Frauenschmerzen verabreicht.
Dankbar sah Caspar um sich. Man hatte ihm eine kleine Praxis in der Martinsgasse eingerichtet. Nachdem er die Doktorwürde erlangt hatte, war er sogleich vom kleinen Rat zum Stadtarzt Basels berufen worden.
Lange war die Stellung vakant gewesen. Tagtäglich bildete sich nun eine lange Schlange bis nach vorn zum Kirchplatz hin. Für die normale Bürgerschaft war es ein neu errungener Segen, dass es jetzt einen Mediziner gab, dessen Behandlung sie sich leisten konnten. Seit Paracelsus und sein Stand am Markt fort waren, hatte sich niemand mehr um ihre Leiden gekümmert.
Nun legte der Rat selbst Caspars bescheidenes Honorar fest und verpflichtete ihn dazu, die Armen unentgeltlich zu behandeln. Caspars Verdienst war so keineswegs mit dem seiner Kollegen zu vergleichen, die sich von den hohen Herrschaften als Leibarzt oder in einem Kloster hatten anstellen lassen. Aber Caspar hätte es nicht anders haben wollen. Er war der Arzt seiner Stadt! Bald kannte er Jung und Alt. Ihre Gebrechen, ihre Nöte, ihre Sorgen und Freuden. Man zeigte ihm schmerzende Zehen oder schütter werdendes Haar. Erzählte ihm von den Zahnschmerzen der Kinder und den überteuerten Preisen des Hufschmieds. Von der Dürre der Felder und den immer kleiner werdenden Würsten der Metzger. Stolz präsentierte man ihm den Nachwuchs oder weihte ihn in etwaige Heiratspläne ein. Caspar war der Mann des Vertrauens für Körper und Seele.
Die Bürger dankten es ihm sehr: mit selbst gebackenem Kuchen, frischen Eiern, gebrauchten Schuhen, bunten Stickereien, allerlei Obst und Fleischwaren, Leinen oder Feuerholz. Die Umarmungen der Patienten waren herzlich, ihre Dankbarkeit aufrichtig und die Wertschätzung ihres Grußes mit Geld nicht zu bezahlen. Dafür war Caspar durch viele Auflagen geknechtet. Die Basler Medizinalordnung verlangte die Erlaubnis des Rates, sollte er verreisen wollen, und verpflichtete ihn zu Hausbesuchen zu jeder Tages- und Nachtzeit. Eine ungewöhnliche Krankheit hatte er umgehend zu melden, ebenfalls die Bestände der städtischen Apotheken regelmäßig zu überprüfen. Er war seiner Stadt verpflichtet. Caspar nahm all das gern in Kauf. Etwas anderes hätte er nicht anfangen wollen mit seiner Fähigkeit. Erlernt von Paracelsus selbst.
Zuweilen war Caspar erschüttert, wie wenig er nun aus den Vorlesungen an der Universität gebrauchen konnte und wie vieles von den Lektionen, die Theo ihm erteilt hatte. Zuweilen lächelte er in sich hinein, bei so mancher Erinnerung an ihre gemeinsamen Jahre.
Ein Bäckermeister kam hereingehumpelt. Sein rechtes Bein war dick und mit schmutzigen Tüchern umwickelt.
»Guten Tag, Herr«, sprach Caspar freundlich.
»Gott zum Gruß, Herr Doktor.«
Caspar bettete den Patienten auf die lederne Liege, die Göttisheim ihm zu seiner Praxiseröffnung geschenkt hatte. Unbezahlbar war sie! Aber seit Jacob zum Rektor der Universität ernannt worden war – als erster Jude, der dieses Amt jemals innehaben durfte – war sein ohnehin schon beträchtlicher Wohlstand noch gewachsen.
Caspar wickelte das Bein aus und bemühte sich sehr, keine Grimasse zu schneiden. Der Geruch war beißend! Er sollte vorher die Fenster öffnen, mahnte er sich selbst. Er vergaß es regelmäßig.
»Was in Gottes Namen habt Ihr denn angestellt, Herr?«, rief Caspar aus. Es musste wohl eine große Fleischwunde sein, die da in den Unterschenkel geschlagen war. Caspar sah sie aber nicht: Eine dicke Schicht aus gelb-grünlichem Belag lächelte ihm entgegen, verbacken mit Dreck und unzähligen braunen Haaren.
»Der Köter hat mich gebissen, dieses Mistvieh!«, jammerte der Bäcker. »Mein Balg hat ihm einen Knochen gegeben, da war aber noch bestes Rindfleisch dran. Bestes Fleisch, sag’ ich! Ich wollte es mir zurückholen. Wir haben gekämpft. Der Köter hat gewonnen.« Unglücklich besah der Bäcker sein lädiertes Bein.
»Wann war das?«, fragte Caspar und befühlte sanft den Schenkel. Das Gewebe um die Wunde war gerötet und glühend heiß.
»Vor zehn Tagen, glaube ich«, antwortete der Bäcker. Caspar sah ihn streng von oben herab an.
»Ich musste arbeiten, Herr Doktor. Meine Frau hat es behandelt. Aber jetzt kann ich keine Stunde mehr aufrecht stehen. Ich muss stehen können, Herr Doktor. Und gehen! Ich habe Mäuler zu stopfen.«
»Und das hier?« Caspar nahm eine Pinzette und zupfte an einem der Haare. Der Bäckermeister verzog schmerzverzerrt sein Gesicht. Das Haar gab nicht nach.
»Die sind von dem Köter. So ist es doch, oder? Gib die Haare von dem Vieh darauf, das dich gebissen hat, und es wird heilen. Hat meine Frau gesagt. Sie hat das Vieh geschoren.«
»Ja …« Caspar sah den Mann schockiert an. Wie abergläubisch die Menschen waren. Andererseits jagte das größte Genie der Stadt Geistern nach. Man musste es der Bäckersfrau verzeihen. »Nein, mein Herr. Dem ist leider nicht so, meine ich.«
Caspar legte feuchte Tücher darauf, um das Wundsekret aufzuweichen. Professor Hartmann hatte sie gelehrt, auf solch eine Wunde kochendes Öl zu gießen, um den Eiter zu bekämpfen. Theo hatte ihm nicht geglaubt. Caspar überlegte: Selbst wenn das Fett helfen sollte, würden die Schmerzen für den Bäcker unzumutbar sein. Paracelsus würde wohl recht haben. Wie immer.
Vorsichtig wischte er den Eiter fort und zupfte sodann mit der Pinzette die Hundehaare aus dem Wundherd. Nun gaben sie nach. Der Bäcker jammerte trotzdem.
»Ich weiß, Meister. Das ist unangenehm. Ballt Eure Fäuste, das wird helfen.«
»Könnt Ihr mein Bein retten?« Der Bäcker hatte die Zähne zusammengebissen und nuschelte entsprechend. »Nur darauf kommt es an.«
»Ich denke schon, Meister. Habt keine Angst.« Caspar biss sich auf die Zunge. Man sollte keine Versprechen geben. Niemals. Caspar ging an der Ölflasche im Regal vorbei und griff stattdessen zu Paracelsus’ Allheilmittel: Schnaps. »Er macht Wunden und Herzen heilen«, hatte Theo zu später Stunde im Goldenen Ochsen immer gerufen. Caspar seufzte milde lächelnd.
Er kippte den Alkohol sorgsam auf die Wunde und entfernte damit die verbliebenen Wundreste. Der Bäcker schrie auf.
»Es brennt, Doktor! Darf das brennen?«
Caspar nickte. Ja, die Weiber waren das tapferere Geschlecht. Er tränkte saubere Tücher mit dem Alkohol und legte sie auf die Wunde. Dann wickelte er einen mäßig straffen Verband darum.
»So. Ihr fasst das nicht mehr an, verstanden? Wir sehen uns übermorgen, dann werde ich die Tücher wechseln.«
»Ja, Doktor. Vielen Dank«, murmelte der Bäckermeister. Er hopste unbeholfen von der Liege.
»Ihr belastet das Bein bitte nur, so weit es sein muss«, sprach Caspar streng.
»Ja, Doktor.« Der Bäckermeister nickte artig und humpelte davon. »Gott sei’s gedankt, Herr Doktor.«
»Nicht selbst anfassen«, rief ihm Caspar nach. »Keine Hundehaare! Ich würde es bemerken.«
Caspar schuf gedankenversunken Ordnung in seinem kleinen Behandlungszimmer. Das sollte für heute der letzte Patient gewesen sein. Er wusch sein Besteck sorgsam und trennte die saubergebliebenen Tücher von den schmutzigen. Mehrmals lief er im Kreis umher und überprüfte, ob alles sauber war. Er war stets etwas wirr, wenn ihm Theo in den Sinn gekommen war.
Dass Paracelsus tatsächlich so töricht gewesen war, einen Dämon zu beschwören, um hinter das Geheimnis der menschlichen Seelen zu kommen! Caspar trieb es noch immer zur Weißglut. Und dass er selbst deswegen von der Inquisition beschuldigt und eingesperrt worden war, allein weil er sich mit Paracelsus ein Zimmer geteilt hatte, Caspar konnte es bis heute nicht verzeihen.
Es war nun gut zwei Jahre her, seit sich die Kirchenreformation in Basel durchgesetzt und sich das Bürgertum vom Adel emanzipiert hatte. Laurencz hatten sie auf dem jüdischen Friedhof außerhalb der Stadtmauern zu Grabe getragen. Margret hatte stundenlang geschrien, als würde man ihr Herz herausreißen, und hatte ihren Bruder nicht beerdigen wollen. Esther Göttisheim hatte blass neben ihr gestanden und nur leise gewimmert. Jacob hatte reglos ausgeharrt. Laurencz war sein einziger Sohn gewesen. Wochenlang hatte er mit niemandem gesprochen. Hatte sein Haus nicht mehr verlassen, nicht mehr gegessen und zu wenig getrunken. Für Caspars eigenen Kummer schien kein Platz geblieben zu sein. Und doch fühlte er ihn immer noch, nachts. Kein wahrer Freund war ihm geblieben auf dieser Welt.
Nach der Beerdigung hatte es eine ganze Woche geregnet, als würde der Himmel mit ihnen weinen. Laurencz’ Mörder hatte man nie gefunden. Es hätte wohl auch keine Rolle gespielt, versuchte sich Caspar zu trösten. Basel hatte sich damals selbst bekriegt. Und tapfere, starke Männer kamen im Kriege um. So war das nun einmal. Doch Laurencz hatte den Frohsinn dieser Welt mit sich genommen. Und dass gerade er hatte umkommen müssen, um diesen verkommenen Bischofsfürsten zu retten, nagte an Caspars Herzen.
Heinz, sein Kamerad bei der Stadtwache, war noch zurückgelaufen nach Kleinbasel in jener Nacht, doch hatte er nurmehr Laurencz’ warme Leiche vorgefunden. Letzte Worte hatte es nicht gegeben. Ohnehin hätte er nur von seiner Zwillingsschwester gesprochen. Dass man sie beschützen müsse, wenn er nicht mehr war. Das wusste Caspar. Und hatte es sich geschworen.
Der Stadtwächter selbst war untröstlich geblieben. Wöchentlich suchte Heinz Caspars Praxis wegen seiner Albträume auf. Doch Johanniskraut half bei solchen Leiden kaum, und alle Worte der Vergebung hatte Heinz schon tausendmal gehört. Dennoch buhlte er um Caspars Freundschaft: Einige Male hatten sie sich im Goldenen Ochsen getroffen, um über Laurencz zu sprechen. Fürwahr, das war heilsam für beide. Doch am nächsten Tag war alles wieder grau.
Caspar hatte lange gezögert, den trauernden Jacob Göttisheim aufzusuchen. Um Jahrzehnte schien er gealtert. Doch Margret hatte einfach nicht mehr aufgehört zu weinen. Entweder hatte sie zu Boden gestarrt. Oder es flossen die Tränen. Oder beides. Tag und Nacht. Und Nacht und Tag. Caspar war machtlos gewesen. Margret hatte nichts gehört und nicht gesprochen. Nur manchmal hatte sie im Takt zu ihrem Puls den Kopf geschüttelt.
Also hatte er es gewagt. Endlich. Nur um irgendetwas zu unternehmen. Caspar hatte bei ihrem Vater um Margrets Hand angehalten. An dem Tag hatte Jacob Göttisheim das erste Mal seit jener Nacht wieder gelächelt. Und tatsächlich! Das Unmögliche war geschehen: Margret hatte vom Boden aufgeblickt, aufgehört zu weinen, genickt statt ihren Kopf geschüttelt. Und Ja gesagt! Die schönste Frau der Stadt hatte eingewilligt, Caspars Weib zu werden. Ihre Hochzeit war still und bescheiden geblieben, obwohl das Laurencz mit Sicherheit missfallen hätte. Aber noch war niemandem zum Feiern zumute gewesen.
An dem Tag hatte Caspar den Ring von Paracelsus’ Mutter der Frau geschenkt, in die sie beide verliebt gewesen waren. »Er gehört an ihren Finger. Und du wirst ihn ihr anstecken«, hatte Paracelsus damals gemeint. Jetzt verfluchte sich Caspar selbst dafür. Für immer sollte nun Paracelsus’ Ring an Margrets Hand glänzen. Es war zu spät, um das zu ändern …
Caspar und sein Weib hatten ein kleines Stadthaus in der Rittergasse, nicht weit entfernt vom Barfüsserplatz, bezogen. Caspar hatte sich geschämt. Mitnichten war das der Wohlstand, den Margret gewohnt war. Und doch, seine Frau war glücklich dort. Liebevoll richtete sie ihr Zuhause ein, lernte kochen und nähen und fing sogar wieder an, die Zither zu spielen. Irgendwann war es Caspar mit einem sehr schlechten Scherz gelungen, Margret ihr einst so sorgloses Lachen wieder zu entlocken. Bis zum Rathaus hätte man es hören können! Margret hatte sich sofort eine Hand vor den Mund gehalten und war sichtlich erschrocken ob ihrer Fröhlichkeit. Dann hatte sie bitterlich geweint und von den Marotten ihres Bruders erzählt. Seitdem ging es ihr besser.
Der kleine Laurencz war nun ein strammer Junge von bald einem Jahr. Er war aufgeweckt und lebhaft mit dicken Beinchen und rosigen Wangen. Er war Margrets ganzes Glück. Sie begann, ihre Rolle als Frau des Hauses ein klein bisschen weniger zu verabscheuen, und ihre Blicke waren kaum noch neidisch, wenn Caspar aufbrach, um seine Praxis zu öffnen. Sie trank weniger und fluchte leiser, und doch war sie kein normales Eheweib. Caspar dankte Gott dafür. Sie beriet ihn gut bei der Behandlung der Patienten, oft genug war sie in der Universität gewesen oder hatte bei Theo gesessen. Lauthals äußerte sie ihre Meinung über die Erneuerung der Christenkirche oder debattierte über die Politik der Stadt.
Jacob Meyer zum Hasen hatte sich wacker geschlagen, alles in allem. Die Stadt hatte ihre Hoheitsrechte behalten.
Zum Hasen hatte die Aussöhnung Kleinbasels mit der restlichen Stadt erreicht und damit den Frieden wiederhergestellt. Aufständische Bauern hatte er mit der Minderung ihrer Abgaben besänftigt. Um den Wohlstand der Stadt trotzdem zu erhalten, hatte er dafür dem Kaiser das Privileg zur Einrichtung einer Münzstätte abgerungen. Basler Goldgulden wurden geschlagen. Die Stadt war reicher denn je, während dem Fürstbistum ob der Reformation die Einnahmen fehlten. Bischof von Gundelsheim hatte sich schließlich bei seiner Stadt so hoch verschuldet, dass er nach und nach sämtliche Regalien verpfänden musste.
Dem Namen nach war Philipp von Gundelsheim noch der Fürst Basels, aber er war weder geistlich noch weltlich ihr Herrscher geblieben. Er hatte seine Residenz nach Pruntrut verlegt. Ohne sein Domkapitel. Das hatte seinem eigenen Bischof den Rücken gekehrt und war ins Breisgau geflohen. Keiner wusste, warum. So war Gundelsheim ein Fürst ohne Macht und ein Bischof ohne Kirche. Die Stadt war frei. Letztes Jahr hatte man ihm den Treueeid verweigert. Der Rechtsstreit um das Basler Münster aber dauerte bis heute an. Gundelsheim beharrte auf wahnwitzigen Entschädigungszahlungen. Zum Luft gab ihm keinen Rappen. Der hatte endlich die Nerven mit seinem Bürgermeister verloren, als zum Hasen französische Schmiergelder angenommen hatte. Tumulte im Rathaus und Unruhen auf den Straßen hatte es gegeben. Also hatte zum Luft den Hasen ins Gefängnis geworfen und sich kurzerhand selbst zum Bürgermeister wählen lassen. In der ersten Reihe regierte es sich leichter.
Ende der Leseprobe