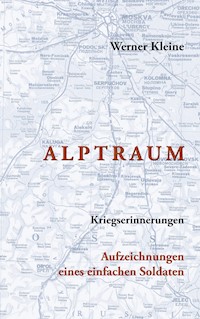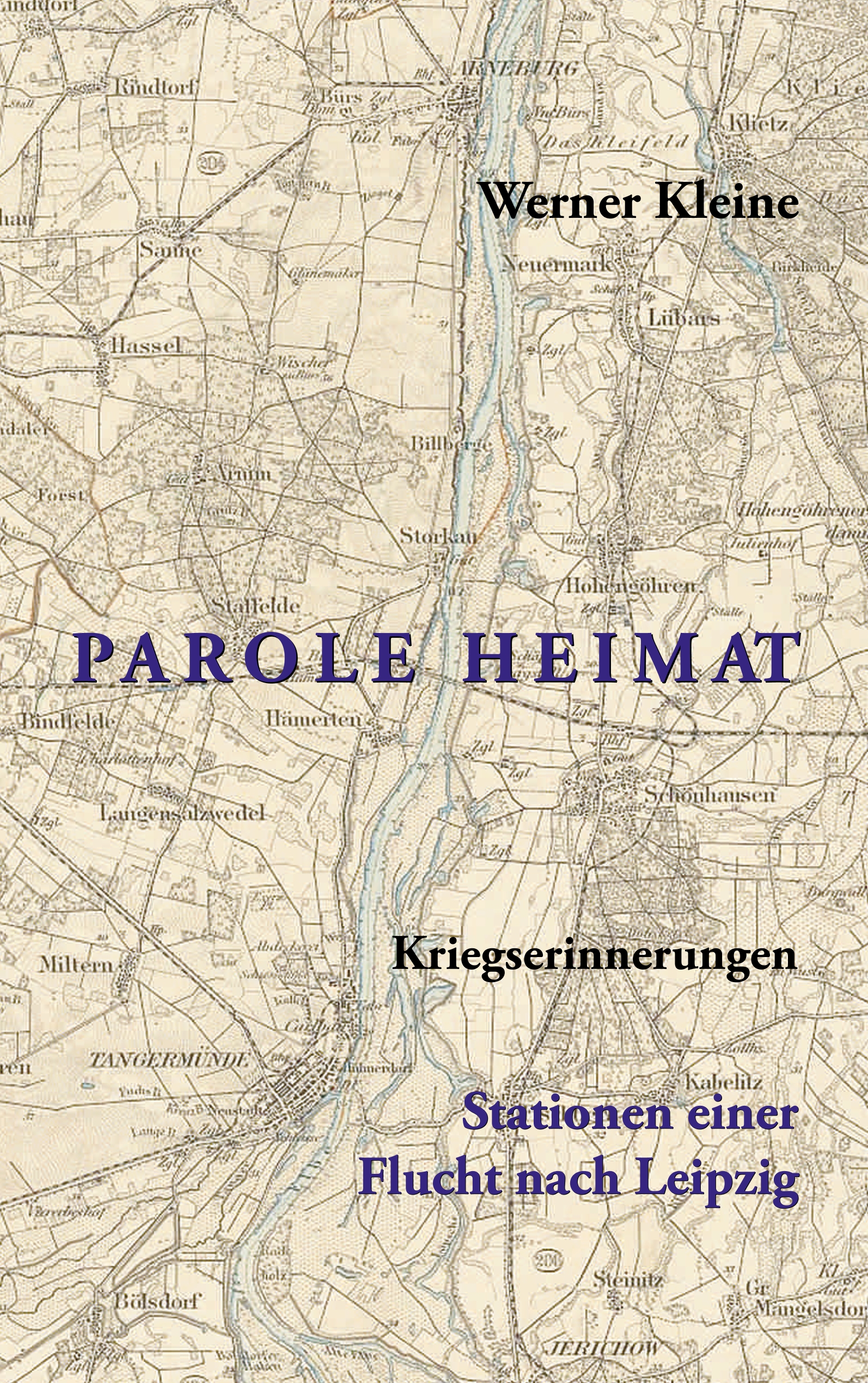
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Werner Kleine, geboren 1922 in Leipzig, war 74 Jahre alt, als er dieses Buch über die letzten Tage als Soldat im Zweiten Weltkrieg erstmals veröffentlichte. Dem folgten dann 2003 die Kriegserinnerungen "Alptraum" über die Zeit beim Reichsarbeitsdienst, die Grundausbildung als Soldat und den Einsatz an der Front. Heute, zum Zeitpunkt der Wiederauflage beider Bücher, nunmehr in seinem 98. Lebensjahr, ist er einer der letzten Zeitzeugen dieses Krieges und der Diktatur. In Zeiten, in denen wieder vermehrt Tendenzen zur Vertuschung, Rechtfertigung oder gar Verherrlichung des damals geschehenen Unrechts und der Kriegsgräuel zu vernehmen sind, ist es ihm besonders wichtig, dass die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges als eine Mahnung und Warnung an jüngere Generationen weiter bestehen und nicht in Vergessenheit geraten. "Die Wahrheit ist, zuerst wollte ich ein Held sein, zuletzt, auch im elendigsten Moment, nur noch überleben"
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Meinem Sohn Lothar in Dankbarkeit gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
Abschied
Bautzen
Stellungskrieg an der Neiße
Beginn der sowjetischen Großoffensive
Rückzug vom Brückenkopf Forst
Selbstverstümmelung
Über Königs Wusterhausen nach Berlin
In der Hauptstadt
Weiter geht's über Nauen nach Rathenow
Am Rande des Havelländischen Luchs
Waffenstillstand
Schwieriges Vorhaben: die Elbdurchquerung
Weg von den Iwans - hin zu den Yankees
Rückblick
Bildquellen
Verwendete Literatur
Vorwort
Weil man sich von seiner Vergangenheit nicht einfach abkoppeln kann, schrieb ich über den Krieg.
1933, bei Adolf Hitlers „Machtübernahme“, war ich zehn Jahre alt.
1945, als das „tausendjährige Reich“ ruhmlos unterging, befand ich mich im 23. Lebensjahr. Meine Geschichte hält sich streng an ein im April 1994 von Dr. Fritz Jahn und mir erarbeitetes Erinnerungsprotokoll. Jede Schilderung ist ausgefüllt mit Tatsachen und bezieht sich auf echte Erlebnisse. So, wie ich es heute beschreibe, ist es damals gewesen; so wie ich es ausdrücke, könnte es damals gesagt worden sein. Ich vermittle jedoch nicht nur Autobiographisches.
Meine Geschichte soll Entscheidungen verständlich machen, die in der sich kurz vor Kriegsende abzeichnenden Katastrophe von mir getroffen werden mussten.
Als ich zu schreiben begann, erlebte ich noch einmal die Bilder und Geräusche der Front. Nachts tauchten verdrängte Gefechtserlebnisse empor. Wenn ich aufstand, hatte ich Mühe, die Gedanken niederzubringen. Sie wurden zu Wachträumen von Abschieden, Drill und Verwundungen. Von Bahnhöfen, Kasernen und Lazaretten. Und zu Erinnerungen an Freunde und Kameraden, die unter dem Stahlhelm litten und in der Uniform starben. Annette Wolf, meine Lebensgefährtin, brachte mir großes Verständnis entgegen, als mich die Vergangenheit einholte. Für ihre Geduld darf ich mich an dieser Stelle besonders herzlich bedanken.
Der Autor
Einleitung
Die meisten Menschen bemühen sich, ihren Nachkommen etwas zu hinterlassen. Der Reiche vererbt Immobilien, der Arme ein persönliches Erinnerungsstück.
Es gibt andere Werte. Etwas zurückzulassen kann auch heißen, für seine Kinder und Enkel eine Geschichte aufzuschreiben. Denn das Leben ist die Summe einzelner Geschichten. Doch welche besitzt die Aussagefähigkeit, sich gerade für sie zu entscheiden?
Mich gab es als Schüler, Pimpf, Balljungen, Lehrling, Reichsarbeitsdienstmann und Soldaten. Erzählt man die Geschichte des Schwarzhändlers oder besser eine vom Handelsvertreter Kleine? Des Großhändlers, Ehemannes, Vaters? Wie wäre es mit Berichten über unsere Flucht aus der DDR 1953? Diese Reihe ließe sich beliebig fortsetzen. Beim Erzählen war es für mich ein schöner Gedanke, dass ich zwar mein eigenes Leben meinte, zugleich aber einen Zeitabschnitt meiner Generation beschrieb. Wenn andere Menschen beim Lesen meiner Geschichte empfänden, sie läsen gar nicht aus einem fremden, sondern aus ihrem eigenen Leben, dann wäre mir eine lebendige Geschichte gelungen. Denn wirklich tot ist der Mensch erst, wenn keiner mehr lebt, der ihn kannte.
Geschildert werden meine letzten Fronterlebnisse in den Wochen, als der Krieg schon „zum Kampf um Heimat und Familie“ geworden war. Ich war ein Landser, der - mit Unterbrechungen durch Verwundungen und Genesungszeiten - gleichermaßen Vormarsch und Rückzug mitgemacht hatte.
Landser waren „in Uniform gesteckte Zivilisten“, die ihre vaterländische Pflicht erfüllten. Landser war der Oberbegriff für das namenlose Heer der Befehlsempfänger und Marschierer.
Auf dem Wege zum Sieg waren wir Landser im allgemeinen unsere tapferen Soldaten, treue Seelen, fabelhafte Jungs, geradlinige, einfache Menschen und unsere braven Grenadiere.
Während der Rückzüge wurden Landser gelegentlich zu begriffsstutzigen Trotteln, in Gefangenschaft geriet auch viel feiges Pack, und Überläufer waren rotes Gesindel.
Die bedeutendste Persönlichkeit meiner Frontjahre war Alfred Eidel. Er war mein Kompaniechef und ein Tapferkeitsoffizier. 1942 erhielt er an der Oka das Ritterkreuz. Unter seinem Kommando erlebte ich Situationen unvorstellbarer Kameradschaft. Da stand einer für den anderen und jeder für jeden. Sich freiwillig für Stoßtrupps zu melden, entsprang einer Haltung sportlichen Ehrgeizes. Zum „echten“ Landser gehörten Tapferkeitsauszeichnungen oder Verwundetenabzeichen. Selbstlosigkeit und Verlässlichkeit begleiteten mich auch in die Entscheidungsschlacht um Kursk, an der ich 1943 im Orelbogen teilnahm.
Alfred Eidel ist 1944 als Träger des Ritterkreuzes mit Eichenlaub im Range eines Obersten gefallen. Er starb mit 34 Jahren.
Ich habe als Infanterist zwischen meinem 18. und 23. Lebensjahr mehr Höhen und Tiefen erlebt als manch Achtzigjähriger.
Nach dem Krieg hat es mich an den Volkstrauertagen oft zu den Kriegerdenkmälern und Gedenkstätten hingezogen. Ich stand vor ihnen und dachte, dass die Kriegstoten,,,wenn sie überlebt hätten“, ihre Geschichte erzählt haben würden. Ein Denkmal ist ein Mahnmal. Ein Appell an unsere Gefühle, nicht zu vergessen. Denn jeder Name, der auf diesen Steinen zu lesen ist, verkörpert ein eigenes Schicksal.
Das gilt auch für die Gefallenen und Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkrieges, die, wie der Großvater Rinaldo Klemm und mein Vater, die grässlichen Grabenkämpfe am Hartmannsweilerkopf und - als grausamste Perversion - die Leichenberge der mörderischen Materialschlachten um Verdun miterlebt hatten. Die eingemeißelten Namen erschienen mir wie eine Aufforderung an uns, die Davongekommenen, stellvertretend eine Wortmeldung abzugeben, damit sich das Kriegsbild nicht schon in der nächsten Generation verharmlost. Denn das ist nicht einfach alles so passiert, nein, das haben Menschen mit ihrem Denken und Handeln bewirkt. Der Zweite Weltkrieg hat mehr als 50 Millionen Menschenleben gefordert. Unter ihnen befanden sich etwa 6 Millionen auf deutscher und 20 Millionen auf sowjetischer Seite. Dem nazistischen Rassenwahn fielen annähernd 6 Millionen europäische Juden verschiedener Nationalitäten zum Opfer.
Zu den Hauptverantwortlichen zählten die Generäle. Wie die politischen Urheber des Krieges waren auch die Generäle Verächter der Weimarer Republik. Über die militärische Durchsetzung nationalstaatlicher Interessen ließ sich persönlicher Ehrgeiz befriedigen. In der preußischen Tradition bedingungslosen Gehorsams erzogen, durch den Eid auf den „Führer“ eingeschworen, folgten sie seinen Befehlen noch in der Schlacht um Berlin. Den Zerfall ihrer Frontabschnitte vor Augen, befahlen sie unsinnige Gegenstöße. Sie trieben ihre Soldaten in Gefechte, die nicht mehr zu gewinnen waren. Die Strategen am Kartentisch blieben bis zuletzt bei ihren Sandkastenspielen. Der Tod um sie herum konnte sie nicht beeindrucken. Der Soldat war für sie nur ein Staubkorn; nichts als tote Materie! Der Kadavergehorsam deutscher Generäle gegenüber dem Starrsinn des Oberbefehlshabers Adolf Hitler kostete zuletzt noch vor Berlin Tausenden jungen Menschen das Leben.
Die Generationen des Zweiten Weltkrieges sind an der Reihe, von der Weltbühne abzutreten. Von den Erlebnissen jener Zeit haben sie sich nie völlig lösen können. Viele von uns sind dazu verurteilt, bis an ihr Lebensende über die Kriegsjahre nachzudenken.
Die Wahrheit ist zuerst wollte ich ein Held sein zuletzt auch im elendigsten Moment nur noch überleben
Diese Zeilen schrieb ich in Dankbarkeit für jene, die damals um mich bangten und denen ich in Sehnsucht verbunden war: meine Frau, meine Eltern, meine Schwester.
Zur Erinnerung an vierzehn gefallene Mitschüler.
Zum Gedenken an meinen Freund Werner Hartmann und die toten Frontkameraden: Herbert Debald, Jochen Dietrich, Hardy Blum, Rolf Fetzer, Bubi Kraus, Helmut Karl, Heinz Wenzel, Alfred Eidel und Jürgen Roth.
Zur Mahnung an die nachfolgenden Generationen.
Abschied
Die Zeit lässt sich nicht anhalten. ,,Bitte nicht wieder auf dem Bahnhof“, hatte Annlie gesagt. Sie sprach mir aus dem Herzen. Nicht wieder endlose Blicke in tränenverhangene Augen. Nicht das Loslassenmüssen verklammerter Hände. Und nie wieder die quälenden Warteminuten und das stumme Nebeneinander, bevor sich der Zug endlich in Bewegung setzt.
Zu Hause war es nicht einfacher gewesen. Fest aneinandergepresst spürten wir den Schmerz. Ich hörte das leise Schluchzen hinter der Tür und wollte es nicht noch schlimmer machen. Nach der letzten Umarmung vor der Haustür noch einmal umdrehen und winken. Schnell um die Ecke biegen und zum Taschentuch greifen. Der Abschied lag hinter mir.
Nebel. Gelbe Schwaden wogten durch die Straßen. Was die vor der Stadt angesiedelten Chemiewerke, Rüstungsbetriebe und Braunkohlenzechen in den Himmel abließen, vermischte sich zu einem penetranten Gestank.
Der Leipziger Hauptbahnhof wirkt mit seiner gewaltigen Fassade wie ein klotziges Monument. Wer in dieser Stadt geboren wurde oder in ihr lebt, bleibt diesem historischen Denkmal zeitlebens auf individuelle Weise verbunden. Jeder Leipziger erinnert sich an Abreisen und Ankünfte auf einem der sechsundzwanzig nebeneinanderliegenden
Bahngleise. 1914, als mein Vater an die französische Front verladen wurde, war bereits die linke Bahnhofsgaststätte fertiggestellt und in Betrieb genommen worden. Während beider Weltkriege hat man seither von hier aus unzählige soldatische Heerscharen an viele Kriegsschauplätze abtransportiert.
Der Leipziger Hauptbahnhof 1944
Die Reichsbahn hatte mit Wirkung vom 24. Januar 1945 den Verkehr aller D- und E-Züge endgültig eingestellt. Im überfüllten Personenzug nach Dresden war deshalb kein Sitzplatz zu bekommen. Es dauerte seine Zeit, bis die Wagen bedächtig aus dem Bahnhof zuckelten.
Auf den Tag genau zwei Jahre vorher war ich zum Fronteinsatz in einen nach Orel2 fahrenden Güterwagen verstaut worden.
Es schien, als sei der letzte Januartag für mich schicksalhaft. Militärisch korrekt hieß es in meinen Fahrtpapieren: „Der Gefreite Werner Kleine wurde am 31. Januar 1945 zu seinem Ersatztruppenteil nach Bautzen in Marsch gesetzt.“ Ein Lungenschuss, den ich am 1. Mai1944 vor Witebsk bekam, hatte mich fünf Monate vor der Front bewahrt. Die geruhsame Zeit in einer Landesschützen-Einheit war nun vorüber. Die Bewachung englischer und französischer Kriegsgefangener hatte viel Zeit für das Privatleben belassen.
Die schönsten und wichtigsten Ereignisse jenes Zeitabschnittes waren meine Verlobung mit Anneliese Guth am 7. September 1944, der am 6. Januar 1945 rasch die Hochzeit folgte. Für den eilig anberaumten Termin sprach vieles. Annelieses bereits avisierte Einberufung als „Wehrmachtshelferin“ konnte verzögert werden, und für mich gab es sieben Tage Heiratsurlaub. Hinzu kam zur Bewirtung von Gästen das sogenannte Führerpaket, das Kaffee und Lebensmittel-Raritäten enthielt.
Trübe Gedanken überfielen mich, während der Zug ratternd in seiner Schiene stampfte und an den Fenstern die gespenstische Ruinenlandschaft der Vororte vorbeihuschte.
Zurückgeblieben war, was mir am Herzen lag. Neben Annlie, meiner attraktiven Frau, meine Mutter und meine Schwester Uschi. Vater war 1944, im einundfünfzigsten Lebensjahr, wieder einberufen worden. Sehr nahe standen mir auch meine Schwiegereltern und deren zweite Tochter Ursula.
Im Vergleich zu meiner letzten Reise von Leipzig nach Bautzen hatte sich aber nicht nur mein Familienstand geändert, sondern gravierend auch die Entfernung zur Front.
Damals, am 28. Februar 1944, lag meine Kampfeinheit, das zur 56. Infanteriedivision gehörende Regiment 171, südlich der Stadt Witebsk noch weit in Russland. Heute war die militärische Lage im Osten entschieden bedrohlicher. Seit Beginn ihrer Großoffensive am 12. Januar hatten die Sowjets Warschau überrollt und bereits zehn Tage später Insterburg und Allenstein erobert. In Ostpreußen waren die deutschen Truppen abgeschnitten. Knapp hieß es in der Verlautbarung des gestrigen Wehrmachtsberichtes: Sowjetische Truppen dringen in Pommern ein. Und während dieser Bahnfahrt sickerte durch, dass Königsberg von sowjetischen Verbänden eingeschlossen wurde. Für die Deutschen war die Front nicht mehr imaginär. Beim Umsteigen in Dresden waren große Plakate mit Durchhalteparolen und Erschießungsdrohungen gegen Deserteure nicht zu übersehen. Über Lautsprecheranlagen wurde die Wende des Krieges durch den kurz bevorstehenden Einsatz von „Wunderwaffen“ angekündigt. Der ,,Endsieg“ sei greifbar nahe. Im Abteil wurde von geheimnisvollen Todesstrahlen mit vernichtender Wirkung für alle Lebewesen gesprochen. Niemand schien es ernst zu nehmen. Ich war fest entschlossen, auch die letzte Phase des Krieges zu überleben.
Bautzen
Die ostsächsische Stadt empfing mich unfreundlich. Feldgendarmen, im Landserjargon „Kettenhunde“ genannt, machten Razzia auf Fahnenflüchtige. Zwei Männer in Zivilsachen wurden mit Knüppelschlägen und Fußtritten traktiert und in Fesseln aus dem Bahnhofsgelände geführt.
In der Kaserne angekommen, meldete ich mich bei Hauptfeldwebel Müller. Er befand sich in einem Raum voller Tabakschwaden, in dem selbst sein Schreibtisch keine festen Konturen mehr hatte. Im positiven Sinn vertrat Müller den militärischen Imperativ: Befehl und Gehorsam, Pflichttreue und Kameradschaft. Hunderte von Ab- und Neuzugängen hatten seinem phänomenalen Personengedächtnis nichts anzuhaben vermocht. Er erkannte mich sofort: ,,Ihnen scheint es ja bei uns zu gefallen“, begrüßte er mich mit einem Anflug von Spott. Der Qualm im Raum schluckte das Ritual der Ehrenbezeigung, so dass ich mir das Hochreißen des rechten Armes zum ,,Führergruß“ ersparte. Die nach dem misslungenen Attentat auf den „größten Feldherrn aller Zeiten“ erfolgte Abschaffung des traditionellen Militärgrußes (Anlegen rechten Hand an die Mütze) musste den Portepeeträger Müller tief in seiner Berufsehre getroffen haben.
,,Gefreiter Kleine meldet sich beim Ersatztruppenteil zurück!“ Der straffe Meldeton hat ihm sicher gefallen. Humorvoll, organisationsbegabt und korrekt, ein verständnisvoller Vorgesetzter, war dieser Mann als Spieß die ideale Besetzung. Zu Hauptfeldwebel Müller konnte man auch mit seinen persönlichen Problemen kommen.
Mich erwartete der übliche Ablauf. Anmeldung beim Schreibstubenbullen und Zuteilung einer Stube mit Neuzugängen. An das stupide Kasernengebrüll (,,Kompanie aufstehen!“), die Trillerpfeife und das Nachfassgeschrei des U. v. D. (,,Aufwachen, raus, bewegt euch!“) hatte man sich erst wieder zu gewöhnen. Es klingt einfacher, als es ist, aber ich war zu keinem Zeitpunkt bereit, mit der üblichen militärischen Dressur auch meine Persönlichkeit im Kasernenhof abzugeben.
Das bewährte organisatorische Schema, nach dem ein Soldatenleben im Krieg ablief, kannte ich aus eigenem Erleben schon recht gut: Ausbildung, Fronteinsatz, Verwundung, Lazarett, Ersatztruppenteil, Genesungsurlaub, Verwundeten-Sammelstelle Hoyerswerda. Ärztliche Begutachtung zwecks Feststellung des Tauglichkeitsgrades. Kriegsverwendungsfähig bedeutete Abstellung zu einer Marscheinheit mit anschließender Verladung zum Fronteinsatz. Garnisonsverwendungsfähig/Heimat versprach für begrenzte Dauer ruhigen Dienst bei einem Landesschützen-Bataillon. Dienstunfähig war gleichbedeutend mit Entlassung vom Wehrdienst und gelang allenfalls bei Vorzeigen des Kopfes unter dem Arm.
dass ich nach jeder Verwundung zur Gefangenenbewachung nach Leipzig abgestellt wurde, verdankte ich hier in Bautzen meinem hilfsbereiten Lehrer Paul Flämig. Als Major und stellvertretender Kommandeur eines Lagers in Hoyerswerda, in dem 5000 kriegsgefangene französische Offiziere einsaßen, kannte er die Ärzte der Sammelstelle von gemeinsamen Kasino-Abenden. Da gab es keine Probleme, meine Heimatwünsche zu erfüllen. Hauptfeldwebel Müller kannte mich seit den Kämpfen um Bolchow im Juli 1942. Damals war er Zugführer und ich Richtschütze eines schweren Maschinengewehres (SMG). Deshalb gewährte er mir eine gewisse Narrenfreiheit. Sie erleichterte meinen Entschluss, am Dienstbetrieb nicht mehr teilzunehmen.
Das Kasernenleben hatte sich kaum verändert: Aufstehen, Frühsport, Antreten, Exerzieren, Gefechtsübungen. Geblieben war der vertraute Geruch von Bohnerwachs in den Stuben und auf den Korridoren. Verschwunden, das heißt aufgelöst und zum Fronteinsatz gebracht, das Musikkorps. Auf dessen Tschingderassabum konnte leicht verzichtet werden.
Hauptfeldwebel Müller drückte den Rücken durch, so dass seine Orden wippten und das Goldene Verwundetenabzeichen funkelte. Sein Ton war zackig: ,,Funktionsträger weggetreten!“ Zu meiner Überraschung winkte er mir zu, mit den anderen loszurennen, als gehöre ich zu deren Haufen. So gewährt man einem Frontkameraden Freiheit. Klappte alles wie aus einem Lehrbuch für Landser. Hätte es eine Connection für Mannschaftsdienstgrade gegeben, Müller mit seiner herzlichen Ruppigkeit hätte zu deren Förderern gezählt.
Mit der grünen Dauerkarte „Botengänger zum Justizgebäude“ nun das Kasernentor passieren und hoffen, dass der Ausweis noch gültig ist. Nach einem flüchtigen Blick erfolgte die befreiende Handbewegung des Postens. Draußen sofort in Deckung gehen, weil die Marschkompanie im Gleichschritt mit dem Absingen von „Die blauen Dragoner, sie reiten mit klingendem Spiel durch das Tor“ zum Übungsgelände ausrückt. Wachsam sein gegenüber Militärstreifen und gut aufpassen, dass man Bekannten von früher aus dem Wege geht, weil auch gutgemeinte Fragen den Rechtfertigungsnotstand auslösen könnten. Auffallen durfte ich trotz der Wohlgesonnenheit des Hauptfeldwebels nicht, weil sonst Rolf KLAUS als mein Helfer enttarnt worden wäre. Ihm, der in Döbeln mein Rekrutenkamerad war, der 1942 vor Orel eine Oberschenkelamputation erlitt, verdankte ich die Botengänger-Dauerkarte. Sein angenehmer Verwaltungsposten durfte auf keinen Fall gefährdet werden.
In der Altstadt Bautzens gab es einige Lokale, die tagsüber öffneten und an die ich mich gern erinnerte. Im „Wallenstein“ war ich Stammgast. Dort hatte ich zu den auserwählten Gästen gezählt, denen Karpfen vorgesetzt wurde. Oft hatte ich in dieser gemütlichen Gaststätte die Dienstzeit beim Bier „ausgesessen“. Diesmal war alles anders. Der sympathische Wirt war inzwischen wegen „defaitistischer Äußerungen“ von der Gestapo abgeholt worden, und seine Frau zeigte sich ängstlich, peinliche Fragen beantworten zu müssen, falls man mich bei ihr anträfe. Die anderen Restaurants öffneten nur noch gelegentlich.
Die Vergangenheit holte mich vor dem Postamt ein. Leutnant Troitsch zeigte sich über das Wiedersehen erfreut: ,,Der Kammerjäger! - Kleine, was machen Sie denn hier?“ fragte er gut gelaunt. ,,Gratuliere zum Leutnant“, antwortete ich ausweichend.
Herbert Troitsch war 28 Jahre alt, Familienvater und hauptamtlicher Parteifunktionär. Als Kreisleiter der Stadt Torgau wäre er nicht einberufen worden. Troitsch hatte es als seine Pflicht angesehen, sich freiwillig zu melden, um ein Beispiel zu geben, ,,dem Volke zu dienen und allezeit bereit zu sein, das Leben für Großdeutschland zu opfern“. Für ihn gab es keinen Zweifel, dass „in dieser großen geschichtlichen Stunde“ jeder echte Deutsche seine Individualität gegen eine Uniform zu tauschen habe. Während der Stellungskämpfe um Orelim Mai1942 war Troitsch mein unmittelbarer Vorgesetzter.
Er hatte es eilig und verabschiedete sich mit der Einladung, ihn nach dem Endsieg in Torgau zu besuchen.
*
Dr. Friedrich war ein pensionierter Landgerichtsrat. Die Abschnitte seines Lebens teilte er nach Prozessen ein, in denen prominente Personen oder bemerkenswerte Sachverhalte eine Rolle gespielt hatten. Friedrichs waren Freunde meiner Schwiegereltern, die als „Ausgebombte“ bei Verwandten in Bautzen Zuflucht gefunden hatten. Nach herzlicher Begrüßung wurde ich über die aktuellen „Feindnachrichten“ informiert. Angeblich müsste Belgien von den deutschen Truppen aufgegeben werden. Auch in Frankreich befänden sie sich auf einem chaotisch verlaufenden Rückzug. Friedrichs befürchteten, dass Bautzen in absehbarer Zeit zur Festung erklärt würde, wodurch ihnen die Rückkehr nach Leipzig versperrt bliebe. Hinter der Maßnahme, Städte zu Festungen auszurufen, stand der Gedanke, sie uneinnehmbar zu machen und als Militärstützpunkte im besetzten Gebiet zu belassen, bis ihre Befreiung erfolgen könnte. Mit der Errichtung von Straßensperren und dem Aushub von Gräben sei an den Stadtgrenzen bereits begonnen worden.
Am 3. Februar warfen die Alliierten über Berlin 3000t Sprengbomben ab. Radio London verbreitete die Nachricht, dass die Stadt Colmar von französischen Truppen erobert worden sei. Während der ersten Februarwoche half ich Friedrichs beiden Vorbereitungen für ihre Rückkehr nach Leipzig. Drei eisenbeschlagene große Truhen sollten zusammen mit auszulagernden Akten per Kurierdienst vom Amtsgericht Bautzen nach Leipzig überführt werden.
Das Risiko, außerhalb der Kaserne aufgegriffen zu werden, wuchs von Tag zu Tag. Deshalb riet Dr. Friedrich dringend davon ab, in den Militärkomplex zurückzukehren. In einem nahegelegenen Anwesen sollte ich mich versteckt halten. Mit Lebensmitteln würde man mich versorgen, und ein Fahrrad, mit dem ich notfalls in den Wäldern der Lausitz verschwinden könnte, stünde dafür stets in der Gartenlaube bereit.
*
Die Kantkaserne war in den dreißiger Jahren errichtet worden und erfüllte alle Ansprüche, die im Ausbildungsbereich an einen modern ausgerüsteten Infanterietruppenteil gestellt wurden. Auf den ersten Blick hatte sich das Leben hier kaum verändert. Nach wie vor schallten Exerzierkommandos über den Hof, mussten „Kotzbrocken“ zur Räson gebracht und Neuzugänge unterrichtet werden, mit Waffen sachgemäß umzugehen. dass etwas Außergewöhnliches bevorstand, war an der Unruhe abzulesen, die Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften gleichermaßen erfasst hatte. Die Front ließ sich mit ein paar Fußmärschen erreichen.
War das Kasernendasein vor einem Jahr noch von gutausgebildeten jungen Männern geprägt worden, so herrschte nun ein Generationsgemisch aus zusammengewürfelten Einheiten vor.
Der Typ des drahtigen Haudegens, der den Fronteinsatz als Herausforderung und Bewährung ansah, war selten auszumachen. Zu besonders zackigen Offizieren, die als Draufgänger maskulines Heldentum verstrahlten, gingen auch höhere Ränge auf Distanz. Das Flair von Tollkühnheit war nicht mehr gefragt. Prothesenträger aller Dienstgrade bewältigten ihre Aufgaben nun mit mehr Routine und verminderter Schwungkraft.
Der hohe Verschleiß jüngerer Männer hatte ältere Jahrgänge in vakante Positionen nachrücken lassen. Ehemalige Reserveoffiziere wurden aktiviert. Uralte Leutnants wirkten befremdlich. Unteroffiziersdienstgrade, die auf die vierzig zugingen und von den Landsern nachsichtig als „Opas“ bezeichnet wurden,-pflegten ihre Leiden. Uniformierte Fünfzigjährige wurden als „alte Knochen“ eingestuft, und folgerichtig waren haltungsgeschädigte Männer über sechzig „Scheintodknochen“ oder „Knochen auf Abruf“. Den Teilnehmern des Ersten Weltkrieges begegnete man mit Respekt. Generalfeldmarschallvon Rundstedt, von 1942 bis 1945 Oberbefehlshaber der Westfront, befand sich zu diesem Zeitpunkt im 71. Lebensjahr. Den deutschen Soldaten des Endkampfes umfassten alle Altersstufen ab 16 Jahre.
Kant Kaserne
Im Krankenrevier herrschten indisziplinierte Zustände. Die überfüllte Bettenstation konnte das letzte Aufgebot unausgeheilter Verwundeter nicht mehr aufnehmen. Dem jungen Truppenarzt fehlte es neben Medikamenten vor allem an Menschenkenntnis.
Nie wäre er auf den Gedanken gekommen, dass die vor seinem Wartezimmer täglich anwachsenden Patientenschlangen im Zusammenhang mit seinem Sanitätsgefreiten Naumann stehen könnten. Wie ein Lauffeuer hatte sich dessen Schlachtruf verbreitet, der Assistenzarzt könne Simulanten nicht von Kranken unterscheiden. Naumann hoffte, durch einen hohen Krankenstand bei der bevorstehenden Räumung der Kaserne in das unabkömmliche Stammpersonal abtauchen zu können.
Der Sanitätsgefreite gab deshalb gern Hilfestellung beim Fiebermessen. Sich das Thermometer in Bereiche um 39 Grad hochreiben zu lassen, war den meisten zwei Schachteln Zigaretten wert.
*
Die Ostfront schob sich täglich näher an die Oder-Neiße-Linie heran. Somit wuchs auch die Gefahr, dass ich außerhalb der Kaserne als „Fahnenflüchtiger“ aufgegriffen würde. Ich hielt deshalb eine Krankschreibung für den besten Weg, um die Wiedereingliederung in den normalen Dienstbetrieb möglichst unauffällig zu bewerkstelligen. Das Attest erhielt ich nach flüchtiger Untersuchung wegen „akuter Atembeschwerden nach Lungenschuss“.
Als am nächtlichen Himmel des 13. Februar plötzlich Fluggeräusche zu hören waren, herrschte zunächst Ratlosigkeit. Einige glaubten, beiden unsichtbaren Formationen über unseren Köpfen handele es sich um den pausenlos angekündigten Einsatz der „Wunderwaffen“. Andere vermuteten deutsche Aufklärer. Das Aufheulen der Luftschutzsirenen gab nur Aufschluss über die feindliche Herkunft, nicht aber über die Dimension dieser Geschwader. In Erwartung aufsteigender Leuchtspurketten und einschlagender Bomben stürzten wir in die Luftschutzräume.