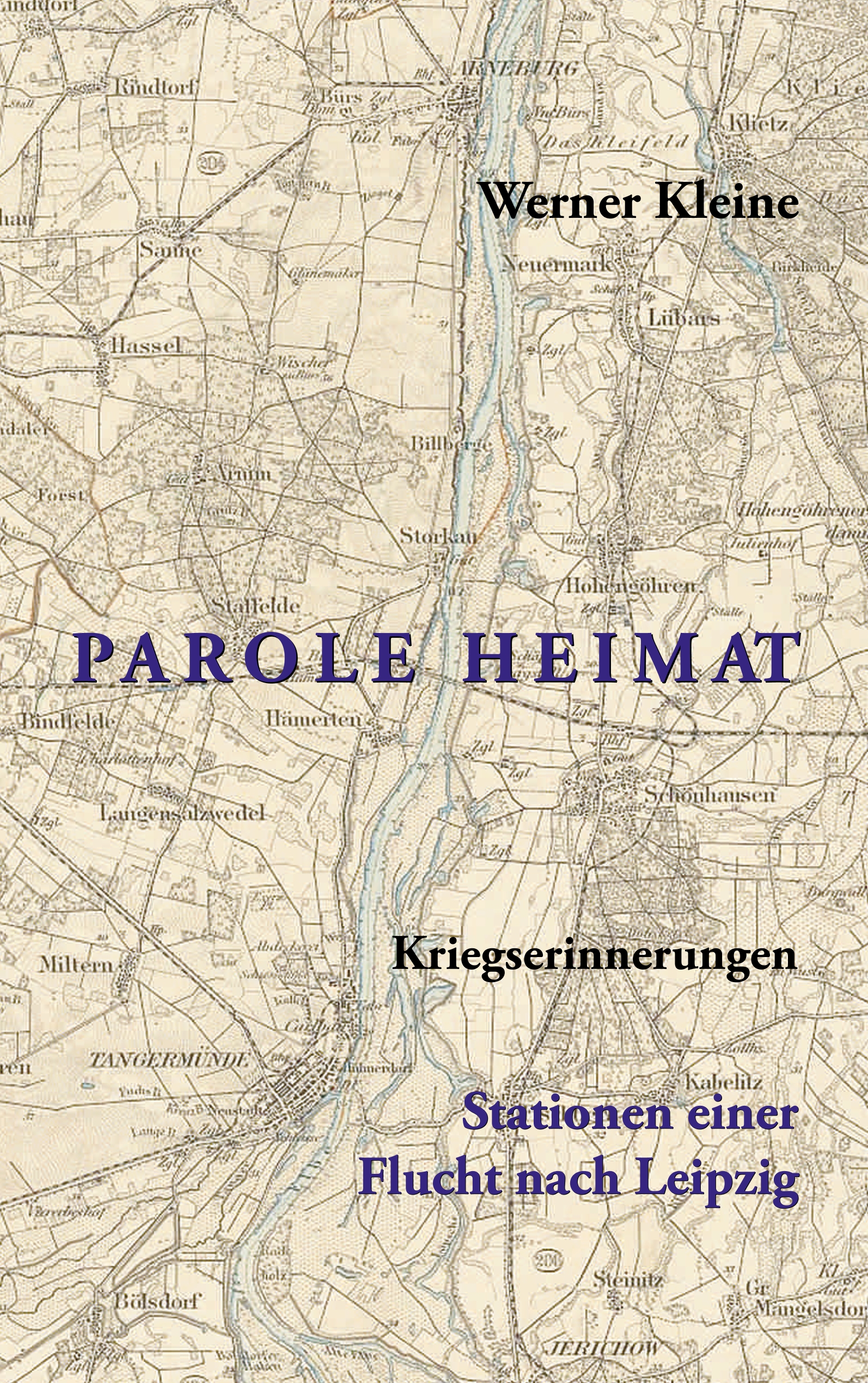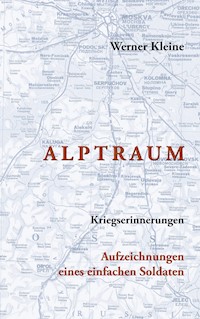
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Werner Kleine, geboren 1922 in Leipzig, war 81 Jahre alt, als er diese Kriegserinneringen erstmals veröffentlichte. Seinem schon 1996 erschienen Buch "Parole Heimat", in dem er die letzten Tage als Soldat im Zweiten Weltkrieg schildert, folgte 2003 "Alptraum" über die Zeit beim Reichsarbeitsdienst, die Grundausbildung als Soldat und den Einsatz an der Front. Heute, zum Zeitpunkt der Wiederauflage beider Bücher, nunmehr in seinem 98. Lebensjahr, ist er einer der letzten Zeitzeugen dieses Krieges und der Diktatur. In Zeiten, in denen wieder vermehrt Tendenzen zur Vertuschung, Rechtfertigung oder gar Verherrlichung des damals geschehenen Unrechts und der Kriegsgräuel zu vernehmen sind, ist es ihm besonders wichtig, dass die Erinnerungen an die Schrecken des Krieges als eine Mahnung und Warnung an jüngere Generationen weiter bestehen und nicht in Vergessenheit geraten. "Die Wahrheit ist, zuerst wollte ich ein Held sein, zuletzt, auch im elendigsten Moment, nur noch überleben"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Annette in Dankbarkeit gewidmet
Inhaltsverzeichnis
Teil I
Reichsarbeitsdienst
Barackenlager Pipinowo
22 Juni 1941
Die Kriegsgefangenen
Smolensk
Die Entlassung naht
Nachwort zu Teil I
Teil II
Einleitung
Rekrutenzeit in Döbeln
Dresden. Die Zeit mit Sonia Warin
2. Mai 1942
Als Infanterist an der Ostfront
Nahkämpfe bei Tula
Erste Verwundung
Bautzen. Die Zeit mit Margarete Suchy
Bei Jutta im Goldhahngäßchen
Erneut an die Front
Rückzug
Zweite Verwundung
Liebe auf den ersten Blick
„Erich, die Klöße sind fertig!“
Das Frontleben hat mich wieder
Dritte Verwundung
20. Juli 1944
Genesungsurlaub in Leipzig
Die Hochzeit
Leipzig, adieu!
Epilog
Tempi passati
Bildquellen
Teil I
ReichsarbeitsdienstJanuar - November 1941 Erinnerungen
Der Ursprung des Arbeitsdienst-Gedankens reicht zurück bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts. Zum ersten Mal in der neueren Geschichte griff Theodor Herzl (Tagebücher, Bd. 1, Eintragungen im Juni 1895, Seite 71 u. ff.) den Gedanken eines pflichtgemäßen Arbeitsdienstes auf. Ihm schwebte ein Arbeitsheer als militärische Organisation in seinem künftigen jüdischen Staatswesen vor.
Die ersten freiwilligen Arbeitsdienste entstanden im Nachkriegsdeutschland der zwanziger Jahre. Bei den Arbeitsdienst-Vereinen meldeten sich Freiwillige der verschiedensten Berufe und Ausbildungsziele. Korpsstudenten und Fabrikarbeiter, Kaufleute und Landarbeiter fanden sich zusammen in dem Bewusstsein von Solidarität. Der Arbeitsdienst half Neuland urbar zu machen, Moore zu entwässern, auf Feldern und Wiesen den Boden zu verbessern, die Ernte einzubringen. 1933 umfasste der freiwillige Arbeitsdienst 240 000 Mann.
Seine Tätigkeit wurde von Bauern und Siedlern begrüßt. Hilfreich stand der freiwillige Arbeitsdienst auch bei Katastrophen zur Verfügung. Hochwasser, Feuer und sonstige Gefahren wurden gebannt. Die Arbeitsdienstlager waren anfangs oft noch primitive Behausungen, die den Anforderungen der Hygiene nicht genügten. Demontierte Fabrikhallen, baufällige Baracken, alte Schafställe, viel zu enge Notherbergen für bis zu 50 junge Männer. Das war die Vergangenheit.
Im Jahr 1933 wurde Konstantin Hierl Reichsarbeitsführer. Der ehemalige Generalstabsoffizier führte die teilweise miteinander konkurrierenden Arbeitsdienst-Verbände zusammen. Am 19. Februar 1934 verkündete er sein Lebensgesetz:
Treue, Gehorsam, Kameradschaft!
Im Juli 1934 wurde Konstantin Hierl zum „Reichskommissar für den Freiwilligen Arbeitsdienst“ ernannt und gleichzeitig dem Reichsminister des Innern unterstellt.
Ab 26. Juni wurde jeder junge Mensch zwischen 18 und 25 Jahren per Gesetz verpflichtet, 6 Monate Reichsarbeitsdienst abzuleisten.
Werner Kleine, 18 Jahre
Der Überfall auf die Sowjetunion begann am 22. Juni 1941. Ich habe den Vormarsch vom ersten Tag an mitgemacht.
Meine Einberufung zum Reichsarbeitsdienst erfolgte am 20. Dezember 1940. Im Gestellungsbefehl war zu lesen, die Grundausbildung erfolge in Turosl. Nach längerem Suchen fand ich diesen Ort auf einer ostpreußischen Landkarte, er liegt südlich von Allenstein, aber bereits in Polen.
Wegen einer akuten Stirnhöhlenvereiterung verschob sich meine Abreise um zehn Tage. So blieb ich über Weihnachten und Silvester noch bei meinen Lieben.
Am 1. Januar 1941 verabschiedete ich mich. Der Tag begann mit Händeschütteln. Die Wohnungsnachbarn gaben viele gute Wünsche mit auf den Weg. Frau Hoyer würde mir Plätzchen backen, Frau Lässig wollte schreiben. Frau Malecki schenkte eine Tafel Schokolade. Herr Kohl, hauptamtlicher Amtswalter und Blockwart, versprach den baldigen Endsieg.
„Junge, in wenigen Wochen bist du wieder zu Hause!“
Mein Vater schlich durch die Zimmer und warf mir sorgenvolle Blicke zu. Sein Gesicht sprach Bände. Ich wusste, wie ihm zumute war. Muttel und Uschi zeigten sich gefasst und verständnisvoll, als ich sie bat, mich nicht zur Straßenbahn zu begleiten. Ich sah, wie sie mir vom Fenster aus nachwinkten, bis ich ihrem Blickfeld entschwand.
*
Im Treffpunkt Hauptbahnhof/Wartesaal 2. Klasse wurde ich schon erwartet. Ein braun uniformierter Käppiträger hielt einen Tisch frei.
„Ich bin Truppführer Müller“, stellte er sich vor, „und werde Sie zum Einsatzort unsrer RAD-Abteilung bringen.“
Minuten später trafen weitere Nachzügler ein, neun oder zehn insgesamt. Lothar Heinich war einer von ihnen. Er würde in meinem Leben noch eine Rolle spielen.
Müller ließ sich Ausweise und Benachrichtigungen vorlegen.
„Denn alles muss ja seine Ordnung haben!“
„Jawohl, Herr Truppführer!“
Müller lächelte nachsichtig und sagte berichtigend:
„Die Anrede 'Herr' vor dem Dienstgrad ist beider Wehrmacht üblich, nicht aber bei uns im Reichsarbeitsdienst!“
Im Schnellzug nach Allenstein/Ostpreußen waren Plätze für uns schon reserviert.
Die Fahrt verlief in jeder Hinsicht angenehm. Zufällig saß ich neben einer hübschen jungen Dame. Man könnte irgendwie ins Gespräch kommen, da würde die Fahrzeit schneller vergehen, hoffte ich. Irrtum. Gerade hatte der Zug den Bahnhof verlassen, fragte sie den Schaffner nach dem Speisewagen und verschwand.
Draußen flogen Stadt-Land-Fluss-Landschaften vorbei, verschneite Kiefernwälder, schmucke Dörfer. Im überheizten Zugabteil erlaubte der Fensterplatz reizvolle Ausblicke. Meine Nachbarin kehrte nicht zurück. Leider.
„Allenstein!“ Ankunft spät in der Nacht. Nach stundenlanger Reise verließen wir den Zug übermüdet. Draußen herrschten eisige Temperaturen.
„Auf dem zugigen Bahnsteig hier“, schlotterte Lothar Heinich, „bekomme ich den Kälteschock!“
Wir waren falsch angezogen, viel zu leicht bekleidet. Seidenschal, dünne Strümpfe und Halbschuhe. Alle traten frierend von einem Bein auf das andere.
Die Wehrmachtsbaracke, in der wir übernachteten, verfügte über einen kleinen Ofen. Der erhitzte sich ebenso schnell wie er erkaltete. Wir froren erbärmlich, an Schlaf war nicht zu denken.
Im Freien wäre es noch kälter gewesen, meinte Truppführer Müller. Wie beruhigend.
Am nächsten Morgen froren wir weiter. Zunächst auf einem Bahnsteig, dann im Abteil der Schmalspurbahn, das voll besetzt war von polnischen Landarbeiterinnen. Bevor die kleine Dampflok losprustete, mussten noch Säcke entladen werden, erst Zwiebeln, dann Kartoffeln. Das dauerte seine Zeit. Ab ostpreußischer Grenze ratterten wir durch endlose Waldgebiete, Dörfer waren nicht zu sehen. Endstation war Turosl.
„Koffer aufnehmen!“, befahl Truppführer Müller.
Und schon marschierten wir auf viel zu glatten Ledersohlen durch den Schnee. „Na hoffentlich nicht stundenlang!“, raunzte Lothar Heinich. Wir schusselten über verschneite Waldwege, eine Rutschbahn ohne Ende? Nein. Nach einem Ausdauer-Marsch sahen wir am Waldrand zwischen hohen Kiefern grün angestrichene Baracken. „Endlich!“
Auf den Wellblechdächern hatten sich Eiszapfen gebildet, die glitzerten und sich im Sonnenlicht brachen.
Truppführer Müller zeigte sich spürbar erleichtert:
„Vor uns liegt das Lager; Männer wir sind am Ziel!“
Barackenlager. Uniformen. Exerzierende Kolonnen. Kommandos: „Stillgestanden!“
Einer, der etwas zu sagen haben musste, rief uns zu:
„Die Neuen melden sich im Büro der Arbeitsverwaltung bei Feldmeister Maul!“
Dort rief ein Truppführer: „Nachzügler, Beeilung bitte!“
Einberufungsbefehle und Ausweispapiere abgeben. Formulare ausfüllen und raustreten. Nun das Kommando: "Neuankömmlinge Aufstellung nehmen, Marschordnung bilden, und ab in die Kleiderstube, Klamotten fassen!"
Gemeint waren Uniformen, Stiefel, Stahlhelme, Fußlappen, Unterwäsche, Käppis und blitzblanke Spaten zum Exerzieren.
Nach der Einkleidung ließ uns Abteilungsführer Oberstfeldmeister Hitzerodt in Reih und Glied antreten. Der Chef der Abteilung mochte noch keine vierzig Jahre alt sein, kam uns Achtzehnjährigen aber alt vor, uralt.
Hitzerodts schlanke Gestalt straffte sich unter der braunen Uniform. Mit brüchiger Raucherstimme verkündete er:
"Arbeitsmänner! Die Abteilung steht vor kriegswichtigen Einsätzen! Kameraden, von diesem Moment an werdet ihr die preußischen Tugenden in ihrer umfassenden Bedeutung erfüllen: Disziplin, Pflichttreue, Sparsamkeit und Bescheidenheit!
Der Dienst erfordert ein hohes Maß an Hingabebereitschaft und Selbstgenügsamkeit, fern von allen städtischen Unterhaltungsmöglichkeiten. Künftig habt ihr auf Bequemlichkeiten zu verzichten! Euch erwartet eine harte Grundausbildung bei menschlicher Behandlung! Wegtreten!"
Da die Neuen nach Körpergröße eingegliedert wurden, kam ich in den 1. Zug, unter das Kommando von Feldmeister Waldheim. Mein direkter Vorgesetzter war Haupttruppführer Gruber.
Feldmeister Schneider und Unterfeldmeister Hirsch befehligten den zweiten und dritten Zug. In Ermangelung hauptamtlichen Stammpersonals waren die Truppführer dort Obervormänner.
Während der ersten Woche litt ich stark unter Heimweh. Mich einzuleben in die Eintönigkeit einer reinen Männergesellschaft fiel mir schwer. Sich anzupasssen war einfacher, weil alle Stubenkameraden aufeinander angewiesen waren.
Herbert Debald hatte einen festen, ruhigen Blick und klassische, fast griechische Gesichtszüge. Ein wenig unbeholfen wirkte er, doch mit dem gewinnenden Lächeln gleich auf den ersten Blick sympathisch. Herbert kam aus Berlin.
Hans Knaubel aus Chemnitz, stämmig, robust, mit kurz rasiertem Haar, war raubeinig und kein Zauderer. Der bullige Typ gab vom ersten Moment den Ton an. Brüllende Ausbilder beeindruckten ihn nicht, er ertrug sie mit stoischer Ruhe.
Franz Winter mit dem fahlen Rauchergesicht stammte aus einem Dorf nahe Hannover und wirkte im Gespräch etwas gehemmt. In praktischen Dingen wusste er sehr gut Bescheid.
„Da macht mir keiner so leicht was vor.“
Hardy Blume, ein in sich gekehrter Hallenser, verhielt sich abwartend, ließ sich anfangs nicht einordnen. Hardys Welt war das Gedruckte. Seine Mutter schickte stapelweise Zeitungen, Magazine und Rätselhefte, alles, was zu bekommen war. Jede freie Minute beschäftigte er sich damit. Später verriet er: „Ich möchte Journalist werden, am liebsten in Halle!“Ich gab ihm den Spitznamen „Lektor“.
Joachim Dietrich sprach mit leicht berlinerischem Tonfall, wirkte etwas arrogant, zeigte sich betont zurückhaltend.
Volker Hagen, klein und schmächtig, trug das schwarze Haar kurz. Ein einsilbiger Kamerad, von Beruf Buchhalter, ein unbeschriebenes Blatt. Ach ja, er kam aus Halle.
Hans Pieper verhielt sich zu unterwürfig, nuschelte ein furchtbares Straßensächsisch, konnte sich mühelos damit allenfalls bei Landsleuten aus der Chemnitzer Gegend verständlich machen. Joachim nannte Piepers sächsisches Idiom „absolut übersetzungsbedürftig“.
„Versuch`s doch mal auf hochdeutsch!“, riet er spöttisch.
Pieper war als einziger der Abteilung im Besitz eines Führerscheins, wurde sofort Cheffahrer, blieb dadurch vom ersten Tag an weitgehend vom ordinären Ausbildungsdienst verschont.
Die Lagerordnung war streng. Insgesamt blieb wenig Freiraum; nahezu alles war vorgeschrieben. Die Ausbilder genossen ihre Macht. Punkt sechs Uhr trillerte die Pfeife des Diensthabenden, dann ertönte aus dem Lautsprecher die harte Stimme: „Abteilung aufstehen!“
Manche blinzelten noch verschlafen, andere wirkten hellwach, manche konnten schon witzig sein, andere waren noch müde. Nach ein paar Sekunden zwischen Erstaunen und Erinnerungen erkannte ich die Lage und wusste, wo ich mich befand: in einer Baracke beim Reichsarbeitsdienst.
Schon schreckte der lang gezogene Ruf „Kaffeeholer raustreten!“
Wettlauf mit der Zeit. Eiltempo ist angesagt. Raus aus der Stube. Vorbei an Pritschen und Hockern. Draußen: Schneegestöber. Mit der großen Blechkanne losrennen zur Küche. Schlangestehen und warten. Brote, Aufstrich und Ersatzkaffee in Empfang nehmen und im Eiltempo zurücklaufen. Die Hände klamm, die Ohren hellrot angelaufen - Reaktion des eiskalten Windes.
Aus dem Waschraum der Nebenbaracke schallten kräftige Männerstimmen, manchmal ertönte auch Gelächter.
Man nahm sich eine Blechschüssel und wusch sich mit eiskaltem Wasser.
„Haftbedingungen in Deutschland sind besser!“, vermutete Herbert Debald.
Der Bettenbau! Das heißt korrekt jedes Fältchen glatt ziehen. Dann blitzschnell mit dem Reisigbesen alle Ecken auskehren und auf den Befehl „Abteilung raustreten!“ pünktlich in Reih und Glied mit den Stubenkameraden zum Dienstbeginn antreten.
„Arbeitsmänner! Spaten über, Spaten ab!“
Die Ausbilder kannten keine Nachsicht. Haupttruppführer Gruber war der Schlimmste, wippte, wenn er jemanden erniedrigen konnte, genussvoll in den Knien, schwang mit dem Oberkörper immer wieder nach vorn, der Mann war gespannt wie ein Flitzbogen:
„Hinlegen, auf marsch, marsch, hinlegen!“
Jede Stunde strammstehen. Exerzieren bei eisiger Kälte.
„Spaten über!“ selbst wenn klamme Finger nicht mehr gehorchten. Der Haupttruppführer hatte uns fest im Griff.
Während der ersten vier Wochen durften wir uns nur im Laufschritt bewegen. Auch im Dunkeln, auch zum Donnerbalken. Der stand im Freien, war nur überdacht. Bei 20 Grad minus und eisigem Wind die Hosen runterzulassen, dazu gehörte Überwindung, das löste den totalen Kälteschock aus. Die Ohren pochten, dich überkam das große Klappern. Auf dem langen Baumstamm konnten nebeneinander gleichzeitig dreißig Mann hocken. Als Rückenlehnen dienten dünne Birkenhölzer, an denen sich Eiszapfen bildeten. Sie verhinderten gewagte Balanceakte und schützten vor Abstürzen in die Grube.
Die Temperaturen sorgten für Ungemach. Im Inneren der Baracken war es tagsüber ebenso kalt wie draußen. Und 15 Grad unter Null bedeuteten, dass wir Arbeitsmänner die Mäntel anbehalten durften, wenn wir mittags die Stuben betraten. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Geheizt wurde erst abends. Nachts fand sich immer jemand, der Holzscheite nachlegte.
„Frieren gehört zum Leben im Felde“, seufzte Joachim Dietrich.
Feldmeister Waldheim war etwas kurz geraten, bemerkenswert an ihm war sein federnder Gang. Waldheim wurde als verschlossener, ruhiger und gelassener Mensch beurteilt, der es genoss, Untergebene zu demütigen. Bevorzugte Opfer des Feldmeisters waren Abiturienten und kaufmännische Angestellte. Waldheim, der das Wort Abiturienten nicht korrekt aussprechen konnte oder wollte, begann seinen Dienst täglich mit dem Befehl: „Abturenten und Bürohengste flitzen rechts raus und sind in Windeseile auf dem Weg zur Latrine!“ Das hieß, sie würden dort putzen und Besenarbeit leisten. Immer dabei: Der angehende Jurastudent Joachim Dietrich. Denn er hatte sich zu weit vorgewagt und dem Feldmeister sein Motto erklärt.
„Sehen, urteilen, handeln!“
Waldheim hatte erbost geschrien:
„Sie Würstchen, über Ihr Handeln entscheiden hier andere!“
Auch tagsüber war es bitterkalt, stets blies ein eisiger Wind. Grundausbildung bedeutete knochenharten Drill vom ersten Tag an bis zum letzten.
Im Unterricht lernten wir, dass der Arbeitsdienst auf eine Idee zurückzuführen sei, die im Ersten Weltkrieg aufkam, sozusagen ein Kind der Front war und während der materiellen und geistigen Not der Nachkriegszeit in den zwanziger Jahren realisiert wurde. Ihr geistiger Antrieb sei gewesen, sich angesichts der bitteren Notlage nicht von Kleinmütigkeit und Resignation niederdrücken zu lassen, sondern vom Willen des Helfenwollens für die Gesamtheit beseelt zu sein.
Herbert Debald nahm mich mit seiner warmherzigen Ausstrahlung von Tag zu Tag mehr gefangen. Ein Mensch mit gütigen Augen. Feingliedrig und schlaksig, in Haltung und Gang völlig unmilitärisch, wirkte er wie ein verkleideter Zivilist.
Lothar Heinich blieb schwer einzuschätzen, undurchsichtig. Seine Augen verrieten allenfalls Gleichgültigkeit. Der Mann zeigte sich grundsätzlich uninteressiert, demonstrierte das durch ausdruckslose Blicke. Nein, die Gedanken und Gefühle von Lothars pausbäckigem, fast feistem Gesicht abzulesen, war unmöglich.
Kurt Friedrich kannte ich schon seit meiner Kindheit. Vier Jahre waren wir Klassenkameraden in der 54. Volksschule gewesen.
Nach Dienstende blieben uns ein paar Stunden für die Kantine. Sie befand sich in der gleichen Baracke wie die Schreibstube. In der daneben stehenden Führerbaracke wohnten alle hauptamtlichen Dienstgrade. Unterschiede zwischen Mittleren und Höheren Laufbahnen existierten dabei nicht.
Bis 21 Uhr durften die Abende in der Kantine verbracht werden. Der kleine Blechofen neben den langen Holztischen konnte den großen Raum nur mäßig erwärmen. Die Atmosphäre wirkte ernüchternd, Stimmung wollte nicht aufkommen. Nur nicht bei Knaubel anecken, der hier das große Wort führte. Sobald das Bier floss, mit zunehmendem Konsum, gewissermaßen von Pils zu Pils, stieg seine Unberechenbarkeit. Knaubel zu widersprechen wollte gut überlegt werden, der Mann geriet in Wut, verlor schnell die Beherrschung, wurde gefährlich. Ein Kamerad, der ihn Arschloch genannt hatte, bezahlte das mit einer Schädelprellung, Platzwunden am Auge und Blutergüssen im Gesicht.
„Lass dich auf keine Diskussionen mit ihm ein, geh Rangeleien aus dem Weg!“, riet mir Hardy.
Doch der Vorfall tat Knaubels Beliebtheit bei den Vorgesetzten keinen Abbruch. Sie schätzten sein Durchsetzungsvermögen und erkannten darin Führungseigenschaften.
In der Kantine erfuhr man etwas über Vorgesetzte und den Dienstbetrieb. Die Beurteilungen fielen - je nach Alkoholquantum - sehr unterschiedlich aus. Einige Truppführer wären genüssliche Knochenschinder. Namen wurden nicht genannt.
„Was sagt ihr zum Chef und den höheren Rängen?“
„Opa Hitzerodt ist prima, lässt nichts auf seine Leute kommen!“
Feldmeister Schneider tritt zackig auf und droht ganz schnell Bestrafungen an. Unterfeldmeister Hirsch ist maßlos arrogant. Feldmeister Waldheim gibt sich leutselig und macht gern Späße auf Kosten seiner Untergebenen. Über ihn gingen die Meinungen auseinander. Unnahbar für die meisten, war er für andere ein netter Kerl. Jemand verstieg sich zu der Feststellung, der Feldmeister sei schwul. Einigkeit herrschte über Haupttruppführer Gruber. Berühmt wären seine Brüllorgien, in denen vorzugsweise die Vokabeln „Arschlöcher“ und „gequirlte Scheiße“ vorkämen. Dem Wiener ging man besser aus dem Wege, hieß es allgemein. Für uns unmöglich, denn wir hatten den Österreicher täglich vor der Nase. Gruber war unser direkter Vorgesetzter.
„Ein widerlicher Mensch“, kommentierte das Herbert.
Truppführer Specht erzähle gern Witze, sei humorvoll und beliebt. Leider hatten wir nichts mit ihm zu tun.
Im Unterricht mussten zuerst die Dienstgrade gelernt werden: „Dietrich, die Dienstgrade, schießen Sie los!“
Joachim schnellte hoch:
„Arbeitsmann. Untere Führer: Vormann, Obervormann, Truppführer, Obertruppführer, Haupttruppführer, Unterfeldmeister.“
„Die Rangfolge der Mittleren Führer?“
„Feldmeister, Oberfeldmeister und Oberstfeldmeister entsprechen den Offiziersrängen der Wehrmacht: Leutnant, Oberleutnant, Hauptmann!“
„Gut, Dietrich, setzen!“
Franz Winter erkannte meine Hilflosigkeit sofort, hatte immer ein Herz für mich. Das begann, als ich an meinen Stiefeln herumfummelte. Franz zeigte mir, wie sich Hochglanz erzeugen ließ. Machte mir vor, wie Fußlappen zu wickeln sind.
„Pass auf und mach das lieber zweimal, sonst läufst du dir Blasen.“
Franz, mein guter Geist, war immer für mich da und rechtzeitig zur Stelle.
„Deine Mutter hat dich zu sehr verwöhnt, dir womöglich noch die Schuhe geputzt“, staunte er, „das kann doch nicht wahr sein.“
„Stimmt, meine Mutter tat alles für mich!“
Franz nickte genervt. Er war bis zur Aufopferung eine Seele von Mensch. Putzte sorgfältig, beinahe hingebungsvoll meine Stiefel. Tag für Tag.
„Spinde gibt es nicht. Vor jedem Bett steht ein Hocker. Auf den müssen alle Sachen genau nach Vorschrift gebaut werden.“
Franz zeigte mir, wie Uniformmantel, Jacke, Hose, Unterwäsche und Käppi kunstvoll auf eine winzige Fläche drapiert werden mussten. Vom Koppel umringt, das Schloss erkennbar nach vorn.
„Die Stiefel kommen unter den Stuhl, Spitzen zeigen Richtung Gangmitte!“ Franz bewahrte mich vor Bestrafungen. Dafür überließ ich ihm einen Teil meiner Zigaretten. Als einen Versuch, mich regelmäßig zu revanchieren und dankbar zu erweisen.
In abwechselnder Reihenfolge war jeder Arbeitsmann eine Woche lang verantwortlich für die Sauberkeit der Unterkunft. Auch für die Heizung. Eine gefürchtete Zeit, die für manchen zum Albtraum wurde. Mein Stubendienst fiel in die zweite Ausbildungswoche. Für den kleinen eisernen Ofen musste Holz gehackt werden. Franz sah, wie ich mich abmühte.
„Sieht so aus, als habest du noch nie ein Beil in die Hand genommen?“
„Stimmt!“
„Na dann gib mal her!“
Anfang März meldete ich mich krank. Der Truppenarzt diagnostizierte eine Stirnhöhlenvereiterung.
„Sie fahren morgen nach Allenstein“, verkündete er, „im Lazarett kann nach gründlicher Untersuchung eine exaktere Diagnose gestellt werden.“
Fahrgäste waren nicht vorgesehen, der Zug transportierte Kohle. Brav und stumm saß ich acht Stunden lang neben dem Lokführer.
Endlich das verdunkelte Allenstein.
Die mir vorgeschriebene Pension befand sich in Bahnhofsnähe. Zu meinem Leidwesen befand sich in ihr kein einziges weibliches Wesen, nur Männer, nur Soldaten, nichts als Soldaten. Aber ich schlief in einem richtigen weichen Bett wie zu Hause und genoss das sehr.
Die Straßenbahn war überfüllt, das Lazarett zwei Haltestellen entfernt. In den Korridoren roch es nach Chloroform, intensiv. Das Wartezimmer war gefliest, ein paar weiße Kittel hingen schlapp am Haken. Ich saß drei Stunden ab, wurde untersucht und wie erwartet punktiert. Der HNO-Arzt war sehr nett zu mir:
„Bleiben Sie mal heute noch in Allenstein“ sagte er freundlich lächelnd. Abwechslung bieten Kinos. Ich verschreibe Ihnen zwei Wochen Schonung. Bericht und Tabletten bekommen Sie gleich mit!"
„Danke, Herr Assistenzarzt!“
*
Vor der Führerbaracke ging das Attest von Hand zu Hand. Haupttruppführer Gruber las es besonders aufmerksam.
„Kleine, Sie brauchen zur Unterstützung Ihrer Genesung Erholung?“, fragte er ironisch. „Kein Problem, für zwei Wochen mache ich Sie zum Postholer“, fügte er gönnerhaft hinzu.
Tatsächlich schob ich nun eine ruhige Kugel. Weil der Zug zur Poststelle nur früh und abends fuhr, saß ich tagsüber in einem polnischen Bauerndorf mit löchrigen Straßen, einer Kneipe, einer Bäckerei, zwei Kramerläden und der - gemessen an der Einwohnerzahl - viel zu großen Kirche. In Polen schien jede armselige Ortschaft zu wetteifern, eine noch pompösere Kirche zu bauen als die Nachbargemeinde. Schwer zu verstehen, weswegen katholische Gotteshäuser in Polen so riesige Ausmaße haben mussten.
Innerhalb von 24 Stunden verkehrten auf dieser Strecke nur zwei Züge. Einer brachte mich 6 Uhr hin, der andere nahm mich, mit einem oder zwei Säcken Abteilungspost, um 18 Uhr wieder zurück.
In den Stunden dazwischen galt es die Zeit totzuschlagen. Hitze und Langeweile waren oft unerträglich. Stundenlang hockte ich im Wirtshaus, durchstreifte Feldwege, lief auf Schotter vorbei an Häusern in einfacher Bauweise aus Lehm und Holz. Gehöfte ehemaliger Großbauern waren massive Stein- und Ziegelbauten.
Die meiste Zeit verbrachte ich auf dem Dorfplatz. Hohe Bäume spendeten Schatten, und von den Bänken vor dem Dorfteich bot der Blick auf die Kirche ein schönes Bild der Ruhe.
In dem Kaff vorsichtig umzugehen mit schönen Jüdinnen, die ein furchtbares Kauderwelsch sprächen, war mir mit auf den Weg gegeben worden. Und wirklich. Attraktive Mädchen waren die einzige Abwechslung, die das Dorf zu bieten hatte. Während der stundenlangen Wartezeit war es anfangs unmöglich, ein paar Worte mit ihnen zu wechseln. Scheu huschten sie an mir vorbei. Da ich früh ankam und spät abgeholt wurde, ergo den ganzen Tag im Dorf verbrachte, ohne etwas zu tun, hielt man mich für „ganz und gar meschugge“, für verrückt.
Dabei war mir ihre Sprache von den Pelzhändlern am Leipziger Brühl seit meiner Kindheit bekannt. Die Dorfbewohner sprachen jiddisch. Nach und nach fassten einige der Mädchen ein wenig Zutrauen, aber nur zwei ließen sich ansprechen und blieben für ein paar Minuten bei mir stehen.
Ende Januar kamen Gerüchte über eine Rückverlegung der Abteilung nach Deutschland auf. Das Lager würde nach Abschluss der Grundausbildung aufgelöst.
Am 31. kam der Befehl zum Packen. Über Nacht war Neuschnee gefallen. Befehle waren nur selten vorher so diensteifrig, so fröhlich befolgt worden:
„Geräte abgeben, Koffer mit Zivilsachen in Empfang nehmen!“
„Wurde Zeit, dass wir hier wegkommen!“, krähte ein Arbeitsmann.
„Weg, nur weg hier, raus aus der Scheiße, den Kasernenhofdrill habe ich langmütig ertragen“, rief ein anderer.
„Ausbildung besteht in erster Linie aus Knochenarbeit. Das ist ganz normal“, rief Knaubel und verzog sein kantiges Gesicht.
Punkt 10 Uhr war es dann endlich so weit.
„Abteilung mit Marschgepäck antreten! Abteilung, marsch!“
Aber wohin?
Ein letzter Blick auf die Baracken, auf das Nachkommando, das noch für ein paar Tage für Aufräumungs- und Verladearbeiten zurückbleiben musste.
Die Verladestation erreichten wir nach knapp drei Stunden über tief verschneite Waldwege. Die letzte halbe Stunde auf freier Ebene. Bei klirrender Kälte wütete ein Schneesturm so heftig, dass der Vordermann kaum zu erkennen war. Und 20 Kilo Marschgepäck drückten auf den Schultern.
Im Sonderzug lösten die geheizten Zugabteile Jubel aus.
„Jungs, hier ist es gemütlich wie bei Muttern“, rief Winter begeistert. Debald klopfte sich erleichtert den Schnee ab:
„Kameraden, ab jetzt kann alles nur besser werden!“
„Wohin fahren wir?“, fragte Joachim Dietrich.
„Nach Paris, na was denkst du denn, das ist klar!“, rief jemand.
„Quatsch, nach Schlesien! Das Stammlager unsrer Abteilung befindet sich in Pritisch bei Landsberg an der Warthe“, mischte sich Unterfeldmeister Hirsch ein, ausgesprochen ungnädig.
Die angenehmen Stunden einer langen Reise verstrichen viel zu schnell.
*
In Pritisch bedeckte Raureif die Bäume, eine winterliche Landschaft strömte Ruhe aus. Ruhe und Frieden. Die großen Bauerngehöfte lagen außerhalb des Ortes. Wir entdeckten ein hübsches schlesisches Dorf mit einem schönen Marktplatz und sauberen Straßen. Über stiefelknallendes Kopfsteinpflaster marschierten wir an Häusern einfacher Bauart vorbei zum RAD-Stammlager, das sich am Ortsrand befand. Eine Umzäunung ließ darauf schließen, dass hier keine Zivilisten wohnten. Das Lager bestand aus Baracken, wie wir sie kannten. Die übliche Anordnung wies auf Kasernierung hin. Auf dem mit Schnee bedeckten Exerzierplatz wiesen der Fahnenmast und eine Eskaladierwand auf die bevorstehende soldatische Ausbildung hin, die uns erwartete.
Jeder Zug verfügte über eigene, gut ausgestattete Aufenthalts- und Schlafräume. Die sauberen Truppstuben lösten Freude aus. Nach dem primitiven Barackenleben in Polen erwarteten uns hier hygienische Verhältnisse zum Genießen.
„Mensch, Werner, guck mal, weiß gekachelte Wasch- und Toilettenräume!“, staunte Hardy. Alle waren begeistert.
Oberstfeldmeister Hitzerodt ließ die Abteilung antreten, um mit heiserer Stimme zu verkünden:
„Arbeitsmänner, die Ausbildung an der Waffe dient der Erziehung zum selbstbewussten einsatzbereiten Menschen. Beschimpfungen durch Vorgesetzte, die euer Anstands- und Ehrgefühl verletzen, haben zu unterbleiben, werden nicht geduldet, sind mir notfalls beschwerderechtlich zu melden. Arbeitsmänner! Ich erwarte militärische Disziplin!“
Exerzieren war uns schon in Polen eingetrichtert worden, hinzu kamen Waffenunterricht, Ausbildung am Karabiner 98 k, LMG (leichten Maschinengewehr), Schießübungen und Handgranatenwurf.
Auch in Pritisch begann nun trotz eisiger Kälte jeder Tag mit dem Befehlsgeschrei: „Raustreten zum Frühsport!“ Feldmeister Waldheim versuchte das poetisch zu formulieren:
„Die Übungen vor Dienstbeginn sollen euch ermuntern, Frische geben und Schwung für das Tagwerk verleihen!“
Die Abteilung
Nach fünfzehnminütigem Laufen und anschließender Gymnastik zurück in die Baracken, im Eiltempo umkleiden, warten, bis eine helle Kommandostimme befiehlt:
„Abteilung raustreten!“
Exerzieren. Wir kannten das. Es lief hier so ab wie im Waldgebiet von Turosl. Hinzu kam, dass Vorgesetzte wie Feldmeister Waldheim und Haupttruppführer Gruber ihre Macken zeigten. Sonderbare Verhaltensweisen, deren Motive sich nicht ergründen ließen.
Vor dem Frühstück fragte Gruber: „Zähne geputzt? Strahlend weiße Zahnreihen möchte ich sehen!“
„Jawohl, Haupttruppführer!“
Vor dem Mittagsessen hieß es: „Fingernagel-Appell! Handrücken vorstrecken! Ich sehe mir jetzt eure Fingernägel an, und wehe, wenn ich Schmutzränder bemerke!“
Feldmeister Waldheim tauchte verdächtig oft in den Duschräumen auf. „Um die Abhärtung mit kaltem Wasser zu kontrollieren.“ Angeblich.
„Der ist schwul“, glaubte Herbert.
Werner Kleine mit Spaten
Die Nachmittage gehörten dem Sport. Feste Bestandteile der Ausbildung waren Hindernisläufe als Mut- und Gewandtheitsübungen, Laufwettbewerbe, Handgranatenweitwurf und Boxkämpfe.
Für eine Grundausbildung im Boxen war das Notwendige vorhanden:
Ein Boxring und Trainings- und Geräteräume, in denen Sandsäcke und Punchingbälle hingen. Hardy war Rechtsausleger. Wir verbrachten so manche Stunde im Boxring.
Oberstfeldmeister Hitzerodt war Reichsarbeitsdienstführer mit Leib und Seele. Das kam bei seinen wöchentlichen Unterrichtsstunden klar zum Ausdruck. Begeistert berichtete er uns:
„Bereits während es Feldzuges in Polen wurden einige hundert RAD-Abteilungen in Ostpreußen als Baueinheiten an der Front eingesetzt, darunter leicht motorisierte Straßenbaubataillone, die zusammen mit motorisierten Einheiten der kämpfenden Truppe zum Einsatz kamen.“
Der Abteilungschef straffte seinen Oberkörper:
„Jeder Deutsche ist aufgerufen zu Gehorsam, Wehrhaftigkeit und Nationalstolz!“ Hochgestimmt fügte er hinzu: „Wir Deutsche werden kämpfen bis zum letzten Hauch! Kämpfen und siegen!“
Herbert Debald - wie immer in der hintersten Sitzreihe - hob gequält die Augenbrauen und flüsterte: „Mein Gott, der faselt schon wieder vom Sieg.“
Arbeitsmänner mit Agrarkenntnissen wurden in die Landwirtschaft abgestellt, um ortsansässigen Bauern Hilfe zu leisten. Auf unseren Trupp traf das nicht zu.
Den Impfungen konnte sich niemand entziehen. Anschließend sollten wir „preußisches Männertum“ eingeimpft bekommen. Die Ausbilder machten sich einen Spaß daraus, uns über die Eskaladierwand zu jagen:
„Hoch mit euch und schnell drüber, ihr lahmen Enten, damit sich der Impfstoff gleichmäßig im Körper verteilt!“, höhnte Feldmeister Waldheim.
Regelmäßig folgte den Impfungen ein Marsch über zehn Kilometer.
„Ein Lied!“, schrie Truppführer Specht, „wir singen die dunkle Nacht!“
„Zwei, drei!“, befahl Waldheim. „Die dunkle Nacht ist nun vorbei, und herrlich beginnt es zu tagen, Kamerad wach auf, die Arbeit macht frei, frischauf, wir wollen es wagen. Braun wie die Erde ist unser Kleid, braune Soldaten in kampfschwerer Zeit!“
Während der Gewaltmärsche dachte ich oft an Ursula Hoyer. Ich war unglücklich. Meine erste Liebe hatte sich nicht erfüllt. Zum Abschied hatte ich ihr 21 rote Rosen geschickt. Eine für jedes Lebensjahr. Sie reagierte nicht. Jähes Erwachen aus erotischen Tagträumen.
Feldmeister Schneider wies im Unterricht auf die Unterschiede zur Wehrmacht hin:
„Im Reichsarbeitsdienst gibt es keine Strafbataillone. In der Dienststrafordnung ist nicht nur ein Strafrecht, sondern auch eine Beschwerdepflicht verankert. Es gibt keine Anrede mit 'Herr'. Der Untergebene redet den Vorgesetzten einfach mit dem Dienstgrad an. Bedenken Sie, dass bei der Wehrmacht die Anrede in der 3. Person Vorschrift ist.“
Ausgang gab es nur sonnabends und sonntags. Leider. An Bastelabenden innerhalb des Barackenlagers nahm ich nicht teil. Mein Interesse galt Musikdarbietungen, auch politischen Vorträgen.
Im Reichsarbeitsdienst war Freizeit gleichzusetzen mit Sport. Angeboten wurden Lehrgänge für Rettungsschwimmen. Unterricht über die Grundschule des Boxens. Es gab Fußballspiele, Leichtathletik- und Turnwettkämpfe.
Ich war überall mit dabei. Geboxt hatte ich in einer Betriebskampfstaffel. Mehrfach. Nach einem Nierenschlag allerdings auch mit anschließendem Aufenthalt im Leipziger Elisabeth-Krankenhaus.
Für Herbert waren die Monate im Reichsarbeitsdienst „die schlimmste Zeit meines Lebens“. Seine Unsportlichkeit machte ihn zum Gespött der Ausbilder. Der arme Kerl traf keinen Ball, war bei Laufwettbewerben fast zwangsläufig Letzter. Die Strapazen machten ihn fertig. Er zählte die Stunden, litt körperliche und seelische Qualen.
Feldmeister Waldheim riet ihm, ein etwa vorhandenes Gefühl körperlicher Minderwertigkeit zu überwinden und keinen Tag vorübergehen zu lassen, ohne an sich zu arbeiten.
„Debald, das bringt Erfolg!“
„Meine Freude am Leben ist schwarz, allenfalls noch grau! Exerzieren, strammstehen, täglich nichts anderes!“, stöhnte er.
Ich versuchte zu trösten: „Am 30.Juni ist unsre Zeit vorbei!“
Herbert schüttelte zweifelnd den Kopf.
„Wer weiß, was bis dahin noch passiert!“
Die Rückkehr der RAD-Abteilung verhalf einem Lebensmittelladen und vier Kneipen zu höheren Umsätzen. Andererseits bot Pritisch seinen Arbeitsdienstmännern nur wenig Abwechslung.
„Hier ist der Hund verreckt“, mokierte sich Hardy.
Joachim pflichtete ihm bei: „Nix los in dem Kaff!“
Das kleine Kaffeehaus mit schlechter Aussicht - man blickte auf die Gleisanlagen des Bahnhofs - war ständig überfüllt. Wurde die Tür geöffnet, löste sich eine Warteschlange auf.
An Wochenenden wurden die Stühle im Nu von Arbeitsmännern gestürmt. Einige Dorfschönheiten fanden sich mit den ersten Besuchern ein, alle festlich gekleidet in gedeckte Farben. An den kleinen runden Tischen hockten sie eng zusammengerückt, verspeisten Torte oder löffelten in ihren Eisbechern herum. Winkte man ihnen zu, löste das verlegenes Kichern aus.
Doch der Jungmädchencharme wirkte magnetisch, man konnte sich ihm nicht entziehen.
„In Berlin sind die Mädchen nicht so albern“, behauptete Joachim.
„Auch Hallenserinnen sind abgeklärter“, pflichtete Hardy ihm bei.
Von Landsberg bekam ich, abgesehen vom kleinen Café, kaum mehr zu sehen als das Wartezimmer und den Behandlungsraum des Hals-Nasen-Ohren-Arztes. Der glatzköpfige ältere Herr untersuchte mich gründlich.
„Punktieren halte ich für überflüssig“, sagte er freundlich, tauchte zwei mit Watte umwickelte Stäbchen in eine Flüssigkeit und steckte sie in meine Nasenlöcher.
„Das machen wir zehn Minuten und morgen noch mal. Dazu verschreibe ich Tropfen, dann müssten Sie schmerzfrei sein. Der Dienst härtet ab. Erkältungen treten nicht mehr auf. Ihre Beschwerden verschwinden automatisch.“ Ich verabschiedete mich erleichtert.
Hans Knaubel, mit herrischem Auftreten und athletischem Körperbau zum Befehlen geboren, wurde folgerichtig nach Abschluss der Grundausbildung zum Vormann befördert.
Schlusspunkt unserer Ausbildung war eine Abschiedsfeier im Gasthof, zu dem der Bauernverband eingeladen hatte. Der Bürgermeister erklärte:
„Diese kleine Feier soll ein besonderer Höhepunkt werden, ein 'Dorfgemeinschaftsabend', beidem sich Alt und Jung zu froher Stunde zusammenfindet, um das Band zwischen den Bewohnern von Pritisch und den Männern des Reichsarbeitsdienstes fester zu knüpfen.“
Es folgte der Dank des örtlichen Bauernführers für die landwirtschaftlichen Hilfeleistungen während der vergangenen Wochen. Ein Chor des Bundes Deutscher Mädchen (BDM) intonierte deutsches Liedgut.
Später, zu Bier und Würstchen, spielte der Dorflehrer auf einem Schifferklavier den Schlager „Rosamunde, schenk mir dein Herz und dein Ja!“
„Wie gut, dass Tanzverbot herrscht“, meinte Joachim, „hier hätte man heute die Qual der Wahl.“
„Eine Damen-Qual.“
Lothar Heinich war etwas ganz Besonderes, ein achtzehnjähriger Ehemann mit Kind. Dass seine Frau zum Abschied aus Leipzig kommen durfte, erregte Besuchsneid.
Auf der Bildfläche erschien eine blutjunge attraktive Frau, die alle Blicke auf sich zog. Blondes, offen getragenes langes Haar, tiefer Ausschnitt, kurzer Rock, gut geformte Beine - wer so aufgemacht vor kasernierte Soldaten tritt, wirkt aufreizend und erzielt ungeteilte Aufmerksamkeit.
Aus unserm Trupp gehörte Volker Hagen zu den Glückspilzen, die zur Bewachung des Lagers in Pritisch zurückbleiben durften, bis zum Ende ihrer Dienstzeit.
Barackenlager Pipinowo
Bahnhof Pritisch. 30. März 1941: Die RAD-Abteilung verlud vor zahlreichen Schaulustigen zehn Baracken und 250 Fahrräder in unüberdachte Waggons. Anschließend hängten Bahnbeamte fünf Güterwagen für den Transport der Mannschaften an.
„Wollen die uns etwa in Viehwagen verfrachten?“, fragte Herbert ungläubig.
„Siehste doch“, knurrte Knaubel, „Mann, hab dich nicht so!“
Ich tastete mich durch das Zwielicht und suchte mir auf dem mit Stroh bedeckten Boden einen Platz in der Mitte. Matratzen, die wir erwartet hatten, gab es keine, genauso wenig Decken. Vor einem winzigen eisernen Öfchen lagerten Holzscheite. Der Rauch wurde durch ein schmales Ofenrohr durch eine Fensterluke ins Freie abgeleitet. Luft und Licht strömten ausgiebig durch die geöffnete Schiebetür.
Der Güterzug traf, eingerechnet der Standzeiten, zwanzig Stunden später in Ostrolenka ein. Nachdem die Baracken in Einzelteilen auf LKWs verladen worden waren, bekam jeder Arbeitsmann ein Fahrrad ausgehändigt.
„Zum Zielort sind es ungefähr hundert Kilometer!“, erklärte Haupttruppführer Gruber.
„Auf geht's, Männer, gute Fahrt!“
100 Kilometer Fahrradtour mit Marschgepäck, Gasmaske und umgehängtem Gewehr. Irgendwo in den riesigen Wäldern geriet ich unter die Nachzügler, blieb liegen und gab auf. Nach angemessener Wartezeit von einem Lkw aufgelesen, traf ich verspätet – und mit spöttischem Hallo begrüßt - bei meinen Kameraden ein.
Unsre Abteilung kampierte auf einer Lichtung. Die Gegend war dicht mit Nadelwald bewachsen. Leichter Harzgeruch lag in der Luft.
„Lastwagen entladen, Zelte aufbauen, Decken verteilen, Beeilung, Beeilung!“, bellte Haupttruppführer Gruber.
„Handwerker vortreten!“, schrie Truppführer Specht, „Baracken abladen und an den vorgesehenen Stellen zusammensetzen und aufbauen!“
Zwei Nächte schliefen wir in Zelten auf eiskaltem Boden, dann - innerhalb von 60 Stunden - war der Barackenaufbau vollendet.
Aufbau der Baracken
Zur Einweihung war die Abteilung vollzählig angetreten: „Oberstfeldmeister, ich melde Ihnen, die Aufstellung des Barackenlagers ist komplett!“ Feldmeister Schneider klappte schwungvoll die Hacken zusammen.
„Danke“, antwortete der Chef knapp, schob noch ein lobendes „gut gemacht!“ nach.
„Jawohl, Oberstfeldmeister!“
„Unser Dorf ist die Verwandlung der Unterkünfte in einen militärischen Stützpunkt“, rief Hitzerodt fröhlich, „und ich habe auch schon einen Namen dafür gefunden: Pipinowo.“
Lothar Heinich beeindruckte die Abteilungsführung durch sein ungewöhnliches Organisationstalent. Aus den umliegenden Dörfern beschaffte er massenhaft Eier. Bald folgten Hühner, Ziegen und Schafe. Wie er das machte, blieb sein Geheimnis. Auf diese Weise avancierte Lothar schnell zur rechten Hand des Küchenchefs. Auch die Verpflegungsbullen erkannten sein Talent.
Ausgenommen Obertruppführer Hansen, der als trinkfestes Arbeitstier galt, ließ sich beim Frühappell kein höherer Dienstgrad mehr sehen. Feldmeister, Unterfeldmeister und Obertruppführer blieben tagelang von der Bildfläche verschwunden.
Es wurde heftig gelästert: „Die meisten von denen sind immer unterwegs, die schieben sich gegenseitig Heimaturlaub zu.“
Höhere Dienstgrade, die dienstlich in Pipinowo bleiben mussten, trösteten sich mit Alkohol. Nächtliche Gelage häuften sich. Das Gegröle, Gerülpse und Gelächter aus der Führerbaracke war noch im letzten Winkel des Lagers zu hören, schlafraubend und unerträglich.
Für den gemeinen Arbeitsmann wurde Eierlikör angeboten. Immer häufiger kam es zu Besäufnissen. Gleichzeitig wurde die Verpflegung rationiert. Weil das Schlitzohr Lothar Heinich Luxusgüter und Alkoholika höheren Vorgesetzten zuschob und Tauschgeschäfte mit polnischen Bauern machte. Heinich wurde zum Vormann befördert und übernahm die Bewirtschaftung der Kantine. Kein Wunder.
Angefangen beim APL-Truppführer bis zu den einfachen Arbeitsdienstmännern hinunter lebten alle überwiegend nur noch von Brot, Kunsthonig, Heidelbeeren und Ersatzkaffee.
Herbert Debald hatte inzwischen seine Kontakte zum Verpflegungs-Unterfeldmeister vertieft und durfte immer öfter als Küchenhilfe einspringen.
„Lohn meiner Überlebensstrategie, nur so kann ich dem sturen Dienstbetrieb samt blöden Vorgesetzten für ein paar Stunden entkommen“, vertraute er mir an. „Ich bin erleichtert, Werner, irgendwie muss ich über die Runden kommen!“
Herbert war ein sympathischer Mensch, einer zum Gernhaben. Er war stolz auf seinen Studienplatz an der Theaterhochschule Berlin und wollte Schauspieler werden, wie sein prominenter Onkel Ralf Arthur Roberts.
Herbert besaß eine Kostbarkeit, ein winziges Kofferradio. Nachts schirmten wir uns ab; kontrollierten, ob die Kameraden schliefen und hörten dann Radio London. Dieses nächtliche Geheimnis verband uns eng.
Ende Mai bekam Lothar Heinich Urlaub. Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: „Das ist der Lohn für seine Schiebereien“, ärgerte sich Hardy. Obertruppführer Grubers sachliche Begründung lautete anders:
„Verheirateten steht Heimaturlaub zu!“
Fünf Wochen später sahen wir ihn wieder, den Lothar Heinich. Als Arrestanten. Degradiert und verurteilt zu vierwöchiger Strafe wegen Überschreitung gewährter Urlaubszeit. Manchmal, wenn ich mich unbeobachtet fühlte, suchte ich seine Zelle auf und steckte ihm Zigaretten zu und ein paar Tafeln Schokolade.
Zwischen den Wäldern und auf den Wiesen um Pipinowo blühten die Heidelbeeren kilometerweit. Nie wieder habe ich sie in dieser Dichte und Größe gesehen. Wir haben sie heftig besungen:
Was gibt es heut zum Abendbrot? Heidelbeeren!
Doch Gewohnheit ist das Ende alles Schönen.
Das Leben in Pipinowo war eine einzige Schinderei. Tag und Nacht, auch an Sonn- und Feiertagen kamen Eisenbahnzüge, die sofort entladen werden mussten. Nächtliche Albträume von schwerer Arbeit auf Schmalspurgleisen. Vom Warten auf Züge mit Munition und 200-Liter-Benzinfässern. Dickleibige Panzergranaten kamen im Abstand von 4 bis 6 Stunden: Tag und Nacht, das hieß: In Uniform schlafen und auf die Dampfpfiffe stampfender Lokomotiven warten. Aufstehen. Antreten zur Kuliarbeit. Arbeitsreihen bilden. Benzinfässer abladen und auf geschälten Baumstämmen in die Wälder rollen. 20-Liter-Kanister, Granaten oder Munitionskästen in den Wald schleppen, aufstapeln und mit Zweigen gegen Flugbeobachtung tarnen.
„Wir schuften hier wie chinesische Kulis!“, fluchte Winter.
Hans Zobel stammte aus Halle (Saale). Als Arbeiter einer Zuckerfabrik schulterte er Zweizentnersäcke so locker wie Gewehrkolben. Das machte ihm nichts aus. Der hünenhafte Kerl war ein guter Kamerad, einer der mir half, der einsprang, bevor ich zusammenbrach.
Ab Mai mussten Schützengräben ausgehoben werden. Die Tagesleistung wurde vorgegeben; sie richtete sich nach der Beschaffenheit des Bodens. Dass ich mein Pensum täglich erfüllte, verdankte ich allein der Hilfe meines Kameraden Hans Zobel.
Um der schweren körperlichen Arbeit zu entgehen, gab es nur eine Möglichkeit: Ich musste befördert werden. Als Vormann wurde man zu einer Aufsicht führenden Person, brauchte weder zu schleppen noch zu schippen.
„Unterfeldmeister Hirsch sucht Schachpartner, wäre das was für Sie?“, fragte Obertruppführer Gruber. Ich witterte eine Chance und meldete mich sofort.
Mein Vetter Heinz Wolf, dem Spiel von Kindesbeinen an leidenschaftlich verfallen - sein Leben wurde später von Schachfiguren dominiert - , hatte mir, dem mittelmäßigen Spieler, ein paar knifflige Eröffnungen beigebracht. Auf die wollte ich nun setzen.
Gegen Hirsch zu gewinnen war weder einfach noch anfangs geplant. Über das Schachspiel, wenn man sich stundenlang gegenüber sitzt, vertiefen sich persönliche Kontakte. Man spricht dann schon mal über sein Privatleben. Nach verlorenen Partien schlug ich knallend die Hacken zusammen und gratulierte: „Glückwunsch zum Sieg, Unterfeldmeister!“ Mein zackiges Auftreten imponierte ihm. Sein Interesse an mir wuchs. Nach zwei Wochen schlug er mich zur Beförderung vor. Am 10. Mai wurde ich Vormann.
Tags darauf, ich wollte in der Schreibstube meine neuen Rangabzeichen abholen, war das schwarze Brett von Kameraden umlagert. Ein mit Reißzwecken befestigter Aushang enthielt den Satz:
„Rudolf Heß, der Stellvertreter des Führers, ist am 10. Mai 1941 im Zustand geistiger Verwirrung nach Schottland geflogen und dort gefangengesetzt worden.“
Werner Kleine mit Stahlhelm und Gewehr
Mein Leben veränderte sich in angenehmer Weise. Nun musste ich nicht mehr Lasten schleppen, durfte meine wie Kulis schuftenden Kameraden beaufsichtigen, sollte aufpassen, dass die Zeitvorgaben erfüllt wurden. Beim Exerzieren stand ich nun nicht mehr in Reih und Glied, sondern vor den Kameraden und gab Befehle.
Zu meinen Aufgaben gehörte die Portionierung der abendlichen Lebensmittelrationen. Das wurde zum ständigen Ärgernis, weil für Verpflegung Verantwortliche die Lebensmittel und Marketenderware weitgehend unter sich aufteilten und sich durch Tausch von Lebensmitteln bereicherten. Auch Nahrungsmittel und Alkohol gegen Sex, behaupteten böse Zungen. Nachts wären in der Führerbaracke polnische Mädchen gesehen worden. Plötzlich aufgetaucht.
Angeblich.
Für uns gab es nach wie vor hauptsächlich Margarine und Kunsthonig. Seltener Eier, die nach oft stundenlangen Fußmärschen in polnischen Dörfern requiriert wurden. Kommissbrote mussten von Wehrmachtsangehörigen erbettelt oder gegen Zigaretten getauscht werden.
Viele Kameraden murrten nur, andere überlegten, etwas gegen die Abteilungsführung zu unternehmen. Doch die meisten dachten wie der Berliner Radke: „Ick sag nischt. Ick halt mir da raus.“
Nach oben schien aber doch etwas durchgesickert zu sein.
Am 15. Juni bekam die Abteilung einen neuen Chef. Auf den ersten Blick wirkte er sympathisch.
„Ich bin der Oberstfeldmeister Eduard Reiche“, stellte er sich vor, „Nachfolger ihres bisherigen Abteilungschefs, der für höhere Aufgaben abberufen wurde.“
Oberstfeldmeister Hitzerodt trat neben ihn, reckte sich, lächelte gequält, hob das Haupt und schob das Kinn vor, als empfinge er eine Ehrenurkunde.
Mit „Dank und Anerkennung für seine hervorragende Leistung“ verabschiedet, durfte er davon ausgehen, dass ihm keiner seiner Arbeitsmänner eine Träne nachweinen würde.
Zwei Wochen später quittierte Oberstfeldmeister Reiche Joachim Dietrichs Hinweis, das Essen sei jetzt reichhaltiger und die Portionen größer geworden, mit abweisender Miene: „Das bilden Sie sich gewiss nur ein.“
Keine drei Wochen später funktionierten die alten Seilschaften wieder an Reiche vorbei, und wir mussten uns damit abfinden.
Der Arbeitsmann Karl-Otto Hennig wurde auf einer Waldlichtung von seinem Trupp beim Onanieren beobachtet. Augenscheinlich genossen es diese Männer, Zeuge einer Selbstbefriedigung zu sein.
Sofort wurde diese Ungeheuerlichkeit dem Diensthabenden gemeldet. Unterfeldmeister Hirsch ließ die Abteilung Aufstellung nehmen.
„Soll Hennig etwa bestraft werden?“, wunderte sich Lothar.
„Davon ist auszugehen!“, vermutete Joachim.
„Das Ferkel vortreten!“
„Jawohl, Unterfeldmeister!“
„Hennig, schämen Sie sich?“
„Jawohl, Unterfeldmeister!“
„Hennig, rufen Sie laut: ich bin ein Wichser und schäme mich!“
„Jawohl, ich bin ein Wichser!“
„Lauter!“
„Ich bin ein Wichser und schäme mich!“
„Noch lauter!“
„Ich bin ein Wichser und schäme mich!“
Höhnisches Gelächter dröhnte.
„Abteilung wegtreten!“
Der Gipfel von Heuchelei, ein Triumph der Verlogenheit. Alle taten „es“, die meistens schon als kleiner Junge. Niemand wusste so gut wie man selber, dass jeder es bisweilen dringend braucht. Manche würden gerne zusehen, wie ein Mann Hand an sich legt, ob er es mild tut oder wild, ob er es in die Länge zieht oder schnell zum Ziel kommt. Jeder im Kameradenkreis lebte in Angst, dabei beobachtet zu werden. Dass man das letzte Zipfelchen Intimität aufgibt und etwas zeigt, was einem alleine gehört.
In der Nacht vom 20. auf den 21. Juni 1941 feierten wir auf einer Waldlichtung mit Infanteristen der benachbarten Fahrradkompanie einen denkwürdigen Kameradschaftsabend. Es war lange hell, erst gegen Mitternacht brach die Dunkelheit herein. Wir hockten an roh gezimmerten Tischen, das Bier schäumte und strömte literweise; ein Fass nach dem anderen wurde angestochen.
Bei angenehmen Sommertemperaturen wurden aus vollen Kehlen Soldatenlieder gesungen. Niemand vermochte zu ahnen, dass dreißig Stunden später, im Morgengrauen des 22. Juni, der Russlandfeldzug beginnen würde. Einige unsrer fröhlichen Infanteristen würden diesen Tag nicht überleben.
Am 22. Juni, Punkt 6 Uhr, kam der Marschbefehl: „Abteilung, fertig machen zum Einsatz!“ Das hieß packen.
Um 7 Uhr traten wir feldmarschmäßig ausgerüstet an. Feldmeister Schneider, der Stellvertreter des Abteilungsführers, verlas einen Führerbefehl. Er begann mit den Worten: „Soldaten der Ostfront!“
Der Ostfront? Also doch! Die meisten von uns hatten es geahnt, aber keiner so recht glauben wollen. Geahnt, aber nicht darüber gesprochen beim Schleppen und Stapeln von Granaten, beim Rollen unzähliger Benzinfässer, beim Aufbau und Tarnen riesiger Munitions- und Treibstofflager in den polnischen Wäldern.
Der Gedanke, das russische Riesenreich erobern zu wollen, war zu unheimlich. Mit Hitlers Befehl zum Krieg gegen die Sowjetunion wurde er zur Tatsache.
22 Juni 1941
Unsere RAD-Abteilung wurde auf LKWs der Wehrmacht verladen. Die Abfahrt verzögerte sich um zehn Minuten, weil ein Koch fehlte. Der musste erst aus dem warmen Bett seiner polnischen Küchenhilfe geholt, dann vor versammelter Mannschaft zur Sau gemacht und schließlich dem Gelächter der RAD-Abteilung preisgegeben werden, die in Reih und Glied angetreten seiner harrte.
Auf den voll gepfropften LKWs standen wir hautnah Mann an Mann. Über holprige Straßen durch einsame Dörfer, in denen sich kaum jemand blicken ließ. Allenfalls ein paar watschelnde Enten. Pferde zogen Baumstämme durchs Gelände.
Während der Fahrt nach Bialystok begleitete uns das Dröhnen schwerer Artilleriegeschütze. Stundenlanges Krachen ohne Unterbrechung: Abschüsse und dumpfe Einschläge. Deutsche Sturzkampfbomber donnerten in Richtung Osten. Kurz vor Brest-Litowsk wurden wir am Ufer des Bug von Schlauchbooten aufgenommen und über den Fluss gebracht. Benzingeruch stieg auf. Wir schwammen auf einer dunkelbraunen Brühe, auf der hin und wieder Ölfilm zu erkennen war.
Die Stadt war noch umkämpft. In der Nähe knatterte Gewehrfeuer. Ein Artilleriebeobachter erklärte hastig:
„Die meisten Brücken blieben unzerstört, weil sie blitzschnell erobert wurden. Im Zentrum fallen noch Schüsse, aber unsre Panzer rollen und rollen und ziehen ungefährdet weiter!“
Seine Gesichtszüge entspannten sich etwas, zeigten aber eine leichte Verwunderung:
„Auch die Zitadelle, glaubten wir, würde rasch fallen, denn in dem ungeheuren Feuerhagel der Artillerie konnte kein Stein auf dem anderen geblieben sein. Doch die fürchterlichen Einschläge haben die Festung bisher nicht zerstört.“
„Die Besatzung wehrt sich und fügt uns hohe Verluste zu“, berichtete ein anderer Stahlhelmträger, „unseren anstürmenden Infanteristen schlug mörderisches Feuer entgegen.“
Noch während wir ihm zuhörten, tauchten Sturzkampfflieger auf. Die Ju 87 flogen unter nervenzerfetzendem Geheul Angriffe auf die Zitadelle. Aus sicherer Entfernung beobachteten wir, wie sie ihre 1.800-kg-Bomben abluden. Emporschießende Explosionswolken zeigten Volltreffer an. Die total erschöpfte Besatzung ergab sich erst nach achttägigem Bombardement. Im Klartext hieß das: „Festung erobert!“
Erster Einsatzort für unsere RAD-Abteilung war das Bahnhofsgelände. Der Ausführungsbefehl lautete: „Bewachung der Gleisanlagen!“
„Die wurden gerade erst vor vier Stunden von deutschen Truppen erobert“, wusste Obertruppführer Gruber.
Unter dem Grollen des Geschützdonners ließ Oberstfeldmeister Reiche die Abteilung antreten. Der Abteilungschef setzte ein entschlossenes, ernstes Gesicht auf, schob das Kinn vor und rief mit schneidender Stimme:
„Kameraden, wir haben den Spaten gegen das Gewehr getauscht! Ziel des Feldzuges ist die Gewinnung neuen Lebensraumes. Russland soll Siedlungsland werden, uns die Ausnutzung der Rohstoffe ermöglichen. Arbeitsmänner, wir folgen der kämpfenden Truppe auf den Fuß. Kampfeinsätze mit der Waffe können nicht ausgeschlossen werden!“
Reiche hielt kurz inne, setzte seine Ansprache dann mit ruhiger Stimme fort:
„Alle Dienstgrade teilen ihre Leute sofort zur Bewachung von Güterwagen ein. Deren Ladungen sind militärisch zu sichern. Künftig werden wir im Straßenbau eingesetzt. Zu unseren Aufgaben gehört die Bewachung sowjetischer Kriegsgefangener. Nicht zuletzt auch der Schutz wichtiger Gebäude und Anlagen!“
Ein herrlicher Tag, strahlend blauer Himmel. Wir kampierten am Waldrand mit Blick auf die glaslosen Fenster des Bahnhofsgebäudes. Über dem Eingangsportal bröckelte die Stuckfassade ab. Im Wartesaal gackerten körnersuchende Hühner. Verstopfte Toiletten verbreiteten üble Gerüche. Mein Trupp bewachte Waggons, die aus Deutschland kamen und mit Volksempfängern beladen waren. Bestimmungsort: die sowjetische Hauptstadt Moskau.
Die ersten Russen, die ich sah, waren tote. Lagen mit starren Blicken und zerfetzten Körpern in Blutlachen vor einem Schienenhäuschen, die Arme wie hilflos ausgebreitet. Der Anblick dieser leeren Augen prägt sich ein.
Ein paar hundert Meter weiter feuerte deutsche Artillerie auf sowjetische Stellungen. Schaulustige Jugendliche versuchten sich den Geschützen zu nähern, wurden aber unter Drohgebärden verjagt.
Im Aufblitzen der Mündungsfeuer warteten sowjetische Offiziere in langen Reihen auf ihre Verhöre.
„Ab übermorgen werden wir Nachschubgüter auf russische Breitspurgleise umladen“, verriet Unterfeldmeister Hirsch.
So kam es. Auf einer langen Rampe mussten Kisten, Kasten und Behälter mit Munition, Treibstoff und Lebensmitteln von Hand zu Hand aus Güterwagen entladen werden. Den Vormännern blieb die Schlepperei erspart.
Unsere Behausungen, Baracken aus rostigem Wellblech oder rissigem Beton, versteckt unter Tarnnetzen, säumten die Gleisanlagen. Abend für Abend wurden sie durchsucht. Ausnahmslos.
Verstecke waren schnell gefunden. Entdeckt wurden Alkoholvorräte, Zigaretten gleich stangenweise und zahlreiche Kartons mit Blockschokolade.
Oberstfeldmeister Reiche ließ die Abteilung antreten und hatte einen Auftritt:
„Kommt zur Vernunft, Leute! Ich warne unmissverständlich! Sollten weitere Diebstähle vorkommen, drohen härteste Strafen. In Wiederholungsfällen standrechtliche Erschießungen!“
Der 30. Juni hätte der Tag unsrer Entlassung sein müssen. Daran wagte niemand zu denken. An diesem Tag lagen genau sechs Monate Reichsarbeitsdienst hinter uns. Auf dem Vormarsch im Osten konnte das natürlich kein Thema sein. Doch eines sehnsüchtigen Gedankens war es wert zu diesem Zeitpunkt.
Am 5. Juli wurden wir abgelöst und auf LKWs „verfrachtet“. Wagen an Wagen führte der Transport vorüber an zerschossenen Dörfern und ausgebrannten Häusern. Verschont geblieben waren allein die Kirchen. Meine Schwester hatte Geburtstag. 14 Jahre alt ist Uschi heute geworden, wie die Zeit vergeht, dachte ich.
Zehn oder fünfzehn Kilometer vor Baranovici sahen wir große Kuhherden. Sie waren vermutlich von deutschen Heereseinheiten requiriert worden. Hier begegneten uns auch erste Flüchtlinge. Kleine Panjewagen, von zottigen Steppenpferden gezogen, waren mit Töpfen und Kleidungsstücken behängt. Frauen hockten, ihre Habseligkeiten in Decken und Teppichen zusammengeschnürt, auf heillos überladenen Fuhrwerken. Alte und Kranke auf Kissen und Matratzen. Frauen zu Fuß schleppten Hausrat und Werkzeuge. Auf den Rücken der Zugpferde saßen Kinder. Auch Hundegespanne waren zu sehen.
Mit Blick auf das Elend fragte Joachim: „Wo wollen die eigentlich hin?“
„Ihr Leben retten, und ihr Hab und Gut“, antwortete ich.
„Im Krieg geraten auch unschuldige Frauen und Kinder unter Beschuss“, mischte sich Hardy ein, „er verursacht Elend, Leid und Tod.“
„Das ist mir zu defätistisch“, widersprach Joachim.
„Zwischen Zivilem und Militärischem gibt es im Krieg keine Grenze“, bemerkte ich.
Die Eroberung der größeren Städte spielte sich stets nach dem gleichen Schema ab. Erst bombardierte die Luftwaffe die mit Flüchtlingen überlaufenen Straßen, dann kämpften Infanteristen um jedes Haus und meistens ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die Menschen in der Sowjetunion erlebten den Vormarsch als Hölle. Dass hinter der Front die teuflischen Trupps des Sicherheitsdienstes der SS und der Sicherheitspolizei wüteten, blieb mir wie vielen anderen bis Kriegsende unbekannt.
Unmittelbar hinter der kämpfenden Truppe erreichten wir die ersten Straßenzeilen von Baranovici. Einige Gebäude brannten lichterloh, andere waren bereits Ruinen. Auch Straßenbahnen und Busse, zerschossen, leer, reglos, erstarrt.
Auf Plätzen der Innenstadt lagerten biwakierende deutsche Infanterieeinheiten. Unsere Abteilung wurde auf einen schmucklosen Wohnblock im Süden der Stadt verteilt. Bröckelnder Putz, lecke Dachrinnen, die Farbe undefinierbar. Die Zimmergemeinschaft bestand aus Hardy, Joachim und mir; wir breiteten unsere Decken auf dem Fußboden aus und machten es uns, so gut das möglich war, bequem.
Nach Mitternacht brach die totale Dunkelheit aus. Die zerstörte Stadt war erfüllt von beängstigenden Geräuschen: Vereinzelten Feuerstößen, fernen, gewitterähnlichen Blitzen, begleitet vom Grollen der Geschütze.
„Verfluchte Wanzen!“ Winters Aufschrei riss uns aus dem Schlaf. „Das hält keine Sau aus!“, rief Hardy. Das Ungeziefer kroch aus tausend Löchern. Und fiel erbarmungslos über uns her. Ich sprang auf und rannte ins Freie. Andere folgten rasch nach. Kameraden, die zunächst nichts gemerkt hatten, mussten aus dem Tiefschlaf geholt werden. Fluchtartig wurden die verseuchten Wohnungen verlassen.
„Meine Klamotten sind hin, die kannst du nur noch verbrennen“, schimpfte Winter.
Einige rannten erst ins Freie, als sowjetische Luftangriffe begannen und Bomben fielen. Wieder und immer wieder bebte die Erde. Der ohrenbetäubende Lärm detonierender Geschosse dröhnte durch die Stadt. In der Finsternis ließ sich nichts erkennen. Überall quoll dichter Rauch empor. Aufsteigende Leuchtspurraketen erhellten den Himmel nur für Sekunden.
„Gespenstisch“, murmelte Hardy. Die Bomben fielen in einiger Entfernung, Einschläge feindlicher Artilleriegeschosse lagen näher. Eine Druckwelle zerstörte Fensterscheiben. Wo man hinsah, ging Glas zu Bruch. Überall.
Einweisung in eine russische Kaserne. Ein Geruch von Schweiß und Urin durchzog die Flure. Auch in den Räumen der heruntergekommenen Gebäude stank es entsetzlich. Es wimmelte von Fliegen.