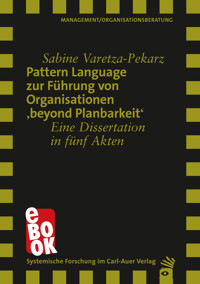
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Verlag für systemische Forschung
- Sprache: Deutsch
Führung 'beyond Planbarkeit' – Ein Paradigmenwechsel für die Zukunft der Organisationen Was, wenn alles, was wir über Führung zu wissen glauben, nicht mehr funktioniert? So wie im März 2020 als die Welt durch Ausbruch der Covid-Pandemie aus den bisher vertrauten Fugen geriet. VUCA wurde über Nacht zur Realität, Unvorhersehbarkeit und Unsicherheit das "new normal". Der erste Lockdown markierte eine Zäsur; denn Führung mittels traditioneller Steuerungs- und Kontrollmechanismen stieß reihum an ihre Grenzen und bislang eingespielte Prozesse versagten. Die hier vorliegende Dissertation ist ein Zeitdokument, das an diesem historischen Einschnitt entstand. Sabine Varetza-Pekarz wagte einen radikalen Perspektivwechsel und stellte die Frage, wie Führung 'beyond Planbarkeit' mit allen pandemischen, organisationalen und emotionalen Herausforderungen dennoch gelingen konnte. Basierend auf Erkenntnissen der Chaos- und Komplexitätstheorie, entwickelt sie daraus ein innovatives Instrumentarium für Führung, das jenseits klassischer Planbarkeit funktioniert. Durch eine Synthese aus Reflexiver Grounded Theory, Pattern-Theorie und Situationsanalyse entstand so eine praxisnahe Pattern Language, die auf 80 empirisch erhobenen Patterns (Erfolgsmustern) und 9 Metamustern basiert. Die Autorin legt empirisch wie theoretisch fundiert dar, warum Organisationen sich von mechanistischen Denkmodellen lösen und zu dynamischen, selbstorganisierenden Systemen wandeln müssen. Und sie schlussfolgert, dass Organisationen vor allem Synchronisations- sowie Selbsterneuerungsfähigkeit und eine Kultur der "ResponsAbility" entwickeln müssen, damit diese Transformation gelingt. Doch seien Sie gewarnt: Diese Arbeit ist mehr als eine wissenschaftliche Untersuchung – sie ist ein Erlebnis. Strukturiert als Theaterstück in fünf Akten, macht sie den notwendigen "Gestalt-Switch" nicht nur theoretisch nachvollziehbar, sondern performativ erlebbar. Denn Transformation bedeutet nicht nur, neues Denken zu kultivieren – sondern, neue soziale Praktiken zu etablieren: Done is better than perfect! Und damit kann das Stück beginnen. Dieses Buch ist für alle, die Organisationen zukunftsfähig gestalten wollen – mutig, radikal und jenseits der Planbarkeit. Die Autorin: Sabine Varetza-Pekarz ist Expertin für Organisationsentwicklung, partizipative Transformationsprozesse und Kulturarbeit. Als geschäftsführende Gesellschafterin der incorporate future KG setzt sie sich seit Jahren in wissenschaftlicher und praktischer Forschung mit den Herausforderungen der Arbeitswelt von heute und morgen auseinander. Mit 25 Jahren Erfahrung in Führung, systemischer Beratung und Organisationsentwicklung, entwickelt sie praxisnahe und innovative Ansätze für gelingende Transformation und verschränkt so Forschung und Praxis in ihrer täglichen Arbeit. In ihrer Doppelrolle als Betriebswirtin und Organisationspsychologin hat sie stets die enge Verzahnung von Kultur und Struktur im Fokus – denn nachhaltige Veränderung gelingt nur, wenn beides gemeinsam Beachtung findet. Mit ihrem systemischen Ansatz bringt sie so Klarheit in komplexe Prozesse, schafft Räume für konstruktive Auseinandersetzung und setzt gezielt Impulse für wirksame Entwicklung. Egal ob es sich hierbei um Transformationsprozesse in Organisationen, Team-Workshops, Bürger:innen-Beteiligungsprozesse oder EU-Projekte handelt. Ihr persönliches Anliegen ist es, soziale Systeme in unsicheren Zeiten dabei zu stärken, handlungsfähig zu bleiben und eine sinnstiftende Kultur der Zusammenarbeit zu etablieren und sich so zeitgemäß und zukunftsfähig weiterzuentwickeln. Darauf fokussierte sie auch ihre Forschung an der Universität Duisburg-Essen und ging der Frage nach, wie Führung "beyond Planbarkeit" gelingen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Verlag für Systemische Forschung
im Carl-Auer Verlag
Sabine Varetza-Pekarz
Pattern Language zur Führung von Organisationen ‚beyond Planbarkeit‘
Eine Dissertation in fünf Akten
2025
Der Verlag für Systemische Forschung im Internet:
www.systemische-forschung.de
Carl-Auer im Internet: www.carl-auer.de
Bitte fordern Sie unser Gesamtverzeichnis an:
Carl-Auer Verlag
Vangerowstr. 14
69115 Heidelberg
Über alle Rechte der deutschen Ausgabe verfügtder Verlag für Systemische Forschungim Carl-Auer-Systeme Verlag, Heidelberg
Fotomechanische Wiedergabe nur mit Genehmigung des Verlages
Reihengestaltung nach Entwürfen von Uwe Göbel
Printed in Germany 2025
Erste Auflage, 2025
ISBN 978-3-8497-9084-4 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-9085-1 (ePub)
DOI 10.55301/9783849790844
© 2025 Carl-Auer-Systeme, Heidelberg
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Diese Publikation beruht auf der gleichnamigen Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Dr. phil. an der Fakultät für Bildungswissenschaften, Fach Psychologie, der Universität Duisburg-Essen.
Datum der mündlichen Prüfung: 13.12.2024
Gutachter:
Prof. Dr. Wolfgang Stark
Prof. Dr. Klaus Sailer
Die Verantwortung für Inhalt und Orthografie liegt bei der Autorin.
Für alle mutigen Führungskräfte, die bereit sind, neue Wege zu gehen.
Ich möchte Sie verführen
zum Brückenbau ins Voraussetzungslose.
Wir wissen nicht, wo wir landen werden.
Aber wir können’s nicht lassen,
ins Voraussetzungslose zu bauen.
Von Wort
zu Wort
zu Wort.
(Martin Walser, Das dreizehnte Kapitel)
Vorwort von Wolfgang Stark und Klaus Sailer
Führungsaufgaben haben heute immer weniger mit der „Einführung und Umsetzung planbarer Prozesse“ zu tun. Spätestens seit der COVID-Pandemie ist klar geworden, dass die für eine lange Zeit vermeintlich erfolgreiche „Maschinenlogik“ von Organisationen (Ziel – Plan – Umsetzung – Kontrolle) an ihre Grenzen kommt. Unternehmen und Organisationen nur auf Basis von vorhersagbaren und kontrollierbaren Prozessen zu steuern, ist in komplexen und hochdynamischen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Systemen immer weniger wirksam.
Diese Frage nach Führung in einer VUCA-Welt ist also relevanter denn je, wenn viele Unternehmen bedroht sind, mit den klassischen Unternehmungsführungsmethoden an ein Limit zu stoßen. Anstatt nur weitere, etwas verbesserte Managementmethoden zu suchen, geht Sabine Varetza-Pekarz einen anderen Weg. Sie erörtert, wie sie mit der Methode der Pattern Language implizites Wissen von Erfahrungsträger:innen nutzt, um Erfolgsfaktoren zu erkunden und damit einen neuen Zugang finden zur Frage der Führung von Organisationen. Dazu werden die Möglichkeitsräume und Potentiale fluider Organisationsformen und selbstorganisierter Entscheidungsprozesse in diesem Buch genauer untersucht. Aufgrund konkreter und differenziert analysierter Praxisbeispiele zeigt die Autorin, wie die Anwendung impliziter Muster, die durch die Pandemie an Bedeutung gewonnen haben, die Synchronisations- sowie die Selbsterneuerungs- und Transformationsfähigkeit von Organisationen stärkten und in der Praxis wirkungsvoll waren. Die Arbeit wirft auch einen Blick in die mögliche Zukunft transformationsfähiger Organisationen: Transformationsprozesse brauchen bereits für ihr Entstehen eine Kultur der „ResponsAbility“, die die Fähigkeiten des „sich neu Ausrichtens“, in unsicheren und dynamischen Situationen zu „performen“ und die Fähigkeiten der Synchronisation mit einem sich schnell und unplanbar verändernden Kontext nachhaltig unterstützt.
Sabine Varetza-Pekarz hat in ihrer Arbeit nicht nur das Forschungsfeld „Führung in Organisationen“ im kontextuellen Rahmen ‚beyond Planbarkeit‘ neu aufgefächert. Dadurch, dass der Text wie ein Theaterstück aufgebaut ist, nimmt sie die Leser:innen mit auf eine Reise durch differenziert entwickelte, aber sehr gut nachvollziehbare theoretische Grundlagen einer Mustersprache ‚beyond Planbarkeit‘. Sie lässt uns die Zweifel und das forschende Innehalten genauso miterleben, wie ihren eigenen persönlichen Prozess des Erkenntnisgewinns und der Identitätsentwicklung als Forscherin.
Dabei gelingt es ihr, sowohl in der theoretischen Grundlegung ihres Forschungsthemas als auch in der Entwicklung ihrer qualitativ fundierten und gleichzeitig innovativen forschungsmethodischen Ansätze, ihre Forschungsreise als künstlerisch-empirische Entwicklung spannend darzustellen, ohne die konkreten Ergebnisse und ihre Einordnung in den organisationstheoretischen Kontext zu vernachlässigen. So ist dieses Buch nicht nur eine wichtige Lektüre für alle Verantwortlichen von Organisationen, da es konkrete Werkzeuge für die Praxis liefert, die in der gegenwärtigen Krisenlandschaft von besonderer Relevanz sind. Die besondere Form der Darstellung lässt die Leser:innen darüber hinaus an dem Entstehungsprozess teilnehmen und gibt so eine zentrale Erkenntnis der Arbeit – nämlich Transformationsprozesse durch Selbstorganisations-Strukturen zu meistern – auch auf performanter Ebene wider.
Wolfgang Stark
Steinbeis Center Innovation and Sustainable Leadership, Pähl
Klaus Sailer
Strascheg Center for Entrepreneurship, München
Vorwort von Sebastian Jung
Die vorliegende Dissertation bedient sich der dramaturgischen Struktur eines Theaterstücks in fünf Akten. Diese bewusst gewählte Form dient nicht nur dazu, den notwendigen „Gestalt-Switch“ in ein neues Paradigma der Organisation „beyond-Planbarkeit“ theoretisch zu analysieren und praktisch zu durchdringen, sondern ihn gleichzeitig performativ zu inszenieren. Nach Überzeugung der Autorin verlangt eine tiefgreifende Transformation mehr als bloße rationale Auseinandersetzung – vielmehr sei ein „Wechsel der Form schon im Transformationsprozess notwendig“ für eine fundamentale Paradigmenverschiebung.
Es bietet sich an, auf die etymologischen Wurzeln von „Theater“ zu schauen, die vom griechischen theatron stammen: „ein Ort zum Betrachten“ (von theasthai, „gewahr werden“). Das Theater fungiert als Raum des kollektiven Sehens, Wahrnehmens und Geschichtenerzählens. Wie Peter Brook in seinem wegweisenden Werk „Der leere Raum“ (1968) über das Theater darlegt, sei es der „leere Raum“, der es dem Unsichtbaren erlaubt, sichtbar zu werden. In Anlehnung an Niklas Luhmann nutzt die Autorin das Theater, um den komplexen Kontext zu verdichten, so dass er auf der Bühne zum Spielraum für Transformation wird. Die Bühne der Dissertation bietet den Hintergrund, auf dem die empirisch erhobenen 80 Patterns und neun Metamuster als Erfolgsmuster für das Führen von Organisationen „beyond-Planbarkeit“ vor den Augen der Lesenden Gestalt annehmen.
Dazu nimmt die Autorin uns mit auf eine Reise in das Land „beyond-Planbarkeit“. Um dorthin vordringen zu können, müssen die Leser:innen jedoch zunächst einen Raum der bewussten Verwirrung durchqueren, um so gemeinsam mit der Autorin zum Ort des Ungedachten vorzustoßen und den gewohnten Mustern des zweckrationalen Denkens zu entfliehen. Mitten im „betwixt and between“, was der Anthropologe Victor Turner (1982) auch als „liminalen“ Raum beschreibt, löst sich die alte Form der Organisation auf und eine neue beginnt sich zu formieren. Um im Liminalen kreativ und konstruktiv agieren zu können, ohne vollständig die Orientierung zu verlieren, bedarf es – wie die Autorin mit Rückgriff auf Peschl bzw. Neubert betont – eines „enabling milieu“ und einer „kulturellen Lernumwelt“, in denen wie in einem Kokon die neuen Muster kokreativ erprobt und erlernt werden können.
In meiner Rolle als Lead für Research & Development des Social Presencing Theater (SPT) im Presencing Institute interessiert mich besonders die Frage, wie bewusstseinsbasierte Praktiken, speziell die „sozialen Künste“, Prozesse zur Schaffung von Räumen bieten, die tiefere Ebenen der Systemtransformation erschließen. Wir Menschen besitzen die Fähigkeit zum Wahrnehmen und Erspüren – einschließlich dessen, was im Entstehen begriffen und noch nicht sichtbar ist (Scharmer & Pomeroy 2024). Diese Suche nach der Integration von „systems thinking and systems sensing“ (Scharmer 2016) in der Organisationsentwicklung – einem verkörperten und „gefühlten“ Ansatz von Leadership – zeigt sich auch in dieser Dissertation durch einen Appell zur Rückkehr zu den Sinnen. Führung jenseits der Planbarkeit erfordert nicht nur das Verstehen eines Systems, sondern auch dessen intuitives Erfassen der erlebten Komplexität. Indem Entscheidungsträger:innen lernen, ihren eigenen körperlichen und intuitiven Wahrnehmungen zu vertrauen, nähern sie sich dem, was meine Kollegin Arawana Hayashi (2021) im SPT als „True Move“ bezeichnet und mein Kollege Otto Scharmer (2007) als „Umstülpen der Struktur unserer Aufmerksamkeit“ – jener authentischen Bewusstseinsqualität, die spontan entsteht, wenn das analysierende, planende Ich in den Hintergrund tritt und einer ganzheitlichen Wahrnehmung Raum gibt für „action confidence“ (Scharmer 2020).
Die Autorin zeigt, dass es sich im Hinblick auf die Zukunft „beyond-Planbarkeit“ nicht um einen einmaligen Veränderungsprozess handelt. Die Transformation vollzieht sich, wenn die eigene Wandlungsfähigkeit als natürlicher Teil der organisationalen und individuellen Identität betrachtet wird. Die Organisationsmetapher wandelt sich vom Bild des steuerungsträgen Tankers zur Impro-Theater-Gruppe. Die Reise ins Land „beyond-Planbarkeit“ kennt kein festes Ziel – sie ist vielmehr ein fortwährender Prozess des Werdens.
Sebastian Jung
Presencing Insitute, Chile
Werkseinführung
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
Sie werden sich vielleicht wundern; über diese ungewöhnliche Art und Weise, in der sich die vorliegende Dissertation im ersten und – seien Sie versichert – auch im zweiten und jedem weiteren Blick präsentiert. Die Form eines Theaterstücks in fünf Akten wurde von der Forscherin im Kontext ihres Forschungsgebiets, der Führung von Organisationen ‚beyond Planbarkeit‘, sorgsam und bewusst gewählt und inszeniert. Sie wird im Lauf der Arbeit darlegen, dass es notwendig ist, einen Paradigmenwechsel zu vollziehen, um eine Organisation tatsächlich ‚beyond Planbarkeit‘ führen zu können; und dass ein solcher Paradigmenwechsel einen ‚Gestalt-Switch‘ bedingt, ja sogar erzwingt. Sie bietet über eben diese Form ein ‚Re-Entry‘ im Sinne von George Spencer Brown an; die Möglichkeit eines neuen Einstiegspunkts und damit Betrachtungspunkts; man könnte auch sagen ‚Vantage-Point‘, der Begriff wird später noch fallen. Das Phänomen Führung ‚beyond Planbarkeit‘ ist gemäß der Erkenntnis der Forscherin nicht hinlänglich auf rational-expliziter Ebene fassbar. Dies ist nur eine Seite der Medaille, ohne die andere würde man dem Phänomen nicht gerecht werden; und damit würde auch Führung beyond nicht gelingen. „Was ist nun die andere?“, werden Sie sich vielleicht nun fragen. Mit Luhmann gesprochen ist es „ein Kontext, ein leerer Raum, ein unbeschriebenes Blatt, ein Zustand, den man ausfüllen soll und den man nicht zu fassen bekommt, der aber Spielraum gibt für die eine oder andere Formung der Welt“ (1990:2). Es ist ein „Hintergrundsbegriff“ (ebd.) und auf eben diesem Hintergrund bietet die Forscherin in der folgenden Aufführung ganz konkret und rational-explizit die empirisch erhobenen 80 Patterns und 9 Metamuster als Erfolgsmuster für das Führen von Organisationen ‚beyond Planbarkeit‘ dar.
Viel Freude bei der Aufführung!
AUFTAKT
SZENE 1 > DONE IS BETTER THAN PERFECT
Stimme 1:Geht es jetzt endlich los?
Stimme 2:Was heißt losgehen? Es ist Zeit, es endlich zu Ende zu bringen.
Stimme 1:Aber wie soll das gehen? Wir sind noch lange nicht so weit.
Stimme 2:Ja sag!DONE IS BETTER THAN PERFECT1ist doch unser Motto.
Stimme 1:Das ist leichter gesagt als getan. Noch dazu: Was heißt das? Zählt die Qualität denn gar nicht mehr?
Stimme 2:Doch natürlich! Kannst du dich nicht mehr erinnern an unsere Reise ins Land ‚beyond Planbarkeit‘? Da war doch der Unternehmer aus der IT-Branche, dem wir begegnet sind …
Stimme 1:Ich glaube, ich weiß schon, welche Begegnung du meinst.
<FLASHBACK. BEIDE ERINNERN SICH.>
Stimme aus dem Off
2
Früher war unser Bestreben wirklich das Beste zu finden, das Richtigste. Ja, das Fehlerloseste. Heute ist das nicht mehr mein Bestreben. Nicht, weil ich den Anspruch aufgegeben hätte. Aber ich meine, dass wir in so einer komplexen Welt leben, die auch noch so schnelllebig ist – das kommt als Dimension dazu – dass es unglaublich schwierig ist, im Vorhinein abzuschätzen, was das Richtige ist. Ja, in Anführungszeichen. Den Anspruch, den ich heute habe, ist, dass wir eine möglichst schnell lernende Organisation sind. Ja. Also dass wir möglichst rasch für uns erkennen, was funktioniert, was funktioniert nicht
Stimme 1:Du meinst also, wir sollten einfach mal beginnen, um durchs Tun draufzukommen, was funktioniert und was nicht.
Stimme 2:Genau. Auf Reisen ist es doch auch so: Wir können immer erst dann erkennen, was hinter der nächsten Kurve liegt, wenn wir so weit gehen oder fahren, dass wir um die Kurve blicken können. Alles andere ist Spekulation.
Stimme 1:Klingt vernünftig. Und wie fangen wir an?
Stimme 2:Lassen wir doch mal die Forscherin erzählen, wie unsere Reise ins Land ‚beyond Planbarkeit‘ begann.
AUSGANGSLAGE
Am Arbeitsmarkt und in den Unternehmen sind unter dem Eindruck von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUCA) seit Jahren große Herausforderungen zu lösen. So zwingt die digitale Transformation Unternehmen in zunehmendem Ausmaß dazu, ihre Organisationen, Prozesse, Strukturen, aber auch Werte vom Kunden her zu denken. Es braucht neue Lösungen, um den sich in zunehmender Geschwindigkeit ändernden Anforderungen aus der unternehmerischen Umwelt begegnen zu können und antwortfähig zu bleiben (Schumacher & Wimmer 2019). Zugleich sind die Bedeutung der persönlichen Sinnerfüllung, eine individuell auszugestaltende Balance zwischen Arbeit und Privatleben sowie der Wertewandel von Menschen in der Arbeit wesentliche Treiber, die auf Organisationen wirken (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2016). Bis zum Ausbruch der Covid-19-Pandemie kamen die skizzierten Veränderungen auf Organisationen nicht laut und damit als Revolution wahrnehmbar, sondern vielmehr still und leise zu. Daraus entstand eine Diskrepanz und Spannung zwischen „der ‚gefühlten‘ Realität einer eher evolutionären Entwicklung und der ‚tatsächlichen‘ Realität beschleunigter und radikaler Umwälzungen“ (Baltes & Freyth 2017:4). Das hat sich geändert und es ist mittlerweile sichtbar, dass die neue Realität nach Corona radikal anders ist als zuvor: So ist beispielsweise „Homeoffice […] gekommen um zu bleiben“ (B4 2020:841)3, die digitale Transformation wurde beschleunigt und Videokonferenzen haben die Meeting-Kultur, aber auch nachfolgend ganze Branchen verändert. Zusätzlich hat sich der schon vorher gezeigte Trend des Fachkräftemangels nunmehr zu einem Arbeitskräftemangel verschärft: „[H]eute ist es […] umgekehrt, dass man sich als Unternehmen bei den Mitarbeitern bewerben muss, anstatt dass sich die Mitarbeiter beim Unternehmen bewerben“4 (B2 2019:220–222). Darüber hinaus eskalierte während der Covid-19-Pandemie der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zum Krieg, was massive Auswirkungen auf die Energiekosten und die Weltwirtschaft hatte. Im Jahr 2023 brach zudem der Israel-Palästina-Konflikt erneut aus. Es zeigt sich, dass eine einfache Rückkehr zu einer – wenn auch neuen – Normalität nicht möglich ist, da Unternehmensführung heute nicht mehr in einem Kontext der risikobehafteten Ungewissheit, sondern in einer der (absoluten) Unsicherheit – ‚true uncertainty‘5 (Knight 1921) – stattfindet. Der Bereich der „known unknowns“ (Kerwin 1993:178) wurde und wird größer. Es gilt sich einzugestehen, dass es zunehmend mehr Dinge gibt, von denen wir wissen (sollten), dass wir sie nicht wissen. Dies ist aber nur die Spitze des Eisbergs im Vergleich zu „all the things we do not [even, EdV] know we do not know“ (ebd.). Diese ‚unknown unknowns‘ (1993:178) sind die wahren Gamechanger; denn sie bedeuten, dass „keine belastbaren Informationen über die Zukunft mehr verfügbar“ (Grichnik u. a. 2017:116) sind.
PROBLEMSTELLUNG
Seit Heinz von Foerster ist bekannt, dass Organisationen – genauso wie Menschen und die ganze Welt – ‚nicht-triviale Maschinen‘ sind. Sie sind damit im Gegensatz zur trivialen Maschine unzuverlässig, da sich ihre inneren Zustände „geschichtsabhängig“ ändern können und dies auch regelmäßig tun; womit sie per Definition „analytisch indeterminierbar [und, EdV] unvorhersagbar“ (ebd.) sind. Dennoch konnte der Schein, Unternehmen durch Planung steuern zu können, lange aufrechterhalten werden. Dieses Weltbild wird nun aber zunehmend erschüttert. Die Erfahrungen im Kontext von Situationen ‚true uncertainty‘ zeigen, dass Pläne „als entscheidende Komponenten der erfolgreichen Ausführung effektiver Handlungen überschätzt“ (Weick 2018:22) sind, je volatiler und unvorhersehbarer die Zukunft wird. „Pläne sind ein Vorwand, unter dem mehrere wertvolle Aktivitäten in Organisationen vor sich gehen, aber Vorhersage ist keine von diesen Aktivitäten.“ (2018:23) Die Forschungserkenntnisse aus der Chaos- und Komplexitätstheorie zeigen, dass „Steuerung und Regelung […] offenbar nur bei stabilem Systemverhalten sinnvolle Instrumente“ (Kruse 2020:48) sind, denn ihre Wirksamkeit ist „gebunden an Stabilität, an die Vorhersagbarkeit zukünftiger Entwicklungen“ (ebd.). Die Realität ist aber, dass „Wandel statt Stabilität […] die Regel in jeder Organisation“ (Weick 2018:172) ist. Komplexe Argebungen „überforder[n] hierarchische Führungspraktiken“ (Schumacher & Wimmer 2019:12), „they lose their grip“ (Weber 2016:213). Notwendig wäre es, den Modus „from planning to preparedness“ (2016) und den Führungsfokus von „Voraussagbarkeit und damit Kontrollierbarkeit“ (Simon 2020:28) in Richtung auf eine „‘incognito‘ forsight dimension“ (Weber 2016:13) zu verschieben.
Auch wenn moderne Balanced Scorecards (BSC) oder ERP-Systeme ganzheitlicher angelegt sind als traditionelle (ausschließlich kaufmännisch orientierte) Controlling-Systeme, ist das rationale Weltbild mit seinen Prinzipien der Planbarkeit und Berechenbarkeit tief in der Unternehmenssteuerung verankert (Kieser 2019:48f). Wider theoretisches Wissen über Organisationen als ‚nicht-triviale Maschinen‘ sind die Leitsysteme in der organisationalen Praxis nach wie vor von vermeintlicher Vorhersagbarkeit geprägt. Eine Lösung aus dem mechanistischen Paradigma heraus ist in der Alltagspraxis noch nicht gelungen, denn: „[E]s suggerieren uns ein wenig diese ERP-Systeme, ja. Dass wir ja alles wissen. Aber das Extrapolieren geht nimmer. Also man tut sich da wahnsinnig schwer und damit tun sich die vielen Firmen schwer, die doch […] allesamt aufbauen auf Planbarkeit, Einschätzbarkeit, Vorhersagbarkeit“ (B3 2019:265–267). Als Resultat ergibt sich die paradoxe Situation, dass das Wissen vorhanden ist, dass komplexe Systeme in komplexen Umgebungen nicht über einfache Regelkreise steuerbar sind, die verfügbaren Instrumente aber darauf aufbauen und damit einfaches Ursache-Wirkungs-Denken fördern.
Es fällt den handelnden Personen und den durch ihre Interaktionen geschaffenen Organisationen schwer, „außerhalb mechanistischer Kausalität zu denken“ (Leitner 2016:18), auch wenn sie anderen und sich selbst gegenüber vorgeben, dass das nicht so ist. Sich tiefgründig einzugestehen, dass es notwendig ist, den Organisationsmodus „from planning to preparedness“ (Weber 2016) zu verändern, stellt Organisationen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Die Veränderung ist so tiefgreifend, weil sie grundlegend erlernte Überzeugungen und Annahmen tangiert; also das, was bisher als selbstverständliche Wahrheit betrachtet wurde. Und so kommt es in der Praxis von Organisationsveränderungen, die diese Grundfesten berühren, zu Organisationsblockaden und es entsteht das Phänomen eines „eigentlich gewollten, zumindest als Notwendigkeit gesehenen, aber dennoch ausbleibenden Wandel[s]“ (Deeg u. a. 2009:242), bedingt durch „Strukturen, die im Zusammenwirken der Akteure hervorgebracht und aufrechterhalten werden – aber eben oft jenseits ihrer Ausgangsintentionen“ (ebd.).
Es besteht also ein Theorie-Praxis-Gap in Bezug auf das Phänomen Führung ‚beyond Planbarkeit‘6. Die zentrale Frage, die den weiteren Forschungsprozess leiten wird, lautet daher:
„Wie kann angesichts der skizzierten Ausgangssituation Führung ‚beyond Planbarkeit‘ in der Praxis gelingen und der Theorie-Praxis-Gap überwunden werden?“
1 In Kapitälchen sind PATTERNS dargestellt, die im vorliegenden Forschungsprozess erarbeitet wurden.
2 Zitate der Stimme aus dem Off sind anonymisierte Feldstimmen aus den Interviews.
3 Zitate aus dem empirischen Material (B1–B18) werden in der vorliegenden Arbeit von Beginn an eingesetzt, da ein kontinuierliches „Hin und Her“ (Breuer u. a. 2019:133) zwischen Empirie und Theorie zum Wesen der Reflexiven Grounded Theory Methodology gehört. Aus Gründen der Vertaulichkeit sind die vollständigen Interviews dieser Publikation nicht beigefügt, sie wurden nur der Promotionskommission in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.
4 Die maskuline Schreibweise in Originalzitaten aus dem empirischen Material wird in der vorliegenden Arbeit beibehalten, um die Aussagen der Interviewpartner:innen nicht zu verfälschen.
5 Begriffe, die im Fließtext unter einfache Anführungszeichen gestellt sind, sind (ausgenommen ‚beyond Planbarkeit‘) Konzepte anderer Forscher:innen, die für die vorliegende Arbeit zentral sind. Diese werden beim ersten Auftreten kursiv gesetzt und mit der jeweiligen Quelle angegeben, im weiteren Verlauf ohne Quellenangabe. Eine Zusammenfassung der verwendeten Konzepte findet sich im Konzeptverzeichnis am Beginn der Arbeit.
6 Als zentrales Phänomen wird ‚beyond Planbarkeit‘ in der vorliegenden Arbeit – zusätzlich zu den zentralen Konzepten anderer Forscher:innen – unter einfache Anführungszeichen gestellt.
SZENE 2 > NICHT-WISSEN ZUGEBEN?
Stimme 1:Hm. Wenn ich das so höre, dämmert mir langsam, warumDONE IS BETTER THAN PERFECTso ein essentielles Erfolgsmuster im Land ‚Beyond Planbarkeit‘ ist. Wenn ich nicht mal mehr weiß, was ich nicht weiß …
Stimme 2:… oder vielleicht sogar glaube zu wissen, obwohl ich gar nicht weiß.
Stimme 1:Ja, man kann sich auch irren.
Stimme 2:Sich das einzugestehen, ist aber schwierig, wenn die Firmen so auf Planbarkeit, Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit aufbauen, wie wir gerade gehört haben.
Stimme 1:Daher ist es auch wichtig, NICHT-WISSEN ZUZUGEBEN!
<FLASHBACK. STIMME 2 ERINNERT SICH.>
[V]iele zeigen diese Schwäche aber nicht, nicht alles wissen zu können; weil es eben dann, eben auch als solche ausgelegt werden könnte und das könnte auch die eigene Führungsrolle da unterminieren, oder dann könnte jemand kommen, der sagt: „Aber ich kann das sehr wohl“.
Stimme 1:Hast du das gerade gesagt?
Stimme 2:Nein, eigentlich habe ich mich nur gerade an das Gespräch erinnert, dass wir mit der Führungskraft geführt haben, die in dem globalen Konzern im Topp-Management tätig war. Aber vielleicht habe ich auch laut gedacht.
Stimme 1:Mir fällt auch gerade eine Situation ein. Weißt du noch, die Abteilungsleiterin?
<FLASHBACK. STIMME 1 ERINNERT SICH.>
Und da hat bei uns schon der Kampf um die besten Köpfe intern massiv begonnen. Weil, du kennst die Leute natürlich. Du weißt, wie jeder funktioniert. Und jetzt wird da schon aktiv in fremden Gewässern gefischt.
Stimme 2:Stimmt. Ich erinnere mich. Also irgendwie scheint es zumindest in einigen Unternehmen einen starken internen Wettbewerb zu geben. Das sollten wir im Hinterkopf behalten.
ZIEL DER FORSCHUNG
Das Ziel des Forschungsvorhabens ist es, Praktiker:innen ein Modell zur Führung von Organisationen ‚beyond Planbarkeit‘ zur Verfügung zu stellen. Zentral dabei ist es, die Organisation dabei zu unterstützen, „kollektive Wahrnehmungsorgane [zu entwickeln], die es dem System erlauben, sich selbst zu sehen“ (Scharmer 2015:405) um den eigenen „crux of the issue“ (Vermaak & de Caluwe 2018:16) zu erkennen und so Organisationsblockaden gegen den Wandel proaktiv zu überwinden. Das Modell soll Organisationen in die Lage versetzen, Strategien zu verfolgen, auch wenn diese ihren gelernten Mustern widersprechen. In der Anerkennung von Organisationen als lebendige Systeme gilt es dabei, ein „fließendes Verständnis von Organisationen“ (Stark u. a. 2017:9) zugrunde zu legen, „das nicht mehr nur auf rationaler Planung basiert“ (ebd.) und einer ganzheitlichen Perspektive zu folgen, um Antworten geben zu können, „wie physische, psychische, soziale und technische Prozesse produktiv und zugleich evolutionsfähig gekoppelt werden können“ (Dell 2017b:134). Die Herausforderung ein solches Modell zur Verfügung zu stellen, liegt darin, dass Konzepte und Modelle dazu tendieren, zu einengend und rigide zu sein. In der Praxis werden Führungskräfte und Changeverantwortliche durch Modelle verleitet, Methoden umzusetzen und Schemata zu folgen. Damit laufen sie aber Gefahr, Organisationen wieder auf eine Maschinenlogik zu reduzieren, anstatt ihren lebendigen Charakter anzuerkennen und zu fördern. Ist das Modell hingegen zu ergebnisoffen oder reduziert sich auf eine Sammlung von Best-Practices-Beispielen, bleiben konkrete Anleitungen und Hilfestellungen aus und es fehlen Anhaltspunkte für die Führungs- und Transformationsarbeit.
Geeignet erscheint hier, auf die Patterntheorie von Christopher Alexander (2003; Leitner 2016; Iba & Yoshikawa 2016) aufzubauen, da Patterns im Unterschied zu Best-Practice-Beispielen „das Prinzip der Lösung” (Stark 2017:22) beschreiben. Patterns sind „eine neue Form der Wahrnehmung und der Beschreibung von Strukturen“ (Leitner 2016:21). Eine Pattern Language ist kein starres System oder Kochrezept, sondern bietet für bestimmte Phänomene eine neue Sprache an, die sich – analog der gesprochenen Spracheverändern kann. Wer die Sprache einmal gelernt hat und die Grammatik und Grundregeln beherrscht, ist in der Lage, sie im jeweiligen Kontext gezielt einzusetzen. Diese Charakteristika lassen die Mustertheorie als vielversprechend erscheinen, die vorliegende Problemstellung zu lösen. Die Zielsetzung des Forschungsvorhabens ist damit zusammengefasst, ein
Modell zur Führung von Organisationen ‚beyond Planbarkeit‘ in Form einer Pattern Language zu entwickeln und Praktiker:innen zur Verfügung zu stellen.
METHODISCHES VORGEHEN
Mit besonderem Blick auf die Zielsetzung einer Modellentwicklung für Praktiker:innen, steht im Mittelpunkt des Forschungsinteresses das tiefgehende explorative Ergründen und Verstehen „lernseits“ (Schratz 2009) des Geschehens, also aus der Perspektive der Praxis. Qualitativ geführte Interviews sind daher der Kern dieser Forschung, trianguliert durch Daten aus teilnehmender Beobachtung und ethnografischen Feldgängen im Rahmen des Forschungsprozesses. Qualitative Methoden „können verstehen helfen, was hinter wenig bekannten Phänomen [sic!] liegt“ (Strauss & Corbin 2010:5, HdV)7. Sie können aber auch „benutzt werden, um überraschende und neuartige Erkenntnisse über Dinge zu erlangen, über die schon eine Menge Wissen besteht“ (ebd). Beides ist für die Erforschung des Phänomens Führung ‚beyond Planbarkeit‘ zentral, wie in der Darlegung des Forschungsstands im ersten Akt deutlich werden wird.
Methodisch gerahmt ist das Forschungsvorhaben mittels der Reflexiven Grounded Theory Methodology (RGTM) (Strauss & Corbin 2010; Alheit 1999; Breuer u. a. 2009; Breuer u. a. 2019), um eine gegenstandsbegründete Theorie in Form einer Pattern Language zu entwickeln. Eine Grounded Theory ist eine gegenstandsverankerte Theorie, die „induktiv aus der Untersuchung des Phänomens abgeleitet wird“ (Strauss & Corbin 2010:7f). Die Reflexive GTM inkludiert, aufbauend auf der Methodologie der Grounded Theory, gezielt Verfahren und Praktiken der (Selbst)-Reflexion. Dies hat besondere Relevanz für die vorliegende Untersuchung, da die Forscherin durch ihre langjährige berufliche Praxis und ihre akademische Laufbahn im Untersuchungsfeld sozialisiert wurde. Dadurch hat sie für das Feld typische Grundannahmen entwickelt, deren vermeintliche Selbstverständlichkeit im Alltag nicht in Frage gestellt wird. Die Reflexion dient dem bewussten Umgang mit diesen eigenen Präkonzepten, damit die Forscherin „mit einer offenen, interessierten, rezeptiven und respektvoll-akzeptierenden Haltung nah an den Gegenstand herangeh[en]“ (Breuer u. a. 2009:23) kann. Mit Hilfe eines methodischen Kunstgriffs wird in Anwendung der Methode des inneren Teams‘ (Schulz von Thun 2011) die Pluralität der Forscherin – im Sinne ihrer „inneren Pluralität“ (2011:21) aber auch ihrer Doppelrolle als Forscherin und Mitglied des Untersuchungsfelds – produktiv nutzbar gemacht und bewusst als potenzielle Erkenntnisquelle in den Forschungsprozess eingebracht.
STRUKTUR UND AUFBAU DER ARBEIT
Die vorliegende Arbeit ist in 5 Akte gegliedert, die diesem einleitenden Auftakt folgen. Im ersten Akt ‚Lage sondieren‘ wird die Ausgangssituation und der organisationstheoretische Forschungsstand dargelegt. Aufgrund der Erkenntnis, dass es bei einer Transformation ‚beyond Planbarkeit‘ um einen Paradigmenwechsel geht, wird die Paradigmentheorie Kuhns expliziert und darauf aufbauend der Forschungsstand in Hinblick auf komplexitätsadäquate und paradigmenüberwindende Transformationen beleuchtet.
Im zweiten Akt ‚Reisevorbereitungen‘ wird der in dieser Arbeit methodische Ansatz einer Triangulation aus der Reflexiven Grounded Theory Methodologie (RGTM), der Pattern Theorie nach Christopher Alexander und der Situationsanalyse nach Adele Clare expliziert. Weiters wird die methodische Begründung für den Einsatz des Modells des inneren Teams (Schulz von Thun 2011) geliefert und ein Gestaltwechsel vollzogen.
Im dritten Akt ‚Forschungsreise‘ wird der Forschungsprozess selbst im Sinne einer chronologischen Ereigniskette ‚beyond Planbarkeit‘ dargelegt. Der Prozess wird dabei entlang der unterschiedlichen Phasen des Grounded Theory Prozesses mit den jeweiligen Besonderheiten beschrieben und aus der Perspektive des inneren Teams reflektorisch beleuchtet. Durch diese Doppelung ist es möglich, „das (Erfahrungs-)Wissen [der Forscherin, EdV] über einschneidende Ereignisse […] aus unterschiedlicher Perspektive [… zu] erfassen, aus[zu]werten und in Form einer Geschichte“ (Thier 2020:121) aufbereitet darzubieten.
Im vierten Akt findet die Reise ihren Höhepunkt ‚im Land beyond Planbarkeit‘. Dieser Akt ist dem Kern der empirischen Forschungsergebnisse gewidmet; den Patterns, die die Forscherin mit Hilfe eines eigenen Kodierparadigmas, welches die Methodologie der Grounded Theory mit der Pattern Language verschränkt, aus dem Material extrahiert hat. Die daraus entwickelte Pattern Language wird in narrativer Gestalt dargelegt, wie im dritten Akt methodisch begründet wird.
Im fünften Akt ‚Wieder zu Hause ankommen‘ wird die Pattern Language rational-explizit als tabellarischer Überblick sowie in Form eines Pattern-Organigramms dargelegt. Die zentralen Ergebnisse werden diskutiert und theoretisch reflektiert. Basierend auf den so gewonnenen Erkenntnissen wird das Grounded Theory Modell der Führung ‚beyond Planbarkeit‘ vorgelegt.
KONZEPTVERZEICHNIS
Die nachfolgenden Konzepte werden in der vorliegenden Arbeit häufig verwendet. Die Übersicht bietet eine kompakte Nachschlagemöglichkeit und dient als globale Quellenangabe in Verzeichnisform. Um den Lesefluss nicht zu behindern, werden die Konzepte folglich im Textverlauf nicht bei jedem Auftreten zitiert.
Konzept
Urheber:in / Quelle
Beschreibung, Zitat zur Verdeutlichung
Deutero-Lernen
Chris Argyris & Donald A. Schön
Wechsel des Lernsystems inklusive Neudefinition der diesbezüglichen handlungsleitenden Theorien (2008:121f); im Gegensatz zu singleloop- (instrumentellem Lernen) und doubleloop-Lernen (Verändern von Zielen und Werten).
Gestalt-Switch
Thomas S. Kuhn
Effekt der Betrachtung von Vexierbildern. Man sieht das gleiche Bild plötzlich anders. (1974c:3)
Grenzobjekte, boundary objects
Susan Leigh Star
Objekte, die „plastisch genug sind, um sich lokalen Anforderungen […] anzupassen und robust genug, um eine gemeinsame Identität über Ortswechsel hinweg aufrechtzuerhalten.“ (2017:142)
Inkommensurabilität
Thomas S. Kuhn
fehlender objektiver Vergleichsmaßstabes aufgrund unterschiedlicher Ansatzpunkte (Kuhn 2014)
Inneres Team
Friedemann Schulz v. Thun
Methodik, um der „inneren Pluralität“ (2011:21) strukturiert Ausdruck zu verleihen.
Nicht-triviale Maschine
Heinz von Foerster
Haben einen inneren veränderlichen Zustand und sind daher vollständig unberechenbar. (1993:247ff)
Open-ended
Christopher Alexander
Process „lack[s] a fixed, predetermined endstate. [A]daption means noting if changes cannot be made in response to the process of adaption.“ (2002b:240)
Paradigma
Thomas S. Kuhn
„[E]in impliziter Komplex ineinander verflochtener theoretischer und methodologischer Überzeugungen, der Auswahl, Bewertung und Kritik möglich macht.“ (2014:31)
Patterns
Christopher
Alexander
„[G]eneric rules for making centers“ (2002b:341), „capable of making an infinite number of particular centers of the same type“ (2002b:345).
Pattern
Language
Christopher
Alexander
„[A] way of defining generic centers, and then using them, sequentially, in design projects.“ (2002b:344)
Presencing
Otto Scharmer
Kunstwort aus presence und sensing, das ausdrückt, „dass man sich mit der Quelle der höchsten Zukunftsmöglichkeit verbindet und sie ins ‚Jetzt‘ bringt“ (2015:172).
Quality without a name
Christopher
Alexander
„a central quality which is the root criterion of life and spirit in a man, a town, a building, or a wilderness. This quality is objective and precise, but it cannot be named.“ (1979:19)
Systems
Generating
System
Christopher
Alexander
„[A] process which assembles parts according to certain constraints, chosen to ensure the proper interaction of these parts, when the system operates.“ (1967:10)
Theoretisieren
Kathy Charmaz
Die Polarität von Theorie und Praxis hebt sich im Begriff des ‚Theoretisierens‘ auf: „Theorizing is practice.“ (2006:128)
True uncertainty
Frank Knight
Begriff für absoluten Unsicherheit im Kontrast zu risikobehafteter Ungewissheit. (Knight 1921)
Undiskutiertes
Francois Jullien
„[D]er Grund an Übereinstimmung, von dem allein ausgehend man dann diskutieren, eine Position beziehen und sogar entgegengesetzter Meinung sein und sich widerlegen kann.“ (2006:52)
Ungedachtes
Francois Jullien
„[E]s gibt das, was ich denke, aber auch das, von dem aus ich denke und das ich gerade deshalb nicht denke.“ (2006:15)
Unknown unknowns
Ann Kerwin
„[A]ll the things we do not [even, EdV] know we do not know.“ (1993:178)
7 Hervorhebungen der Verfasserin im Fließtext werden kursiv dargestellt. In Zitaten wird zusätzlich angemerkt, ob die Hervorhebung im Original (HiO) oder durch die Verfasserin (HdV) vorgenommen wurde.
ERSTER AKT – DIE LAGE SONDIEREN
IF WE CANNOT SEE THE WHOLENESS WHICH EXISTS IN THE WORLD, THEN OF COURSE WE CANNOT TAKE ACTIONS WHICH ARE CONSISTENT WITH THE WHOLENESS WHICH EXISTS. (ALEXANDER 2002B:465)
SZENE 1 > (NOCH KEIN) BILD DER LAGE
Stimme 2:Im Sinne vonNICHT-WISSEN ZUGEBENmuss ich ehrlich sagen, dass ich noch nicht genau verstanden habe, was das eigentliche Problem ist. Wieso kommt es zum Beispiel zu diesen Organisationsblockaden?
Stimme 1:Das erleichtert mich gerade, wenn du das sagst. Mir geht es ähnlich. Ich habe auch noch kein wirkliches Verständnis von der Problematik, eher so ein oberflächliches „ eh klar“. Wir sollten die Forscherin bitten, uns detaillierter über den aktuellen Forschungsstand zu informieren. Vielleicht erhellen sich dann unsere blinden Flecken?
Stimme 2:Hm, ja. Ich denke auch, es braucht ein tiefergehendes Sondieren, um zu einem umfassendenBILD DER LAGEzu kommen. Und vielleicht ist die Darlegung des Forschungsstandes dafür wirklich ein guterNÄCHSTERSCHRITT.
Stimme 1:Und dann schauen wir weiter. Einfach mal denNÄCHSTEN SCHRITTsetzen. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden.
1. Organisationstheoretischer Forschungsstand
1.1 KOMPLEXE SYSTEME IN KOMPLEXEN UMGEBUNGEN
Mechanistisch strukturierte Organisationen funktionieren in stabilen Umgebungen, in denen es um die stetige Wiederholung (möglichst) einfacher Aufgaben geht und die Sicherheit gegeben ist, dass der Markt Bedarf an genau den produzierten Produkten oder gelieferten Dienstleistungen hat. (Morgan 2018:44f) Beim Vorliegen solcher Rahmenbedingungen ist Präzision das Gebot der Stunde und „Rationalisierung als Leitidee“ (Kieser 2019:48) der Maßstab. Je veränderlicher, unberechenbarer und dynamischer die Umgebung wird, umso eher stößt diese Form des Organisierens an ihre Grenzen (Senge 2011:73–85; Sterman 2000:31–33; Simon 2021:29–34; Kruse 2020: 43–53). Die Forschungserkenntnisse aus der Chaos- und Komplexitätstheorie zeigen, dass „Steuerung und Regelung […] nur bei stabilem Systemverhalten sinnvolle Instrumente“ (Kruse 2020:48) sind, denn ihre Wirksamkeit ist „gebunden an Stabilität, an die Vorhersagbarkeit zukünftiger Entwicklungen“ (ebd.). Die Welt, die Organisationen umgibt wird aber zunehmend volatiler, unsicherer, komplexer und ambiguer (VUCA). Ein Operieren mit Wahrscheinlichkeiten, die Anwendung klassischer Methoden der Risikoabschätzung, das Bemühen darum, Unsicherheit zu reduzieren, sind Ansätze, die solange funktionieren, solange man noch von Risiko als „messbarer Unsicherheit“ (Grichnik u. a. 2017:116) ausgehen kann. Die VUCA-Welt ist aber eine Welt, in der per Definition nicht mehr von einer risikobehafteten Welt auszugehen ist, sondern von einer Welt mit wahrer Ungewissheit, ‚true uncertainty‘8. Im Unterschied zu klassischen risikobehafteten Situationen sind Situationen vom Typ ‚true uncertainty‘ dadurch gekennzeichnet, dass es nicht mehr möglich ist, mit Wahrscheinlichkeiten zu operieren, denn „[e]s liegen weder Informationen über Wahrscheinlichkeiten noch über die möglichen Endzustände vor“ (Grichnik u. a. 2017:116). Und dies bedeutet: Eine Welt der ‚true uncertainty‘ ist „ein anderes ‚Spiel‘ und verlangt von Organisationen [nicht nur, EdV] andere Antworten“ (Boos & Buzanich-Pöltl 2020:25), sondern es bedarf eines anderen Verständnisses von Organisationen (Wimmer 2012:68) als dem vorherrschend mechanistischen. Eine der Herausforderungen ist, dass es aktuell eine Vielzahl an Organisationstheorien9 gibt, die aufgrund ihrer unterschiedlichen Ansatzpunkte sowie Widersprüchlichkeiten und aufgrund eines fehlenden objektiven Vergleichsmaßstabes in einem ‚inkommensurablen‘ (Kuhn 2014) Konkurrenzverhältnis zueinander stehen (Scherer & Marti 2019:36). Auch wenn im wissenschaftlichen Diskurs eine Abkehr von instrumentellen und Hinwendung zu evolutionären und dynamischen Ansätzen (Wimmer 2012:65f) zu beobachten ist, hat sich bislang noch keine konsistente Organisationstheorie geformt, die den neuen Spielregeln der VUCA-Welt angepasst ist und dem vorherrschenden mechanistischen, naturwissenschaftlichem Subjekt-Objekt-Modell10 entgegen gesetzt werden könnte.
Mit allen ‚Inkommensurabilitäten‘ gibt es dennoch weitgehendes Einverständnis darüber, dass es sich bei Organisationen um „hochkomplexe soziale11 Systeme“ (Scherer & Marti 2019:17) handelt, die nur im Kontext ihrer Umwelt und ihres inneren Zustand zu denken und verstehen sind. Peter Senge – Senior Lecturer am MIT, Vorsitzender der Society for Organizational Learning (SoL) und Autor von Die fünfte Disziplin - bezeichnet das Systemdenken dezidiert als „konzeptionelle Grundlage“ (2011:87) seines Organisationsverständnisses. Auch zahlreiche andere Organisationstheoretiker:innen und -berater:innen bauen explizit oder implizit auf dieser Grundlage auf.12 Dieses Theorieverständnis wird daher der Arbeit zugrunde gelegt. Charakteristisch für ein komplexes System ist, dass ein solches über eine große Anzahl an Elementen verfügt, die dicht vernetzt sind und das - als Ganzes und in seinen Elementen – eine hohe Veränderlichkeit aufweist (Kruse 2020:44ff; Tewes 2014:32–38). Meadows definiert ein System als „an interconnected set of elements that is coherently organized in a way that achieves something“ (2009:11). Verbindungen bestehen dabei nicht nur im Inneren des Systems, sondern auch nach außen hin zur Systemumwelt:
Abb.
1
:
Komplexes System mit Wechselwirkungen (Quelle: Tewes 2014, S. 76, leicht abgewandelt)
Innerhalb dieses „Wirkungsgefüges“ (Vester 2015:25) entwickeln sich Systemdynamiken, die dazu führen, dass das System insgesamt nicht vorhersagbar auf Interventionen und Veränderungen reagiert: „In dieses kann man nicht eingreifen, ohne dass sich die Beziehung aller Teile zueinander und damit der Gesamtcharakter des Systems ändern würde.“ (ebd.) Heinz von Foersters konstatiert in dem Zusammenhang, dass Organisationen keine „trivialen Maschinen“ (1993:245) sind, die auf einen bestimmten Input in vorhersehbarer Weise mit einem stets gleichen oder zumindest erwartbaren Output reagieren. Im Gegenteil, sie sind ‚nicht-trivial‘ (1993:247) in dem Sinne, dass sie – abhängig von ihrem jeweiligen inneren Zustand und zirkulärer Wechselwirkungen – als „analytisch unbestimmbar“ (Von Foerster & Pörksen 2013:58) gelten müssen.
Es ist „prinzipiell unmöglich“ (Simon 2020:19, HdV), die Prozesse zu durchschauen und sinnvoll zu steuern, denn ‚nicht-triviale‘ Systeme wie Organisationen sind „vollständig unberechenbar“ (2013:56) und „zerstören [so, EdV] unseren Traum von einer berechenbaren Welt“ (ebd.). Wie sich ein System verhält ist vielmehr „Ergebnis einer spontanen eigendynamischen Ordnungsbildung“ (Kruse 2020:53). Dieses Organisationsverständnis hat Auswirkungen auf die Frage, wie Organisationen geführt werden können.
Abb.
2
:
Triviale vs. nicht-triviale Maschine nach Heinz von Foerster (Quelle: von Foerster & Pörksen 2013, S. 57 u. 58)
1.2 FÜHREN IN KOMPLEXEN UND INSTABILEN UMGEBUNGEN
Anhand einer Klassifikation von einfachen versus komplexen Systemen, deren Systemdynamik entweder stabil oder instabil ist, lassen sich folgende organisationale Funktionsweise (grau) und Führungsansätze (kursiv) unterscheiden (Kruse 2020:44–52):
Tab.
1
:
Systemabhängige Führungsstrategien (Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Kruse 2020, S. 45)
(1) Steuerung als „das gezielte Erreichen eines vorgegebenen Ergebnisses durch eine Abfolge gerichteter und dosierter Kraftimpulse […] ist gebunden an einfache Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge“ (2020:46). Da Organisationen per Definition aufgrund ihrer komplexen Struktur dem widersprechen, ist Steuerung keine geeignete Führungsstrategie.
Der Führungsmechanismus (2) Regelung basiert auf der Kybernetik erster Ordnung und folgt dem Soll-Ist-Prinzip. Am Beispiel eines Raumthermostats lässt sich die Funktionsweise verbildlichen: Steigt die Temperatur über ein bestimmtes Niveau im Raum, wird die Heizleistung gesenkt, um so eine konstante Temperatur (das gewünschte Ziel) zu erhalten. Dieser Logik folgt auch der weit verbreitete Management-Ansatz des Managements by objectives (MbO). Es werden Ziel- oder Sollwerte als Vorgaben definiert, daraus abgeleitet Maßnahmen definiert und umgesetzt und die Umsetzung kontrolliert. Bei Zielerreichung tritt der Best Case ein, woran häufig das Belohnungssystem gekoppelt ist. Treten hingegen Abweichungen ein, gilt es den Ursachen auf den Grund zu gehen, diese zu beseitigen oder abzustellen, um doch das Ziel zu erreichen. Das definierte Ziel hat den „Status der Modellform und der Idealität“ (Jullien 2006:18). Dieses unter „Ingenieuren […] zentrale Denkmodell“ (Kruse 2020:47) ist grundsätzlich als Führungsprinzip in komplexen Systemen geeignet, aber nur bei stabilen Systemdynamiken; womit es für VUCA-Umgebungen und einem zugrundeliegenden Verständnis von ‚true uncertainty‘ als gegebener Realität nicht mehr geeignet ist. Wenn keine stabile Entwicklung mehr unterstellt werden kann, scheiden Steuerung und Regelung als adäquate Führungsmechanismen aus.
In solchen Kontexten ist (3) Versuch und Irrtum eine mögliche suchbewegungsorientierte Strategie, sofern es sich um einfache Systeme und überschaubare Situationen handelt. Mit zunehmender Komplexität des Systems erweist sich aber auch Trial & Error als unzureichende Strategie; mehr noch: bei Vorliegen komplexer Systemstrukturen wie in Organisationen ist dies durchaus eine riskante Strategie, da aufgrund der vielfältigen Wechselwirkungen unvorhersehbare Dynamiken entstehen können. Für diesen Ansatz braucht es jedenfalls „ein gutes Gedächtnis und klare Erfolgskriterien“ (2020:49). Ein gutes Gedächtnis braucht es, um Fehler nicht perpetuierend zu wiederholen, sondern aus den jeweiligen Versuchen und Irrtümern zu lernen; und die Erfolgskriterien sind essentiell, um zu erkennen, ob sich das System als Reaktion auf die Intervention (den Versuch) in die richtige Richtung bewegt.
Und so folgt nun schließlich im vierten Quadranten (komplexe Systemstrukturen und instabile Systemdynamiken) das Führungsprinzip (4) Musterwechsel. In turbulenten Zeiten, in denen weder die Umgebung genügend bestimmbar noch die Organisation selbst homogen steuerbar ist, gilt es – basierend auf den Erkenntnissen der Kybernetik zweiter Ordnung – einen Prozessmusterwechsel herbeizuführen, um die der Organisation inhärente Selbstorganisationfähigkeit zu nutzen. Das aus den Naturwissenschaften13 stammende Konzept der Selbstorganisation besagt, dass Ordnung in einem dynamischen, komplexen System ohne die Einwirkung einer „ordnenden Kraft“ (2020:54) entstehen kann. Selbstorganisierende Systeme „learn to learn and thus become intelligent enough to define and change their own operating criteria, behavior and identity“ (Hatch & Cunliffe 2013:306, HdV). Wenn nun aber diese interne Entwicklungsdynamik und Eigen-Entwicklungsfähigkeit der Organisation „rather than […] the behest of top management“ (ebd.) neue Ordnungen erzeugt, ändert sich die Aufgabe von Führung radikal. Sie besteht nun darin, „adäquate Formen der Selbstorganisation“ (Wimmer 2012:330) zu ermöglichen und so die Netzwerkintelligenz der Organisation zu fördern. Nach Karl Weick, emeritierter Professor für Organisationsverhalten und -psychologie an der Ross School of Business der University of Michigan, gilt es folglich, Organisation in die Lage zu versetzen, „continuous improvisational response[s] to continuous change in local details“ (1993:376) geben zu können. Hier schließt sich nun auch der Kreis zu Heinz v. Försters Typisierung von Organisationen als ‚nicht-trivialen Maschinen‘. Konsequent weitergedacht bedeutet dies, dass Organisationen selbst als „emergent property of change“ (Tsoukas & Chia 2002:570) zu verstehen und statische Gebilde durch „more liquid forms“ (Hatch & Cunliffe 2013:285) zu ersetzen sind:
Abb.
3
:
Zunehmende Fluidität von Organisationen nach Hatch (Quelle: Hatch 2013, S. 284)
Der Fokus verschiebt damit noch weiter „von der Voraussagbarkeit und […] Kontrollierbarkeit zur Komplexität und Nichtbeherrschbarkeit von Phänomenen“ (Simon 2020:28). Die Konsequenz ist, dass durch diese Entwicklungen und Erfordernisse insgesamt ein „qualitativ ganz neue[r] Kommunikationsbedarf“ (Wimmer 2012:312) in Organisationen entsteht und das Bewusstsein zu entwickeln ist, dass „Eingreifen […] immer ein Eingreifen in die Eigendynamik“ (2012:319) des Systems ist und damit wohl überlegt und dosiert sein sollte. Dieses Wissen ist mittlerweile als state-of-the-art im wissenschaftlichen Kontext zu bezeichnen. Dies ist allerdings nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite zeigt die Herausforderungen der Praxis, diese Ansätze umzusetzen.
1.3 TECHNOKRATISCHES FÜHRUNGSVERSTÄNDNIS
In der Praxis ist das rationale Weltbild mit seinen Prinzipien der Planbarkeit und Berechenbarkeit nach wie vor tief in der gelebten Unternehmenssteuerung verankert (Kieser 2019:48f; Wimmer 2012:147f; Simon 2021:29f); wie beispielsweise folgende Definition von Unternehmensplanung aus dem Gabler Wirtschaftslexikon14 zeigt:
„Unternehmerische Tätigkeiten bedürfen einer Planung, damit ihre möglichen Auswirkungen überschaubar und ihr zukünftiger Erfolg so weit als möglich erkennbar gemacht werden kann. […] Unternehmensplanung i. e. S. […] ist ein Managementkonzept zur Unterstützung der Unternehmensführung. Ergebnis sind Pläne für die zu führenden Organisationseinheiten. Meist wird mit der Planungsfunktion direkt auch die Kontrolle der Pläne verbunden. Auf derartige Planungs- und Kontrollsysteme wird man umso weniger verzichten können, je komplexer die Umwelten werden und je mehr aufgrund der internen Aufgabenkomplexität eine Abstimmung der Teilsysteme notwendig ist.“ (Müller-Stewens 2023, HdV)
Diese Aussagen widersprechen dem bislang dargelegten Wissenstand über komplexe Systeme in ihren Grundfesten. Es wird suggeriert, dass mittels Planung die „Auswirkungen unternehmerischer Tätigkeit überschaubar zu halten“ wären und zukünftiger Erfolg „erkennbar gemacht“ werden könne. Und dies sei mit zunehmender Komplexität „umso weniger verzichtbar“. Dieses Gedankengebilde entspricht dem Führungsprinzip Regelung (Kapitel 1.2) und damit der Kybernetik erster Ordnung (Simon 2020:18f; Kruse 2020:44ff), die von einfachen Regelkreisen ausgeht:
[Ich] konstruiere […] eine ideale Modellform, für die ich einen Plan mache und der ich ein Ziel setze; dann mache ich mich daran, nach diesem Plan und in Abhängigkeit von diesem Ziel zu handeln. Zunächst wird ein Modell erstellt, dann […] der Wille, der eingesetzt wird, um diese entworfene Idealform Wirklichkeit werden zu lassen. (Jullien 2006:17, HiO)
Die zugrundeliegende Annahme dieses Führungsverständnisses ist, dass „Systeme ‚in den Griff‘ zu bekommen“ (Simon 2020:19) wären; wenn es gelingt, die internen Prozesse und Abläufe zu durchschauen und zu kontrollieren bzw. dementsprechende Sollwerte vorzugeben. Es suggeriert, dass das Schicksal des Unternehmens, für das sich die Manager:innen verantwortlich zeigen, „durch die virtuose Handhabung rationaler [… T]echnik in die Hand gegeben zu sein scheint. [Der Mensch] ‚hat die Welt zu seinem ‚Gegenstand‘ und ‚Material‘ gemacht, um in souveräner Weise darüber zu verfügen“ (Abramowski, zitiert in Kieser 2019:59); und trivialisiert sie damit:
Abb.
4
:
Ziel-Plan-Trivialmaschine in Anlehnung an H. v. Foerster (Quelle: eigene Darstellung)
Dieser Führungs- und Denkansatz entspricht einer kausalen Zweck-Mittel-Relation und folgt damit der Logik der ‚trivialen Maschine‘. Es braucht den Verstand, der ein Ziel konstruiert und so „das Beste entwirft“ (Jullien 2006:17); dies ist der Zweck, die aristotelische Causa finalis15; die gewünschte „Ursache in der Zukunft“, die es zu erreichen gilt (Von Foerster & Pörksen 2013:50). Als Mittel werden Plan samt Maßnahmen und der nötige Wille eingesetzt. Wenn die Welt sich nun aber nicht mehr planbar und berechenbar zeigt, ist es notwendig, zu einem Führungsansatz ‚beyond Planbarkeit‘ zu gelangen. Und dies bedeutet nicht, anders zu planen als bisher, sondern vielmehr ein neues Verständnis von Führung zu entwickeln16; eines, das Selbstorganisation ermöglicht. Dafür scheinen die Organisationen aber vielfach kein „angemessenes Repertoire“ (Wimmer 2012:312) verfügbar zu haben. Und so ergibt sich die paradoxe Situation, dass das Wissen vorhanden ist, dass komplexe Systeme in komplexen Umgebungen nicht über einfache Regelkreise steuerbar sind, die verfügbaren Instrumente aber darauf aufbauen und damit einfaches Ursache-Wirkungs-Denken17 fördern.
1.4 DIE KRUX DES UNGEDACHTEN
Das Erkennen dieser Paradoxie wirft die Frage auf, was diese Dynamik aufrechterhält, wider besseres Wissen an einem nichtadäquaten Führungsansatz festzuhalten. Kruse (2020:46) konstatiert, dass „das Prinzip der Regelung besonders naheliegend“ ist in „Systemen, die für ihr Überleben auf die Einhaltung stabiler Bedingungen angewiesen sind“. Möglicherweise trifft dies auch für das psychische System von Führungskräften zu. Denn würden diese sich tiefgründig eingestehen, dass die Bedingungen nicht mehr stabil sind, würde dies zugleich bedeuten, dass die etablierten Steuerungssysteme in der Praxis nicht mehr weiter überleben können. Und dies hätte weitreichende Folgen; denn es wirft die Frage auf, wie Organisationen sonst geführt werden können.
Dass man auch eine ganz andere Vorstellung von Führung haben könnte, zeigt beispielsweise Jullien (2006:16–34) in seiner kontrastierenden europäisch-chinesischen Darstellung von Management und Wirksamkeit. Während der europäische Ansatz der eben beschriebenen Idee einer umzusetzenden „Idealform“ (2006:17) folgt; zeichnet sich eine gute Führungskraft chinesischer Vorstellung darin aus, dass sie über „einen guten Riecher“ (2006:21) verfügt, über den sie in der Lage ist, günstige Tendenzen einer konkreten Situation „aufzuspüren, um sich von ihnen tragen […] zu lassen“ (ebd.). Diese Führungslogik fußt also mehr auf der Fähigkeit das Situationspotenzial zu erkennen als auf dem Modellbildungsvermögen. Die „Umstände“ (2006:28) sind im chinesischen Denken integrierend eingebettet, während diese im europäischen Führungsansatz für Probleme sorgen, wenn sie sich dem Plan entgegenstellen; denn in diesem wird die theoretische Konzeption des Ziels von der praktischen Handlung getrennt. Auch wenn man dem kognitiv zustimmen kann, stellt sich dann doch in der Praxis die Frage: Wie sonst soll geführt werden, wenn nicht über Zielorientierung?18
Auch (Zenk u. a. 2023) kontrastieren die klassische Vorstellung von Management, indem sie verschiedene Managementkonzepte unterschiedlichen Theaterformen gegenüberstellen. Sie wählen dabei die Kunstform des Impro-Theaters, da diese „a fresh look at emergent order“ (2023:5) erlaubt und betonen mit der Emergenz eine wichtige Eigenschaft, die ‚triviale‘ von ‚nicht-trivialen‘ selbstorganisierenden Systemen unterscheidet. Emergenz bildet den Gegenpol zum Determinismus und bezeichnet das Phänomen, dass bestimmte Erscheinungen des Gesamtsystems nicht auf dessen Einzelbestandteile reduziert werden können, sondern durch deren Interaktionen und Wechselwirkungen entstehen und somit auch zu Überraschungen führen (können) (Hatch 2011:110). Und diese Eigenschaft ist es im Wesentlichen auch, die dazu führt, dass das Kausalitätsdenken und damit das Planungsparadigma versagen. Um nochmals Weick in Erinnerung zu rufen: „Pläne sind ein Vorwand, unter dem mehrere wertvolle Aktivitäten in Organisationen vor sich gehen, aber Vorhersage ist keine von diesen Aktivitäten.“ (2018:23) Selbiges gilt für Ziele.
Tab.
2
:
Kontrastierende Darstellung von Management und Theater nach Zenk (Quelle: eigene Darstellung basierend auf Zenk u. a. 2023, S. 11–12)
Inhaltlich kommen mit dieser Gegenüberstellung nach (Zenk u. a. 2023:11–12) neue Begriffe aus dem Management ins Spiel: Command and Control als deterministische Form der Führung bildet den Ausgangspunkt, vergleichbar mit dem klassischen Theater. Der Pfad in Richtung Selbstorganisation führt im nächsten Schritt zum Konzept der Agilität, was den Impro-Spielen der Theaterszene entspricht. Erst auf Ebene anspruchsvollerer, längerer Impro-Formen oder ganzer Impro-Stücke kann eine Analogie zu Selbstorganisation als Managementkonzept hergestellt werden. In der organisationalen Praxis ist vor allem „Agilität als neue Leitidee“ (Schumacher & Wimmer 2019:12) angekommen: So zeigt beispielsweise eine von KPMG durchgeführte europäische Studie unter 120 Teilnehmenden in 17 Ländern, dass 70% der Befragten eine agile Transformationen (im Bereich IT aber auch generell im Business) binnen der nächsten 3 Jahre anstreben (2019:4). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch Forbes Insights mit einer Befragung von 1.000 C-Level Führungskräften weltweit, wonach bereits 75% an der Transformation arbeiten (Forbes Insights & Scrum Alliance 2018:16). Auch, wenn erst zu überprüfen ist, ob bzw. in Bezug auf welche Aspekte Agilität als Konzept geeignet ist, nachhaltige Antworten auf ‚true uncertainty‘ und die mangelnde Vorhersagbarkeit zu geben19; zeigt sich im direkten Vergleich agiler Projekte zu Wasserfall-Projekten, dass die ersteren erfolgreicher sind in Bezug auf das Erreichen von Projektzielen, aber auch strategisch gesehen (Khoza & Marnewick 2020). Allerdings belegen umgekehrt zahlreiche Untersuchungen, dass der Weg der agilen Transformation „mit gebrochenen Versprechen gepflastert“ (Sutherland 2023:V, ÜdV) ist. Nach Studien der Standish Group bzw. von Forbes Insights scheitern über 50% der agilen Projekte (ebd.). Als größte Herausforderung wird dabei „Culture and Performance Management“ (KPMG 2019:19) bzw. in einer Studie von McKinsey „transforming the culture and ways of working“ (2018:16) benannt; nämlich: Das Missverhältnis von agiler Arbeitsweise und Notwendigkeiten der täglichen Praxis, mangelnde Kollaboration zwischen Hierarchien und Abteilungen, die Resistenz von Mitarbeitenden gegenüber Veränderung sowie das tiefverwurzelte Verhalten und Mindset von Mitarbeitenden (ebd.). Und so wird im Kontext einer nicht gelingenden agilen Transformation der Ruf nach Kulturveränderung laut, was ja eigentlich das ist, was durch die Transformation hätte bewirkt werden sollen. Was auf Projektebene funktioniert, kann offensichtlich nicht (einfach) auf Organisationsebene übertragen werden: „It’s one thing to inch beyond traditional waterfall management. It’s another to expand an Agile mindset, structures and approaches across an entire organization“ resümieren (Forbes Insights & Scrum Alliance 2018:16) und führen aus: „While 69% of survey respondents are very or extremely satisfied with strategy, only 55% are satisfied with its execution—a sign that it’s easier to design an Agile strategy than implement it.“ (ebd)
Stimme 1:Glaubst du, es fällt jemandem auf?
Stimme 2:Ich weiß nicht, wir haben es ja selbst lange nicht gesehen.
Stimme 1:Ich glaube dennoch, dass manche Leser:innen es erkennen werden. Die Forscherin hat es schon entsprechend hergeleitet und dramaturgisch aufgebaut.
Stimme 2:Egal, sie wird das Geheimnis dessen, was wir mittlerweile sehen, nun ja lüften.
Ja; es ist relativ einfach eine Strategie am Reißbrett zu designen, herausfordernd hingegen diese in der Praxis umzusetzen. Das von Jullien skizzierte europäische Denken ist auch hier am Werk: Zuerst wird die Modellform designt, sehr zur Zufriedenheit der Führungskräfte – „summum bonum“ (Von Foerster & Pörksen 2013:84); dann soll „diese entworfene Idealform Wirklichkeit werden“ (Jullien 2006:17), was letztlich nicht wie gewünscht oder erwartet gelingt, denn die „Umstände“ (2006:28) kommen damit ins Spiel. Dass dies der intendierten Absicht hinter der Idee der Agilität in den Grundfesten widerspricht, scheint weder den Befragten aufzufallen, noch den Studienherausgeber:innen. Und wieder schließt sich der Kreis zur ‚trivialen Maschine‘.
Und damit zeigt sich die eigentliche „crux of the issue“ (Vermaak & de Caluwe 2018:16): Dieses zweigeteilte Denken in (theoretischer) Idealform und (praktischer) Umsetzung ist so eingewoben in unserer20 Kultur verankert, dass sie – unbewusst – als stetiger „Kanon“ (Malinowski 2006:23) in „typische[m], immer wiederkehrende[m] Verhalten“ (ebd.) reproduziert wird. Und dies sogar in Situationen mit dem Bestreben als Organisation agiler zu werden und sich in Richtung Selbstorganisation zu entwickeln. Der „Proze[ss] der Planung, Organisation, Anweisung, Koordination und Kontrolle“ (Morgan 2018:32) wird „für so selbstverständlich gehalten“ (Schein 2010:35) und gelebt, dass dieses Führungsprinzip zum ‚Ungedachten‘ (Jullien 2006:15) wurde, samt der dahinterliegenden Grundannahmen und Weltbilder; und samt aller Konsequenzen, die dieses unbewusste Handeln verursacht. Den Ort, von dem auch gehandelt wird, nicht zu sehen, bezeichnet Scharmer als den „blinden Fleck“ (2015:33) in der Führungsarbeit:
„[E]s gibt das, was ich denke, aber auch das, von dem aus ich denke und das ich gerade deshalb nicht denke.“ (Jullien 2006:15, HdV)
8 Wie im Auftakt bereits dargelegt, werden häufig verwendete Konzepte anderer Forscher:innen – wie hier ‚true uncertainty‘ von Knight 1921 – nur beim ersten Auftreten im Fließtext zitiert. Ein Konzeptverzeichnis samt Quellenangabe befindet sich am Beginn der Arbeit.
9 Eine ausführliche Beschreibung der gegenwärtigen Theorien findet sich beispielsweise in (Scherer & Marti 2019).
10 Dazu zählen (Scherer & Marti 2019:22f) den Situativen Ansatz, Taylorismus und die Human-Relations-Bewegung.
11 bzw. sozio-technische (Sievers 2000:38) oder socio-environmental (Finidori 2018)
12 Siehe z. B. weiters (Scharmer 2015:83ff), (Kruse 2020:45ff), (Simon 2021:119f), (Wimmer 2012:66f), (Fatzer 2011), (Boos & Buzanich-Pöltl 2020:63ff)
13 Zentrale Forschungsgrundlagen schufen der Physiker Hermann Haken mit der Synergetik, in der Biologie der Nobelpreisträger Manfred Eigen mit dem Konzept des Hyperzyklus und in der Chemie Ilya Prigogine, ebenfalls Nobelpreisträger mit dem Konzept der nichtlinearen Dynamik. (Kruse 2020:53; Simon 2020:19ff)
14 Das Gabler Wirtschaftslexikon wurde im Kontext der vorliegenden Fragestellung (Modell für Praktiker:innen als Ziel der Forschung) bewusst gewählt, da es als Medium zwischen Führungsalltag (als Nachschlagewerk) und Wissenschaft (Autor:innen sind jeweils Wissenschaftler:innen der jeweiligen Disziplin) verortet werden kann
15 Die Causa efficiens wirkt in die umgekehrte Richtung. Ausgehend von einer Ursache in der Vergangenheit wird eine Wirkung in der Gegenwart als dadurch kausal bedingt unterstellt. (Von Foerster & Pörksen 2013:50)
16 Forschungstagebucheintrag 25.4.23: Wolfgang Stark im Rahmen der Forschungsstandbesprechung.
17 Für aus linearem Ursache-Wirkungs-Denken resultierende Probleme siehe detailliert (Tewes 2014:77).
18 Frage eines Geschäftsführers im Rahmen einer Klausur mit dem mittleren Management und der aufgetauchten Kritik an der in Verwendung befindlichen BSC als Steuerungsinstrument und der zu starken Zielorientierung im Unternehmen. Forschungstagebuch vom 11.10.2022.
19 So zeigt eine Studie von (CapGemini Consulting 2017), dass Erhöhung der Flexibilität, Reduktion der Time-to-market und schnellere Entscheidungen als Top 3 Ziele für Agilitätseinführung genannt werden. Wenn das eigentliche Probleme aber die mangelnde Vorhersehbarkeit ist, ist Schnelligkeit – die ja allen drei Nennungen zugrunde liegt – nur zum Teil eine adäquate Lösung. In Summe kann das Ziel nur sein, die Organisation in die Lage zu versetzen, bessere Entscheidungen zu treffen und das werden nur zum Teil die schnelleren sein. (Kahneman 2014)
20 An der Stelle wird das Pronomen „unser“ bewusst gesetzt um zu verdeutlichen, dass selbstverständlich auch die Forscherin Teil dieser Kultur und nicht außenstehende Beobachterin ist.
SZENE 2 > DE:MUT
Stimme 1:Habe ich das richtig verstanden? Wir erzeugen unseren Theory-Praxis-Gap selbst, weil wir Theorie von der Praxis trennen?
Stimme 2:Ja, das scheint wohl so zu sein. Ich merke gerade selbst, dass das Loslassen dieser Idee, ein Modell entwerfen zu können, dass es dann umzusetzen gilt, ein Unwohlsein bei mir auslöst.
Stimme 1:Kannst du es benennen? Was löst das Unwohlsein aus?
Stimme 2:Ich weiß nicht. Ich habe den Eindruck oder das Gefühl, die Dinge dann nicht mehr im Griff zu haben und … ja, wohl auch die Kontrolle zu verlieren.
Stimme 1:Was ja auch stimmt. <LACHT>. Wir glauben ja nur, die Dinge unter Kontrolle zu haben und alles beeinflussen zu können. Ich glaube, ein Geschäftsführer, den wir auf unserer Reise kennengelernt haben, der hat sogar davon gesprochen, dass wir 90% nicht beeinflussen können. Weißt du noch? Der, der eine Vielzahl von Unternehmen aus dem Tourismusbereich geführt hat.
Stimme 2:War das nicht der, der von derDE:MUTsprach?
Stimme 1:Ich glaube, vonDE:MUT





























