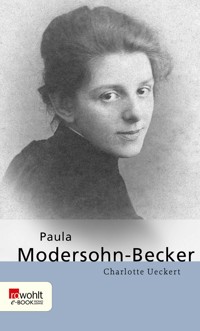
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Paula Modersohn-Becker (1876 – 1907) erlangte Anerkennung und Ruhm erst nach ihrem Tod. Sie war eine Wegbereiterin der Moderne, die in der Nazizeit als «undeutsch» verfemt wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihr Erbe hochgehalten, vor allem in dem auch durch sie berühmten Dorf, in dem sie zuletzt lebte und starb: Worpswede. Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Charlotte Ueckert
Paula Modersohn-Becker
Über dieses Buch
Paula Modersohn-Becker (1876–1907) erlangte Anerkennung und Ruhm erst nach ihrem Tod. Sie war eine Wegbereiterin der Moderne, die in der Nazizeit als «undeutsch» verfemt wurde. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ihr Erbe hochgehalten, vor allem in dem auch durch sie berühmten Dorf, in dem sie zuletzt lebte und starb: Worpswede.
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten.
Vita
Charlotte Ueckert, geb. 1944 in Oldenburg, Studium der Germanistik; Lyrikerin, Biographin, Reiseschriftstellerin. Veröffentlichungen u. a.: «Oldenburger Land – neu erlebt», Hamburg (Gmeiner) 2014; «Christina von Schweden. Ich fürchte mich nicht», Berlin (Ed. Karo) 2016; «Die Fremde aus Deutschland. Kurzprosa und Reisegedichte», Ludwigsburg (Pop Verlag) 2017; «Nach Alphabet gesammelt. Gedichte», Ludwigsburg (Pop Verlag) 2019; «Das Meer und der Norden», Berlin (Ed. Karo) 2020; «Künstler und Entdecker in der Südsee. Meine Reise zu den Zielen von Cook, Gauguin und Stevenson», Berlin (Ed. Karo) 2021. Beiträge in zahlreichen Anthologien. www.charlotte-ueckert.de
Impressum
rowohlts monographien
begründet von Kurt Kusenberg
herausgegeben von Uwe Naumann
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2021
Copyright © 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Für das E-Book wurde die Bibliographie aktualisiert, Stand: Oktober 2021
Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten
Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier
Covergestaltung any.way, Hamburg
Coverabbildung Paula Modersohn-Becker Stiftung, Bremen (Paula Modersohn-Becker, Foto von 1895)
ISBN 978-3-644-01254-7
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Deutschlands berühmteste Malerin
Wer in einem Museum, zum Beispiel in der Bremer Kunsthalle, wo ihr ein ganzer Raum gewidmet ist, oder im Paula Modersohn-Becker Museum in den Kunstsammlungen der Bremer Böttcherstraße, den Gemälden von Paula Modersohn-Becker gegenübersteht, dem fällt sofort auf, dass in ihrer Kunst etwas ganz Eigenes, ganz Charakteristisches, selten bei anderen Bildern zu Empfindendes liegt. Zunächst könnte das Dumpfe, Schwere erschrecken, das auf den Betrachter einwirkt. Dazu trifft selten Licht von außen auf die Gegenstände, Landschaften oder Gesichter. Dafür liegt ein ruhiges Leuchten, ein gedämpftes Strahlen nicht auf den gegeneinander abgestuften konturierten Flächen, sondern ist in die Farben selbst eingeprägt. Jeder Farbton ist auf das Ganze bezogen.
Die Bilder der Malerin, meist auf Pappe gemalt, manchmal auf Leinwand, einige auf Schiefertafeln, brauchen Ausstellungen oder Zusammenführungen. Erst dann kann man die erstaunliche Ausnahmeerscheinung Paula Modersohn-Becker richtig einschätzen. Die Bilder «deuten sich gegenseitig», wie Günter Busch schreibt, nach dem Zweiten Weltkrieg einer ihrer besten Fürsprecher.[1] Die Verfahren des Vergleichs, die Zusammenschau und die Gegenüberstellung innerhalb eines Werks und in der Beziehung zu anderen, liefern fruchtbare Einsichten in der Kunstgeschichte. So wird es leichter, einem Gewirr von Interpretationen zu entgehen.
Paula Modersohn-Beckers Werke sind international bekannt und vertreten, von Bremen bis New York, Berlin bis Detroit. Selbst nicht so bedeutende Bilder – andere kommen sowieso nicht auf den Markt – erzielen hohe Preise. Sie kann als eine der Wegbereiterinnen für die Aufnahme weiblicher Künstler in die großen Museen gelten, was bis heute nur wenigen Malerinnen in der Nachfolge Angelika Kauffmanns gelungen ist. Modersohn-Becker war niemals eine feministische Vorkämpferin. Sie schöpfte ihre Kunst zwar aus dem Potenzial eines weiblichen Blickwinkels, lernte aber von männlichen Vorbildern und respektierte die Männer ihrer Umgebung. Während diese mehr dem regionalen oder nationalen Wirkungskreis verhaftet blieben, gelang Paula Modersohn-Becker postum der Aufstieg in die Sphäre anerkannt großer Kunst.
Die Tochter des Malers Josef Johann Kauffmann, in Chur geboren, in Rom gestorben, wuchs in Jungenkleidung auf und wurde eine erfolgreiche Porträtmalerin, gelobt für ihr weiches Kolorit. Mit ihrem zweiten Mann Antonio Zucchi lebte sie in Rom, wo sie Berühmtheiten, unter anderem 1764 Johann Joachim Winckelmann und 1787 Johann Wolfgang von Goethe, malte. Ihre Büste steht im römischen Pantheon.
Wie konnte diese junge Frau eine Eigenständigkeit entwickeln, die ihr den Mut gab, trotz ihrer Wünsche nach Ehe und Kind einen Beruf zu ergreifen, der wichtiger wird als die «weibliche Erfüllung» im Sinne ihrer bürgerlichen Herkunft? Und das, obwohl die Anerkennung ausblieb. Sie war zeit ihres Lebens eine Einsame, die ihren Weg ohne Vertraute, ohne Publikum gehen musste, deren Ziele sich von denen der Familie, der Freunde und des Ehemannes immer mehr entfernten. Ein Kind ihrer Zeit, aber weder der Frauenemanzipation noch der Reformbewegung zuzuordnen, sondern eine Einzelne, kein Gemeinschaftsmensch. Ihrem Selbstverständnis nach keine Frau, deren Geschlechtszugehörigkeit ihr künstlerisches Streben behinderte, sondern eine Künstlerin, die ihr «Naturrecht», Frau zu sein, gleichzeitig mit der Kunst leben wollte. Ihr Menschenbild, wie es in den Bildnissen alter Bauersfrauen und Kinder, in Aktdarstellungen und vielen Selbstbildnissen erscheint, ist von diesem Recht auf Würde und individuelle Eigenart geprägt.
Paula Modersohn-Becker: Nicht ganz einig waren sich die Biographen über den Namen. Häufig tauchte sie auch als Becker-Modersohn auf. Und sie selbst? Wie hätte sie sich genannt, wenn sie gewusst hätte, dass ihr Name überlebt? Wie wichtig die mit dem Namen verbundene Identitätsfrage für sie war, zeigt nicht nur die folgende Passage aus einem Brief an den Dichterfreund Rainer Maria Rilke vom 17. Februar 1906: Und nun weiß ich gar nicht wie ich mich unterschreiben soll. Ich bin nicht Modersohn und ich bin auch nicht mehr Paula Becker. Ich bin Ich, und hoffe, es immer mehr zu werden.
Geborene Becker, verheiratete Modersohn, später, in der kurzen Trennungsphase, trotzig wieder Becker. Heute hätte sie ihren Ehenamen angehängt. Aber Modersohn, als der klangvollere Name einprägsamer, wurde zu ihrem Markenzeichen, mit ihm verbindet die Öffentlichkeit mehr sie als ihren Mann Otto, ebenfalls Maler und schon zu Lebzeiten berühmt, aber im Nachruhm weit von ihr überflügelt. Ihre Bilder signierte wohl Otto Modersohn, wenn überhaupt, nach ihrem Tod mit P.M.-B., aber auch P.B.-M. Sie selbst hat nur Jahreszahlen vermerkt.
Wenn man einmal von der künstlerischen Bedeutung Modersohn-Beckers absieht, gibt es drei Gründe für das Interesse an ihrer Biographie. Da ist zum Ersten ihre Verbundenheit mit Deutschlands bekanntester Künstlerkolonie, die bis heute publikumswirksam wachgehalten wird. Zum Zweiten die Freundschaft mit Rainer Maria Rilke, dem auch heute noch anerkannten und verehrten Dichter, rezitiert von den besten Schauspielern und nach wie vor ein Forschungsgegenstand der Literaturwissenschaft. Der dritte Grund ist der Erfolg ihrer Briefe und Tagebücher, die in unterschiedlichen Ausgaben seit 1917 veröffentlicht wurden und in fast keinem Bücherschrank nach dem Zweiten Weltkrieg fehlten.
Ende des 19. Jahrhunderts gehörte das Führen eines Tagebuchs für junge Leute ebenso zum guten Ton wie die Pflege der Briefkultur. Diese verbreiteten Formen des Alltagsschreibens und der Reflexion hat auch Paula Modersohn-Becker mehr oder weniger intensiv betrieben. Auch in ihrem Fall verdanken wir diesen gesammelten Zeugnissen ein genaues Bild ihrer Lebens umstände, ihrer geistigen und emotionalen Entwicklung. Und ihr Werdegang als Malerin wird nachvollziehbar.
Tagebücher werden auch von denen gern gelesen, die mit fiktionaler Literatur nicht viel anfangen können. Ob es Neugier ist, Suche nach Identifikation oder der Vergleich mit eigenen Lebensplänen, Tagebücher, auch fragmentarische, faszinieren durch ihren privaten Charakter, sie sind in der Regel leicht zu lesen, leicht auch zu vergessen. Wer die über den Alltag hinausweisenden Erkenntnisse Paula Modersohn-Beckers wirklich erfassen möchte, muss ihre Bilder betrachten. Im malerischen Werk findet sich, was in den Tagebüchern Lebens- und Erfahrungsstoff ist, in Runenschrift verwandelt. Die Art, wie Mackensen die Leute hier auffaßt, ist mir nicht groß genug, zu genrehaft. Wer es könnte, müßte sie mit Runenschrift schreiben. […] Ich fühle es größer werden in mir und weiter. Wolle Gott, es würde etwas aus mir, schreibt sie am 1. Dezember 1902 in ihr Tagebuch und distanziert sich damit von ihrem Lehrer Fritz Mackensen. Ihr zunächst befremdlicher Satz, alles in Runenschrift darstellen zu wollen, meint nicht das äußere Abbild, sondern das Wesentliche, was hinter den Erscheinungen aufleuchtet. Dieses Programm verfolgt sie von Anfang bis Ende mit großer Konzentration und Konsequenz. Sie verwirklicht damit einen Ausspruch ihrer verehrten Lehrerin in Berlin, Jeanne Bauck, den sie in ihrem Album, einer Sammlung für sie wichtiger Zitate, notiert hat: Von allem, was man zeichnet, muß man eine Vorstellung in sich fühlen. Je lebhafter und kräftiger diese Vorstellung, desto künstlerischer das Resultat.[2] Dann sagt sie über sich selbst: Wenn ich überhaupt Begabung zur Malerei habe, wird im Porträt doch immer mein Schwerpunkt liegen, das habe ich wieder gefühlt. Das Schönste wäre, wenn ich jenes unbewußte Empfinden, was manchmal leicht und lieblich in mir summt, figürlich ausdrücken könnte.
In diesem Brief an die Eltern, den sie um den 10. Juni 1898 herum schreibt, bleibt sie noch vorsichtig und will diese Entwicklung kommenden Jahrzehnten überlassen, nicht ahnend, dass sie bereits in den nächsten Jahren tragend wird. Noch schreibt sie von ihrem Malkater, der sie gelegentlich heimsucht, aber auch schon, dass sie die Zeiten herbeisehnt, wenn ich das erst kann, was ich jetzt möchte (25. November 1898). Im Tagebuch aus dieser Zeit steht: Mich befriedigt das Zeichnen nicht. Ich bin atemlos. Ich will immer weiter, weiter. Ich kann die Zeit nicht erwarten, bis ich was kann.[3] Wie ein Mantra wiederholt sie es, eine endlose Selbstbeschwörung: Und ich lechze nach mehr, mehr, unermüdlich will ich danach streben mit allen meinen Kräften. Auf daß ich einst etwas schaffe, in dem meine ganze Seele liegt. (Tagebuch, 24. Januar 1899) Immer wieder gelingt es ihr in der zuspitzenden Direktheit ihrer Briefe und Tagebücher, Zusammenhänge aufzudecken, die erstaunlich sind. Ihr gelingen psychologische Einsichten und treffende Formulierungen. Ein Eintrag unter dem Eindruck ihrer Lektüre des «Zarathustra» von Friedrich Nietzsche lautet: Dies Umschaffen und Neuschaffen der Werte! Dies Predigen gegen die falsche Nächstenliebe und Aufopferung seiner selbst. Falsche Nächstenliebe lenkt ab vom großen Ziele.[4]
Kraft, unermüdliches Streben, das Anerzogene, Geschauspielerte zu vermeiden und zu einer vibrierenden Einfachheit zu finden, das ist ihr Potenzial. Indem sie an sich arbeitet, arbeitet sie für ihre Kunst. Ihr wird deutlich, dass Einsamkeit für sie notwendig ist: Hier in der Einsamkeit reduziert sich der Mensch auf sich selber. […] Ich arbeite an mir. Ich arbeite mich um, halb wissentlich, halb unbewußt. Ich werde anders, ob besser? Jedenfalls vorgeschrittener, zielbewußter, selbständiger. […] In mir fühle ich es wie ein leises Gewebe, ein Vibrieren, ein Flügelschlagen, ein zitterndes Ausruhen, ein Atemanhalten: wenn ich einst malen kann, werde ich das malen. (Tagebuch, 19. Januar 1899)
Ausgerechnet der Landschaftsmalerei, dem Schwerpunkt fast aller anderen Maler Worpswedes, vor allem ihres Ehemannes Otto Modersohn, hat Paula Modersohn-Becker weniger eigenständige Bedeutung zugemessen, auch wenn ihr ganz eigene und großartige «Landschaftsporträts» gelungen sind. Bei ihr tritt die Landschaft nach 1902/03 in den Hintergrund, begleitet eine Figur zwar als tragende Umrahmung, aber ist, je weiter ihr Werk fortschreitet, immer weniger darin präsent. Das Perspektivische der Landschaft ist nach Aussage Paula Modersohn-Beckers für sie zu naturalistisch, sie will eine den äußeren Erscheinungen zugrunde liegende innere Ordnung darstellen.
Sie malt – außer einer großen Anzahl von Stillleben – vor allem Menschen. Alte, Kinder, Mädchen, ihre Schwester, die Freundin Clara – und am eindringlichsten sich selbst. Das Interesse für sich selbst wurde ihr oft vorgeworfen. In der Familie galt sie als egoistisch, weil sie alles ihrer Kunst und damit ihren eigenen Wünschen unterordnete.
Mit ihren Selbstbildnissen stellt sie sich in eine lange künstlerische Tradition. Das Rätsel, das seine Existenz dem Menschen aufgibt, versucht sie in Spiegeln zu ergründen, auf eine Leinwand zu bannen. Der hohe Anteil an Selbstbildnissen, die Beschäftigung mit dem eigenen Ausdruck, der eigenen Gestalt – als eine der ersten Künstlerinnen malt sie sich selbst als Akt –, erklärt sich vielleicht durch die mangelnde Anerkennung der anderen. So wurde die Künstlerin auf sich selbst verwiesen. So konnte sie unabhängig von Kollegen- und Publikumseinflüssen ganz aus sich selbst heraus arbeiten und allenfalls Einwirkungen gelten lassen, die ihrem Wesen entsprachen. Gerade weil ihre Kunst noch nicht im Interesse einer Öffentlichkeit stand, könnte ihr diese Entwicklung möglich geworden sein. Sie hielt sich abseits, verbarg ihre Passion vor der Öffentlichkeit, sogar vor Freunden, und schulte dabei ihr Urteilsvermögen, nahm das auf, was ihr selbst entsprach: Paul Cézanne, damals noch nicht auf der Höhe seines späteren Ruhms, wurde für sie nicht nur Vorbild, sondern ein Gleichgesinnter. Gerade weil Familie und Kollegen, außer Otto Modersohn, der sie uneingeschränkt anerkannte, sie nicht ernst genug nahmen, gelang ihr durch ungeheure Zielstrebigkeit der Entwicklungssprung in die Moderne, in die Vorstufen eines flächigen, bei aller Figürlichkeit fast schon abstrakten Ausdrucks. So vorbereitet, konnte die plötzliche und unerwartete Anerkennung durch Bernhard Hoetger in Paris 1906 eine letzte, exzessive Schaffensphase auslösen.
hat der modernen Kunst entscheidende Impulse gegeben. Er war ein Jugendfreund des Schriftstellers Émile Zola, der sich für die Impressionisten einsetzte. An deren Ausstellungen nahm auch Cézanne teil, zog sich aber dann von ihnen zurück. Unabhängig durch das väterliche Vermögen, lebte er zurückgezogen in seinem Geburtsort Aix-en-Provence. In seinem Spätwerk dominieren absolute Farben und Kontraste bei Vernachlässigung der Perspektive. Er gilt als eines der Vorbilder von Paula Modersohn-Becker, auch wenn ihr Mann lieber Vincent van Gogh nennt, den sie aber nirgends erwähnt.
Immer wieder wird in Katalogbeiträgen und Biographien betont, dass Modersohn-Becker alles, was sie in ihrer Kunst auszusagen vermochte, in ihren schriftlichen Zeugnissen bei weitem nicht erreicht. Schon Rilke gab dies als Grund an, als er sich weigerte, die Herausgeberschaft für ihre Tagebücher und Briefe zu übernehmen, die ihm die Mutter Mathilde Becker 1916 angetragen hatte. Er war dagegen, diese schlichten Alltagszeugnisse überhaupt zu veröffentlichen. Die Familie Becker gab ihm als Erstem den schriftlichen Nachlass zu lesen, natürlich mit der Absicht, durch einen berühmten Herausgeber der Verstorbenen eine größere Wirkung zu sichern. Schließlich war er einer der engsten Freunde, der wichtigste Schriftsteller, mit dem sie in enger Verbindung gestanden hatte.
Wie immer, wenn es um Paula Modersohn-Becker ging, verhielt Rilke sich zwiespältig. Ihrem Bruder Kurt Becker gegenüber hatte er nach der Lektüre einiger veröffentlichter Ausschnitte in der «Güldenkammer» 1913, einem Bremer Journal, den Wunsch geäußert, alles Hinterlassene der Malerin veröffentlicht zu sehen.[5] Dennoch lässt er das Manuskript zunächst ungeöffnet liegen. Und dann kommt er, schon nach einer ersten Durchsicht gemeinsam mit seiner Frau Clara, zu dem Entschluss, sich an der Herausgabe nicht zu beteiligen. Zwar würde vieles Eigentümliche mitgeteilt, aber «nur das Vorbereitete in ihr, nicht ihre Freiheit, nicht ihr großes leistendes Herz, nichts von dem steilen Aufstieg, der in den Stufen ihrer Arbeit sicher bewiesen und erhalten bleibt», so lautete seine Antwort an die Mutter Becker vom 26. Dezember 1916.[6] Die Nachwelt habe zwar ein Recht auf die Äußerungen von Kunstschaffenden, aber er führt Vincent van Gogh an und stellt dessen Briefe und Tagebücher als anspruchsvolles Beispiel dar, dem Paula Modersohn-Becker nicht standhalten könne. Völlig den Charakter ihrer Aufzeichnungen verkennend, die sehr wohl auch einiges Erhellende zu ihrem künstlerischen Werdegang beitragen, hat er so einen Grund, sich der Arbeit und damit auch einer nochmaligen Stellungnahme zu enthalten. Für ihn ist mit seinem gerühmten «Requiem für eine Freundin» – für Paula Modersohn-Becker ein Jahr nach ihrem Tod vom 31. Oktober bis 2. November 1908 geschrieben – alles gesagt.[7]
Er schreibt der Mutter zum Abschluss: «Ich bin, so stark wie ich es nur je war, überzeugt zu Paula Modersohns Gestalt und im selben Augenblick davon ausgeschlossen, der Herausgeber jener Schriften zu sein, die Sie mir abwartend in die Hände gelegt haben. Denn wie sollte ich mich entschließen können, während ihr größeres Bild in mir aufsteigt, ein minderes, vorläufiges zusammenzustellen und zu vertreten.»[8]
Natürlich hätte er es erreichen können, dass Leser dieses größere Bild ebenfalls erkennen. So kann er sich darauf zurückziehen, dass aus ihrer letzten Zeit kaum Aufzeichnungen vorhanden sind, und die wären es vielleicht eher wert gewesen, veröffentlicht zu werden.
An die nicht zur Veröffentlichung gedachten Tagebücher und Briefe eines Autors oder Künstlers werden niemals dieselben Maßstäbe angelegt wie an seine Kunst. Deshalb teile ich nicht das Argument, dass durch die Beliebtheit ihrer schriftlichen Hinterlassenschaft «ihre Malerei bis in die heutigen Tage mehr verdunkelt als erhellt» wurde.[9] Kaum ein Leser hat den Anspruch, dass die Tagebücher und Briefe Modersohn-Beckers mehr sein sollen als ein Zeitdokument, eine Ergänzung zum Werk. Und wenn einige Betrachter sich durch die Lektüre dem malerischen Werk intensiver widmen als vorher, ist das nur von Vorteil. Umgekehrt ist auch nicht gesagt, dass diejenigen Leser, die sich nur von den Schilderungen aus dem Leben der jungen Frau ansprechen lassen oder empfindsam mitleiden, ihre malerischen Werke dagegen vernachlässigen, ohne die Herausgabe der Schriften besseren Zugang zu ihrer Kunst hätten. Keineswegs würden heutige Leser dem Urteil des misogynen Kunsthistorikers Richard Hamann zustimmen, der überhaupt kein Verständnis für die Malerin hatte, alles als «das rührend Häßliche» bezeichnete und sarkastisch behauptete, dass man zu den Bildern «immer Briefe und Tagebücher vorlesen muß, damit das, was sich mit der Hülle reiner Kunst gibt, vollends in Gemüt schwimmt».[10] Niemals hat Paula Modersohn-Becker sich so verschwommen ausgedrückt wie dieser Kritiker, im Gegenteil. Eine anspruchsvolle, heute verlorene Briefkultur gilt es zu entdecken. Gewisse sprachliche Schwächen wie eine übertriebene Vorliebe für Diminutive – es häufen sich -chen und -lein – müssen der Spontaneität des Schreibens und zeitgeschichtlichen Einflüssen zugerechnet werden. Vor allem bei delikaten Sachverhalten drückt sie sich so aus. Beispielsweise bittet sie ihren Mann im Juli 1907, ihr Hemdlein und Höslein nach Holzhausen zu schicken, wo sie sich gerade bei Hoetgers aufhält.
Zum Glück besaß Rilke die Fähigkeit, hinter Hamanns «Hülle» zu blicken, aber den entscheidenden Augenblick für echte Hilfe hat er immer verpasst. Zuerst in Worpswede mit seiner überstürzten Abreise ohne Erklärung; dann in Paris, wo er die Künstlerin, die sich gerade aus ihrer Ehe und von Worpswede lösen wollte, zwar besuchte, sich sogar von ihr hat porträtieren lassen, aber sich nicht in die Ehegeschichte einmischen wollte, als Otto Modersohn in ihr Pariser Atelier kam. Er verschwand einfach und gab Arbeit vor. Die von ihr erbetene gemeinsame Reise mit seiner Familie im Sommer 1906 sagte er mit fadenscheinigen Gründen ab. Könnte es nicht sein, dass Rilke vor allem deshalb zögerte, weil seine Rolle in ihrem Leben voller Unklarheiten war? Wem sonst als einem Mann, dessen tiefere Gefühle sie ahnt, schreibt eine Frau so zartfühlend wie Paula Becker im Brief vom 12. November 1900, als sie ihm von ihrer Liebe zu Otto Modersohn berichtet: Sie wissen davon, nicht wahr. Es ist schon lange; schon vor Hamburg. Ich habe Ihnen nicht davon gesprochen. Ich dachte, Sie wüßten. Sie wissen ja immer und das ist so schön.
Nach Rilkes Absage scheint es nicht leicht gewesen zu sein, jemanden zu finden, der sich der Briefe und Tagebuchblätter annahm. Anton Kippenberg vom Insel-Verlag wollte die Herausgabe ebenso wenig wagen wie der Dichter Rudolf Alexander Schröder, der zunächst nichts anderes darin erkennen konnte als Jungmädchenaufzeichnungen und das Briefkonvolut wortlos der Familie zurückgab.[11]
Worin aber liegt dann der große Erfolg der schriftlichen Hinterlassenschaft der jungen Malerin? Nur in den Einblicken in die Überschwänglichkeiten eines Jungmädchenlebens um die Jahrhundertwende? Nur im sentimentalen Nachempfinden? Sicherlich fällt auf, dass die Briefe und Tagebücher auch von Menschen gelesen und geschätzt werden, die mit der Kunst Paula Modersohn-Beckers nicht viel anfangen können. Könnte es trotzdem nicht doch sein, dass die ansprechende Unmittelbarkeit der Texte bis in die Tiefe ihrer künstlerischen Ausdruckskraft führt? Die biographische Neugier, viel gescholten und doch von großer Wirkung, gibt den Weg frei für tiefere Erkenntnisse. Das empfindet wohl auch Rilke, der nach der Lektüre der ersten veröffentlichten Schriften in der «Güldenkammer» 1913 an den Bruder Kurt schreibt: «[…] wen von denen, die sie kannten, wird’s nicht aus diesen Blättern heraus angerührt haben und ergriffen […]. Denn sie, in diesen hingerissenen Augenblicken, die ihr Leben sind, sprach wie für immer, stellte sich mit jeder bewegt oder müde, zweifelnd oder froh hingeschriebenen Zeile in ein Verhältnis zum Ganzen.»[12]
1922 bekommt Rilkes Haushälterin Frieda Baumgartner zu Weihnachten ein Buch geschenkt, das auch Rilke interessiert: «Briefe und Tagebuchblätter Paula Modersohn-Beckers», noch unvollständig herausgegeben von Sophie Gallwitz, einer Bremer Journalistin. Rilke las und schrieb an seine Frau Clara: «Du könntest kaum erraten, welcher Lektüre ich, mit ganz vertieftem Eifer, diese letzten Abende gehört habe. Meine Haushälterin bekam Paula Beckers Briefe und Tagebücher geschenkt, die ich doch zu kennen glaubte; aber diese, offenbar nach und nach ziemlich ergänzte Edition (es ist die fünfte Auflage, die mir vorliegt) gibt ein so viel geschlosseneres und zusammenhängenderes Bild ihres erwachsenen Wesens, daß die Lesung für mich wie neu und unendlich ergreifend war.» Rilke gab der Haushälterin das Buch zurück, von dem er zunächst geglaubt hatte, es sei für ihn, und schrieb ihr hinein: «Lesen Sie’s mit Freude und Andacht, es handelt von einem zum Reinsten entschlossenen Leben und legt dafür Zeugnis ab in seiner einfachen, wahrhaftigen Art!»[13]
Nicht nur für die, die sie kannten, scheint dies zu gelten, sondern auch für viele Hunderttausende Leser. Die zuerst 1917 veröffentlichten «Briefe und Tagebuchblätter», langsam mit jeder neuen Ausgabe vervollständigt, sind 1979 in einer wissenschaftlichen Edition erschienen, die von Günter Busch und Liselotte von Reinken erarbeitet wurde. Ein Teil der Briefe liegt heute im Original leider nicht mehr vor. Sie lassen sich nur anhand der früheren, nicht immer zuverlässigen Ausgaben rekonstruieren. Die Originale der Tagebücher und der Briefe an die Eltern wurden im Zweiten Weltkrieg nach Bunzlau in Schlesien ausgelagert und sind dort verlorengegangen. Die unterschiedlichen Ausgaben stimmen nicht immer im Wortlaut überein, sie sind also stilistisch überarbeitet worden. Auch wurden gelegentlich unter einem Datum verschiedene Briefe zusammengefasst.[14]
Die ersten Aufzeichnungen des jungen Mädchens werden sich kaum unterscheiden von vielen Backfischbriefen. Interessant ist vor allem, was sie über Malerei äußert. Immer gilt zu bedenken, dass Paula Becker wusste, dass das geschriebene Wort nicht ihr eigentliches Metier war. Das wird ihr schon vom Vater bestätigt, der ihr am 22. Oktober 1892 nach London schreibt: «Du […] hast auch nicht die literarische Ader Deiner Mutter; schade! ich wünschte es gerne.» Das Gefühl, in ihren Briefen manchmal nicht genau das sagen zu können, was wichtig ist, weshalb sie es dann lässt, ist ihr vertraut. Das dumme Schreiben nennt sie es, und: Ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, ich paß nicht gut zu Briefen, heißt es an den Bruder Kurt (26. April 1893). Ebenfalls an ihn: Nun hätte ich ja schreiben können, aber weißt Du, die lange Pause hatte meine Feder ganz ausgetrocknet. Ich konnte nicht schreiben. (27. April 1895) Es muss ihr eben aus dem Herzen kommen (an die Mutter, 1. November 1892).
Vor allem in ihren frühen Briefen finden sich viele für junge Menschen typische Selbstanklagen. Eine Lücke klafft zwischen dem enormen Ehrgeiz, etwas im Leben schaffen zu wollen, und den selbstkritischen Demutsbezeugungen gegenüber anderen. Sie bezeichnet sich als ungeschickt dem Vater gegenüber, beklagt ihren kleinen Wuchs gegenüber der Großmutter und der Mutter gegenüber, dass sie nicht imstande ist, mit ihren Briefen Freude zu bereiten. Ihr Verstand ist angeblich klein, ihre Briefe sind nichts wert, und im Vergleich zu einer schönen Tante fühlt sie sich ganz von der Natur zu kurz gekommen (an die Schwester Milly, 25. November 1892). Manchmal ist ihre Selbsterkenntnis erstaunlich, vor allem in den Briefen an die Geschwister. Der Umgang miteinander in familiärer Enge hat das Verhältnis nicht getrübt, sondern gefestigt. Aber wie mit Geschwistern sollte niemand mit anderen Menschen umgehen, und so erklären sich vielleicht an einem frühen Beispiel die Schwierigkeiten, die sie im sozialen Kontakt vor allem in Worpswede erleben sollte. Sie schildert ihrem Bruder Kurt in einem Brief vom 26. April 1893, wie die Mutter anregt, einen Bekannten beim Kaffeetrinken zu fragen, ob sie ihn nicht zeichnen könne. Nun habe ich es an mir, die Leute nicht gerade zu idealisieren, vielmehr das Gegenteil. Der Bekannte entschwindet, enttäuscht über das Ergebnis, und Paula Becker beschließt, sich lieber mit ihrem eigenen teuren Spiegelbild abzugeben. Hier deutet sich an, was auch später im Urteil über sie lange Zeit bestimmend sein wird: Sie enttäuscht die Menschen, die Wahrheit und zuspitzende Ironie nicht vertragen können.
Bemerkenswert ist es, wie sie später in den ersten Briefen an Rilke zu einem besonderen Ton findet. Als gäbe sie sich im Bewusstsein, einem Dichter zu schreiben, besondere Mühe in poetischen Formulierungen wie: Nun bin ich nach Hause gekommen durch den feuchten Abend bei Birken vorbei, in der Ferne der schummernde Schatten des Kieferngebüsches (an Rilke nach einem Besuch bei Clara Westhoff, 1. Dezember 1900). Schon am 12. November hatte sie ihm bekannt, dass sie keine Norm anerkennen will, möchte ihm das aber lieber mündlich erklären als schriftlich: Das kommt, weil Sie so schön mit den Augen hören können. Dann empfinde ich gar nicht die Lücke in mir, wo bei andern Leuten die Logik und die Klarheit sitzt. Im Schreiben da gähnt mir diese Lücke oft schwarz entgegen.





























