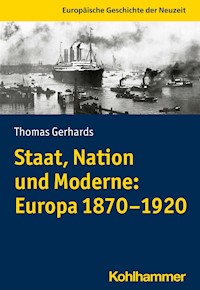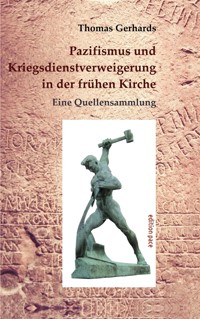
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: edition pace
- Sprache: Deutsch
Die hier ohne Änderungen erneut edierte Quellensammlung "Pazifismus und Kriegsdienstverweigerung in der frühen Kirche" kursierte 1984 als Geheimtipp unter friedensbewegten Christenmenschen und wurde dann aufgrund der starken Nachfrage bis 1991 vom deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes in sechs Auflagen verbreitet, versehen mit einem Vorwort von Konrad Lübbert. Im einleitenden Teil erläuterte der Bearbeiter Thomas Gerhards vor vier Jahrzehnten seine Intention: "Eine der großen Fragen, mit denen ich mein Studium der Theologie begann, lautete: Wie kommt es, dass Christen, denen Jesus die völlige Gewaltlosigkeit vorlebte ..., nicht klarer gegen das immer erschreckendere Wettrüsten Stellung beziehen? Müsste seine Kirche die Haltung Jesu nicht deutlicher herausstellen? Ist, angesichts der heutigen Situation, die Kriegsdienstverweigerung für eine/n Christin/en nicht die notwendige Konsequenz? Ich entdeckte, dass die frühe Kirche viel entschlossener die gewaltlose Botschaft Jesu zu leben suchte. Aus zweijähriger Beschäftigung mit dem Thema erwuchs diese Quellensammlung, da ich immer wieder feststellte, wie ... unzureichend das Wissen um die Haltung der frühen Christen zu Krieg und Kriegsdienst war. - Die Dokumente aus den ersten drei Jahrhunderten des Christentums sind zu bedeutsam, als dass man sie - wie die herrschende Kirchenhistorie - mit wenigen Sätzen abtun und dann zum 'Gerechten Krieg' übergehen kann." edition pace. Regal: Pazifismus der frühen Kirche 2. Herausgegeben von Peter Bürger, in Kooperation mit: Internationaler Versöhnungsbund (deutscher Zweig), Lebenshaus Schwäbische Alb, Ökumenisches Institut für Friedenstheologie, Solidarische Kirche im Rheinland.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Zur vorliegenden Neuedition (2024)
Einleitung (1984) | Konrad Lübbert
Mein erkenntnisleitendes Interesse | Thomas Gerhards
1. | Die Christen – Friedensbewegung der Antike?
2. | Motive für die Ablehnung des Kriegsdienstes
3. | Kriegsdienstverweigerer
3.1 Der Hl. Maximilianus
3.2 Der Hl. Marcellus
3.3 Der Hl. Julius
3.4 Der Hl. Ferrutius von Mainz
3.5 Tarachus
3.6 Ferreolus
3.7 Ein wahrer Schatz
3.8 Nereus und Achilleus
3.9 Sankt Martin von Tours
3.10 Der Hl. Victrix, Bischof von Rouen
3.11 Weitere Soldatenmärtyrer
4. | Kirchenväter für den Frieden
4.1 Justin
4.2 Irenäus von Lyon
4.3 Tatian
4.4 Tertullian – der Antimilitarist
4.5 Klemens von Alexandrien
4.6 Traditio Apostolica des Hippolyt
4.7 Origenes – der Radikale
4.8 Cyprian von Karthago
4.9 Arnobius
4.10 Lactanz – der Kriegsgegner
4.11 Die Synode von Arles
4.12 Basilius
4.13 Paulinus von Nola
4.14 Augustinus und der ‚gerechte Krieg‘
5. | Literaturverzeichnis
a) Quellentexte
b) Sekundärtexte
ZUR VORLIEGENDEN NEUEDITION | 2024
Die hier ohne Änderungen erneut edierte Quellensammlung „Pazifismus und Kriegsdienstverweigerung in der frühen Kirche“ kursierte 1984 als ‚Geheimtipp‘ unter friedensbewegten Christenmenschen und wurde dann aufgrund der starken Nachfrage bis 1991 vom deutschen Zweig des Internationalen Versöhnungsbundes in sechs Auflagen verbreitet – versehen mit einem Vorwort des damaligen VB-Vorsitzenden Konrad Lübbert (1832-1999).1
Der Bearbeiter Thomas Gerhards (Jg. 1959) ist Schreiner, Dipl.-Theologe und Sozialwissenschaftler (Studium in Bonn und Würzburg). Zu seinem Weg gehören langjährige berufliche Tätigkeiten u. a. in der Erwachsenenbildung und der kirchlichen Entwicklungszusammenarbeit. Gegenwärtig engagiert er sich besonders bei Protesten am Atomwaffenstandort Büchel und in dem dort regelmäßig zusammenkommenden Kreis des Friedensgebets.
Thomas Gerhards hatte während des Studiums festgestellt, „wie unbekannt und unzureichend das Wissen um die Haltung der frühen Christen zu Krieg und Kriegsdienst war“ (→S. 18), denn sogar in den kirchengeschichtlichen Lehrbüchern herrschte diesbezüglich weithin ‚Stillschweigen‘. Seine kompakte Broschüre sorgte gründlich für Abhilfe und erleichtert es uns nun vier Jahrzehnte später, innerhalb der Reihe ‚edition pace‘ ein ‚Regal zum Pazifismus der frühen Kirche‘ zunächst mit schon vorhandenen Arbeiten2 aufzubauen. Bezeichnender Weise beginnt Gerhards Zusammenstellung mit Zeugnissen zur frühchristlichen Praxis (Kriegsdienstverweigerung), um
sodann in einem weiteren Durchgang die theologischen Schriftsteller der Alten Kirche zu Wort kommen zu lassen. Alle zentralen Aussagen der Apologeten und Kirchenväter werden berücksichtigt. Einmütig finden wir in ihnen den Gegensatz von Christsein und Kriegshandwerk bezeugt. Bis heute kann niemand aus der Zeit vor dem Soldatenkaiser Konstantin, der sich unter dem ‚Zeichen Christi‘ eine neue (bzw. die alte) Religion der Waffenrüstung und des Siegens zurechtlegen wird, gegenteilige Voten von christlichen Theologen anführen.
Die Behauptung, es sei bei der frühchristlichen Kriegsverweigerung lediglich um so etwas wie eine „kultische Reinheit“ der Getauften unter den Bedingungen eines heidnischen Militärwesens gegangen, ist auch nach eineinhalbtausend Jahren noch nicht verstummt. Wie absurd diese ideologische Konstruktion jedoch ist, können alle Fragenden anhand des vorliegenden Quellenbandes selbst erkunden. Schon JUSTIN († 165 n. Chr.) und IRENÄUS VON LYON († um 200 n. Chr.) bringen die Perspektive der Propheten Israels ins Spiel: die Freundinnen und Freunde Jesu verstehen sich nämlich als Vorhut jener neuen Menschheit, die das zerstörerische ‚Zivilisationsprogramm Krieg‘ überwindet (→S. 61-62). – Welch ein Kontrast zu den bürgerlich dressierten Kirchentümern unserer Tage, die lediglich an Weihnachten und ganz unverbindlich vom ‚Heiland aller Welt‘ singen. – Noch LAKTANZ (→S. 82-84) weiß Ende des 3. Jahrhunderts, dass es den Christen allzeit verwehrt ist, sich an der Tötung eines Menschen in irgendeiner Weise zu beteiligen, und er entlarvt vor der ‚staatskirchlichen Wende‘ sogar die Militärdoktrinen zur Sicherung der wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen der eigenen Nation (bzw. des ‚richtigen‘ imperialen Blocks).
Wir werden im weiteren Verlauf unseres Bibliothekaufbaus einige neuere – z. T. leider unsachgemäß aufgebauschte – Forschungsergebnisse (z. B. frühe Präsenz von Christen an Militärstandorten) und den aktualisierten Stand der Bibliographie zum Thema berücksichtigen. Zu grundlegenden Revisionen besteht keinerlei Anlass. Was Thomas Gerhards in seiner Gesamtschau der altkirchlichen Zeugnisse darbietet, vermittelt noch immer alle bedeutsamen Primärquellen (Kernbestand) und Aspekte.
Dezember 2024 | Peter Bürger
1 Grundlage unserer Edition: Thomas GERHARDS (Hg.), Pazifismus und Kriegsdienstverweigerung in der frühen Kirche. – Eine Quellensammlung. (Mit einer Einleitung von Konrad Lübbert). 6., überarbeitete Auflage. Uetersen: Internationaler Versöhnungsbund – deutscher Zweig 1991. [67 Seiten] | Vollständig auch enthalten in: Thomas NAUERTH (Hg.), Handbibliothek Christlicher Friedenstheologie (= Sonderband der Digitalen Bibliothek). Berlin 2004.
2 Bereits erschienen: Adolf von HARNACK, Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldatenstand in den ersten drei Jahrhunderten. Mit einem einleitenden Essay von Franz Segbers. (edition pace | Regal: Pazifismus der frühen Kirche 1). Herausgegeben von P. Bürger. Norderstedt 2024. (ISBN: 978-3-7597-6020-3). – In Vorbereitung: Egon SPIEGEL, Gewaltverzicht. Grundlagen einer biblischen Friedenstheologie. Dritte Auflage (edition pace | Regal: Pazifismus in der frühen Kirche).
EINLEITUNG | 1984
„Wenn alle es machen würden wie die Christen“, so schrieb der Platoniker Celsus im dritten Jahrhundert kritisch über die Kriegsdienstverweigerung der Christen, „so wäre der Kaiser bald allein und vereinsamt, und die Dinge auf Erden würden in kurzem in die Hände der wildesten und abscheulichsten Barbaren geraten; darum sollten die Christen dem Kaiser den möglichsten Beistand gewähren, ihn in der Erfüllung der Obliegenheiten seines Amtes unterstützen, für ihn die Waffen tragen und, wenn die Not es fordert, für ihn zu Felde ziehen und seine Truppen anführen“.
Auf diese sehr aktuell anmutende und oft in der Geschichte so oder leicht abgewandelt vorgetragene Argumentation für den Kriegsdienst antwortete derzeit der Christ Origenes im Blick auf sich und seine Glaubensbrüder: „Wir sind gekommen, den Ermahnungen Jesu gehorsam, die Schwerter zu zerbrechen, mit denen wir unsere Meinungen verfochten und unsere Gegner angriffen, und wir verwandeln die Speere, deren wird uns früher im Kampf bedient haben, in Pflugscharen; wir lernen nicht mehr, den Krieg zu führen, nachdem wir Kinder des Friedens geworden sind durch Jesus, der unser Führer anstelle der heimischen geworden ist.“
Die Argumente des Nicht-Christen Celsus haben sich über viele Jahrhunderte hinweg bei der Mehrheit der Christenheit durchgesetzt, nicht die Haltung des Christen Origenes. Wie kam es dazu?
Origenes ruft die prophetische Verheißung des Alten Testamentes in Erinnerung, wie sie von Jesaja und Micha ausgesprochen wurde: „Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert, Volk gegen Volk, und übt nicht mehr für den Krieg.“ Heute stehen diese Worte auf dem Denkmal vor dem UNO-Gebäude in New York, und der Philosoph Ernst Bloch schreibt dazu: „Hier ist das Urmodell der pazifistischen Internationale“. In Jesus ist die Verheißung des alten Bundes zur Erfüllung gekommen, und Gott wird im Neuen Testament der „Gott des Friedens“ genannt. Jesus lehnte die Anwendung von Gewalt oder die Beteiligung daran ab und nahm, als er als Verbrecher am Kreuz hingerichtet wurde, lieber das eigene Leiden hin, als daß er es anderen zugefügt hätte.
Die Aussagen der Bergpredigt, die er seinen Jüngern als Orientierung gegeben hatte, hatten eine nachhaltige Wirkung auf die frühe Kirche der ersten Jahrhunderte. Von den Christen der frühen Zeit ist keinerlei Beteiligung an gewaltsamen Handlungen überliefert; sie waren dagegen oft das Opfer von Gewalt, sie waren Verfolgung, Gefängnis, Folter und Tod ausgesetzt. Die Preisung der „Friedensmacher“ als Kinder Gottes durch Jesus prägte deutlich das Bewußtsein der Christen in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Nicht nur der Beruf des Gladiators, des Astrologen oder der Prostituierten zählte damals zu den für Christen verbotenen Berufen, sondern ebenfalls der Beruf des Soldaten. Wer Christ ist, durfte nicht mehr Soldat werden – dies betonen eine Reihe von Kirchenvätern der damaligen Zeit. Das christliche Tötungsverbot spielte eine entscheidende Rolle bei der Verweigerung des Kriegsdienstes.
Der Wandel trat ein, als sich die Machtverhältnisse im römischen Imperium änderten, als aus Diskriminierung und Verfolgung der Christen ihre Duldung und schließlich sogar ihre besondere Förderung wurde. Die erste große abendländische Synode der neuen Zeit, der konstantinischen Ära, die in Anwesenheit von Kaiser Konstantin 314 in Arles tagte, machte das Umschwenken der Kirche deutlich. Die Synode dekretierte zwar noch – „Mücken seihend und Kamele verschluckend“, wie man später feststellte, – in althergebrachter Weise, daß Wagenlenker und Schauspieler, solange sie ihre Beschäftigung nicht aufgäben, nicht Mitglieder der Kirche sein könnten; sie belegte jedoch plötzlich die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der höchsten Kirchenstrafe, nämlich der Exkommunikation. Die Kirche sah sich dem Imperium Caesaris verpflichtet. Rund hundert Jahre später schließlich, im Jahr 416 stellte eine Verordnung des Kaisers Theodosius II fest, daß Nichtchristen nicht nur vom höheren Verwaltungsdienst, sondern auch vom Kriegsdienst auszuschließen seien.
Staat und Kirche hatten sich im engen Bündnis miteinander vereint. Die Christen galten als die sicheren Stützen der bestehenden Lebensordnung, und der christliche Glaube sollte zum Garanten für die Einheit des Reiches werden. Die Kirche andererseits delegierte die Verantwortung über Krieg und Frieden an die inzwischen „christlich“ gewordene Obrigkeit und suchte einen Ausgleich zwischen der bestehenden Lebensordnung des weltlichen Imperiums und dem unmittelbaren Anspruch der Bibel, indem sie die Lehre vom „gerechten Krieg“ aufnahm, von den Zwei Reichen oder von anderen Symbiose-Modellen zwischen geistlichem Anspruch und politischer Wirklichkeit. (Nur im Ausschluß der Priester vom Waffendienst und in einigen kirchlichen Subkulturen sowie später bei den Friedenskirchen blieb die Erinnerung an die ursprüngliche christliche Haltung bewahrt.)
Im frühchristlichen und friedenskirchlichen Modell wird von den Christen die Teilnahme an den Strukturen der Macht und der Gewaltausübung verweigert und eine alternative Gemeinschaft aufgebaut, die unmittelbar von der Orientierung auf die Nachfolge Jesu lebt. Eine solche Gemeinschaft hat die Funktion des Salzes in der Gesellschaft, ihre politische Wirkung ist indirekter Art; sie wirkt nicht unmittelbar durch die gesellschaftlichen Institutionen oder ihre politischen Träger. Das großkirchliche Modell dagegen, das man auch das konstantinische nennen kann, sieht die Christen an den Hebeln der Macht. Es ist nicht das Modell der Verweigerung, sondern das der Teilnahme. Es wird dabei der Versuch gemacht, die Macht zu zähmen, damit sie in verantwortbarer Weise dem Willen Gottes gerecht wird. Auch innerhalb dieses Modelles werden zwar Grenzen für die Mitarbeit an der Macht gezogen, jenseits derer dem Christen der Widerstand geboten ist. Doch in der Praxis ist es weithin zur bloßen Anerkennung bestehender Machtverhältnisse und zu einer nachträglichen Rechtfertigung von Gewaltausübung geworden.
Die bestehenden Herrschaftsverhältnisse und die exekutierende Gewalt, als Sonderbereich mit eigenen Gesetzen gegenüber dem unmittelbaren Herrschaftsbereich Gottes anerkannt, entwickelten ihre Eigengesetzlichkeiten. Im 19. Jahrhundert wurde statt vom Reich Gottes nur noch vom Reich gesprochen, anstatt von Kirchen und Christenheit sprach man von Volk und Nation, statt für die Ehre Gottes meinte man, für die Ehre der Nation kämpfen zu müssen, aus dem Heiligen wurde das Heilige Vaterland, und anstelle Gottes, des Vaters Jesu Christi, sprach man von dem Gott, der Eisen wachsen läßt. Die Aussagen christlichen Glaubens wurden voll absorbiert von säkularen Begriffen weltlicher Herrschaftsausübung. So endete das konstantinische Modell.
Zwei Geschehen bilden den Schlußpunkt, der den Beginn des neuen Abschnittes dringend gemacht hat: Auschwitz und Hiroshima. Das eine Ausdruck eines menschverachtenden und brutalen Nationalismus, der sich auch zeitweilig noch eine christliche Verbrämung umhängte, das andere Ausdruck einer menschenverachtenden und massenvernichtenden Waffentechnik, die ebenfalls dem Namen „christlich“ verbunden war. (Manche Japaner nennen noch heute die Atombombe die „christliche Bombe“, weil sie von Christen entwickelt, von Christen gutgeheißen und von Christen eingesetzt wurde.) Das eine verdeutlicht, daß wir als Christen unsere politische Verantwortung nicht einfach zur Obrigkeit hin delegieren können, sondern daß die Gewissensentscheidung des einzelnen auch im politischen Raum unmittelbar gefordert ist. Das andere macht deutlich, daß die Theorien des „gerechten Krieges“ in sich selbst zerbrochen sind und daß kein Bereich mehr, auch nicht der von Waffenentwicklung und Krieg, von Christen als eigenständiger Sonderbereich neben oder außerhalb der Herrschaft Gottes anerkannt werden kann.
1948 auf der ersten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Amsterdam erklärten daher die versammelten Kirchen zum ersten Mal nach so vielen Jahrhunderten des Schweigens in dieser Sache, daß Krieg nach dem Willen Gottes nicht sein darf. Auch vom Vatikan wurden eindeutige Verdikte gegen den Krieg formuliert. Die Frage der Gewalt, der über lange Zeit nur wenig theologisches Interesse gegolten hatte, wurde – wohl aufgrund der immer bedrohlicheren Entwicklung der Gewalt in unserer Zeit – immer stärker als einer der nachhaltig und an zentralen Stellen der Bibel aufgeführten Begriffe entdeckt. Gewalt – so stellte man fest – wird vielfach in der Bibel geradezu als Synonym für Sünde genannt. Die Theologie entdeckte ebenso neu, daß der Friede, der so lange Zeit überhaupt nicht als besonderer „topos“ der theologischen Lehre vorgekommen war, einen zentralen Stellenwert in der biblischen Aussage hat.
Diese neuen Einsichten in die biblischen Aussagen spiegeln ein anderes Bewußtsein heute wieder und wirken zugleich wieder prägend auf das Bewußtsein der Christen. Neue Herausforderungen an die persönliche Haltung und auch an das politische Verhalten leiten sich daraus ab. Die Aussagen Jesu in der Bergpredigt, die zur Gewaltfreiheit auffordern, kommen klarer zur Sprache. Gerade da, wo die Christen nicht nur theoretisch über den Frieden reflektieren, sondern wo der Friede zur Herausforderung zum praktischen Handeln geworden ist, sind die Aussagen der Bergpredigt vernehmbar und wirksam geworden. Über lange Zeit war die Gewaltfreiheit der Bergpredigt, etwa in Form der Kriegsdienstverweigerung, nur die Ausnahme innerhalb der Kirchen, und die Bereitschaft zur Gewalt in Form des Kriegsdienstes war die Regel, das Normale gewesen. Allmählich scheint diese bizarre Situation wieder ins Lot zu kommen, indem die Christen die Bergpredigt und ihre Anleitung zur Gewaltfreiheit als die Grundordnung, als die „christlich normale“ Haltung verstehen und sie die Gewaltanwendung als Ausnahme sehen, über deren Berechtigung möglicherweise Pazifisten und Nicht- Pazifisten noch miteinander diskutieren können.
Das knappe halbe Jahrhundert seit Auschwitz und Hiroshima hat noch keine grundlegende Veränderung gebracht. Die Massenvernichtung – aufgrund von Ungerechtigkeit und Verelendung – hat zugenommen, das Potential der angehäuften Vernichtungskraft ist gewachsen. Dies alles trotz der allgemeinen kirchlichen Verlautbarungen zum Frieden und trotz der veränderten Haltung bei vielen Christen. Wir leben in einer Übergangszeit, einer lebensgefährlichen, einer für die ganze Menschheit überlebensgefährlichen.
Wenn wir in der Entwicklung der eskalierenden Gewalt keine Wende herbeiführen, so droht die Menschheitsgeschichte zu ihrem Ende zu kommen. Wenn die Kirchen nicht in der Friedensfrage, in der es um Leben und Tod der ganzen Menschheit geht, ihre ihnen übertragene Verantwortung wahrnehmen, so droht ihnen, zu jenem Salz zu werden, das geschmacklos geworden und nur noch wert ist, zertreten zu werden.
– Die vergangenen vierzig Jahr machen deutlich, daß es nicht hinreichend ist, sich nur allgemein für den Frieden auszusprechen. Unsere Aussagen müssen konkret sein. Sie müssen die Situation analysieren, in der wir leben, und sich auf konkrete Vorhaben beziehen. Die „Theologie der Befreiung“ kann uns manches dabei lehren.
– Unsere Haltung und auch unsere Aussagen müssen konsequent sein. Wir müssen zu dem stehen, was wir sagen, und dürfen uns nicht einfach jeder Gegebenheit anpassen und jeder neuen Gegebenheit erneut anpassen. Uns wird Glaubwürdigkeit abverlangt, und dabei geht es auch um das, was die Bibel die „Scheidung der Geister“ nennt. Dabei können wir von der Haltung der frühen Kirche und ihrer Christen lernen, denen es um den Weg der Nachfolge Jesu ging.
– Wir müssen mit unserem Sprechen und Handeln eine politische Wirksamkeit erreichen. Denn es geht um die Abkehr von dem derzeit vorgezeichneten Weg, der zur Vernichtung führt und wir haben nicht mehr viel Zeit. Viele, die heute an den Machthebeln sitzen, sind Christen, und ihr Verhalten hebt sich in keiner Weise positiv von dem der Nicht-Christen ab. Wenn wir die Politik ändern wollen, so können wir aus den Fehlern und auch aus manchen positiven Ansätzen der konstantinischen Ära lernen.
– Wir müssen das, was wir von anderen fordern, auch in unserem Lebensbereich modellhaft verwirklichen. Wir müssen alternative Lebensformen aufbauen und heute antizipatorisch schon so leben, wie es morgen möglicherweise von allen erforderlich sein wird. Wir müssen die Gesellschaft und zugleich auch uns verändern. Auch hier lehrt uns die frühe Kirche vieles.
Neue Verhaltensweisen, eine neue Verhältnisbestimmung zwischen unmittelbarer biblischer Herausforderung und politischem Kontext, und neue Signale zwischen bestehenden Gegebenheiten und vorweg gelebter Utopie sind nötig. Vermutlich ist es der einzelne und sind es die kleinen Gruppen, die die ersten Schritte machen müssen. Sie können, als Nachfolge-Gruppen, am ehesten Beweglichkeit zeigen, den Weg in die Zukunft vorangehen und dabei die Mehrheiten zum Mitgehen bewegen.
Als eine solche Gruppe versteht sich der Internationale Versöh-nungsbund. Der Anstoß zur Gründung des Internationalen Versöhnungsbundes ging 1914 unter dem drohenden Ausbruch des I. Weltkrieges, von einer Tagung des „Weltbundes für Freundschaftsarbeit der Kirchen“ in Konstanz aus. F. Sigmund-Schulze und der englische Quäker H. Hodgkin versprachen sich, in ihren Ländern gegen den wachsenden Haß, die zunehmende Militarisierung sowie die Bereitschaft zum Kriegführen einzutreten. Auf der Konferenz im niederländischen Bilthoven wurde 1919 der Versöhnungsbund als internationaler Verband gegründet. Grundlage für den Zusammenschluß war die gemeinsame „Überzeugung, daß die Nachfolge Jesu Christi uns in den Dienst sozialer Gerechtigkeit und des Friedens unter den Völkern stellt und zur Überwindung des Krieges aufruft“, war die Ablehnung jeder Form der Gewalt, der unmittelbar ausgeübten und der strukturell wirksamen, sowie die Orientierung am Prinzip der Gewaltfreiheit im persönlichen wie auch im gesellschaftlichen Bereich.
Der Wunsch, in der Nachfolge Jesu zu leben und den Geist der Bergpredigt zu praktizieren, bestimmte die Ausrichtung des Versöhnungsbundes, daneben jedoch auch die Absicht, politisch wirksame Veränderungen der Wirklichkeit zu erreichen und von einer Analyse der Gegebenheiten zu einem Wandel der Gesellschaft zu kommen. Zum besonderen Wesensmerkmal des Versöhnungsbundes gehört, daß er die biblisch-spirituelle mit der politisch-gesellschaftlichen Verantwortung sowohl auf den persönlich-privaten als auch auf den öffentlich-gesellschaftlichen Bereich bezieht und klare Stellungnahmen aufgrund der theoretischen Einsicht sowie gleichzeitig das konsequente Handeln – das „Tun des Wortes“, wie es in der Bibel heißt, – sucht.