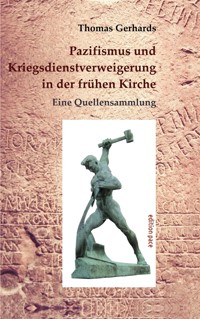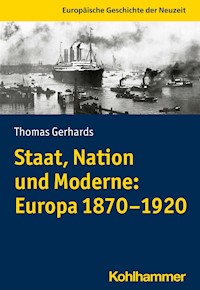
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Jahrzehnte zwischen 1870 und 1920 markieren Höhepunkt und Abschluss der europäischen Vorherrschaft in der Welt. Die Epoche ist gekennzeichnet von Phänomenen wie Kapitalismus, Technisierung und Demokratisierung, die neben ihrer Fortschrittlichkeit zugleich ein bisweilen grelles Schlaglicht auf gegenläufige Beharrungskräfte sowie die vielfältigen sozialen und politischen Kosten dieser schier grenzenlosen Dynamiken werfen. Europa bleibt aber ein heterogener Kontinent mit zum Teil scharfen Trennlinien zwischen Ost und West, Stadt und Land, Bürgertum und Arbeiterschaft. Anhand der Analyse von sechs zentralen Kategorien (Staat, Recht, Wirtschaft, Technik, Gewalt, Gesellschaft) wird die Janusköpfigkeit eines Zeitalters erkennbar, das in der Katastrophe des Ersten Weltkrieges sein Ende fand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Europäische Geschichte der Neuzeit
Herausgegeben von Guido Thiemeyer und Christian Henrich-Franke
Eine Übersicht aller lieferbaren und im Buchhandel angekündigten Bände der Reihe finden Sie unter:
https://shop.kohlhammer.de/europäische-neuzeit
Thomas Gerhards
Staat, Nation und Moderne: Europa 1870–1920
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
Umschlagabbildung: Ausfahrt des damals größten Schiffes der Welt aus dem Hamburger Hafen: der Dampfer »Imperator« der Hamburg-Amerika-Linie, 1913 (Foto: picture-alliance / IMAGNO/Austrian Archives).
1. Auflage 2022
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-037741-7
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-037742-4
epub: ISBN 978-3-17-037743-1
Inhaltsverzeichnis
1 Überblick
1.1 Vorbemerkungen
1.2 Die Einheit der Epoche: Staat, Nation und Moderne
1.3 Basisprozesse des 19. Jahrhunderts
1.4 Fin de Siècle oder Belle Époque?
1.5 Fazit
2 Staat
2.1 Vorbemerkungen
2.2 Die Entstehung des modernen Staates
2.3 Staatsform und Staatsorganisation
2.4 Staat und Partizipation
2.5 Die Entstehung des Wohlfahrts- und Sozialstaats
2.6 Fazit
3 Recht
3.1 Vorbemerkungen
3.2 Völkerrecht
3.3 Verfassungs- und Wahlrecht
3.4 Privatrecht
3.5 Fazit
4 Gesellschaft
4.1 Vorbemerkungen
4.2 Das Zeitalter der Massen
4.3 Vom Ständestaat zur Klassengesellschaft
4.4 Geschlechterverhältnisse
4.5 Fazit
5 Wirtschaft
Yaman Kouli und Guido Thiemeyer (Düsseldorf)
5.1 Vorbemerkungen
5.2 Industrialisierung
5.3 Landwirtschaft
5.4 Europa: Wirtschaftliches Zentrum der Welt
5.5 Der Europäische Wirtschaftsraum 1870–1918
5.6 Internationaler Goldstandard
5.7 Der Erste Weltkrieg
5.8 Fazit
6 Technik
Christian Henrich-Franke (Siegen)
6.1 Vorbemerkungen
6.2 Diffusion, Weiterentwicklung und Innovation von Technologie
6.3 Internationale Verbindungen – nationale Eingrenzungen: Ambivalenzen der Vernetzung
6.4 Professionalisierung von Technik
6.5 Fazit
7 Gewalt
7.1 Vorbemerkungen
7.2 Koloniale Gewalt und Genozide
7.3 Der kurze Traum der Emanzipation: Judentum und Antisemitismus
7.4 Zwangsaussiedlungen und ethnische Säuberungen
7.5 Der »Große Krieg«: Ursachen und Folgen
7.6 Fazit
Literatur
Abbildungsnachweis
Index
1 Überblick
1.1 Vorbemerkungen
Im Jahre 2017 fragte die amerikanische Fachzeitschrift Central European History diverse internationale Expertinnen und Experten nach ihrer Einschätzung zu der Frage, ob das 19. Jahrhundert im Verschwinden begriffen sei und für unsere Gegenwart mittlerweile eine geringere Rolle spiele als noch vor 40 oder 50 Jahren. Blickt man angesichts des Centenargedächtnisses auf die Unmenge an Publikationen zum Ersten Weltkrieg, dann war zumindest hier ein nach wie vor hohes Publikumsinteresse festzustellen. Aber auch Buchmärkte funktionieren nach Marktmechanismen und Verlage versuchen daher, das Bedürfnis nach neuen Erzeugnissen zu Jubiläen oder Jahrestagen routiniert mit Neuerscheinungen zu bedienen. Ob diese Bücher dann stets »Neues« liefern, neue Einsichten und Interpretationen, ist eine ganz andere Frage – die Verkaufszahlen mancher Werke sprechen hingegen eine klare Sprache und belegen das Bedürfnis nach allgemeinverständlicher historischer Literatur jenseits fachwissenschaftlicher Grenzen. Die zum 19. Jahrhundert befragten Historiker waren jedenfalls fast durchgehend der Ansicht, dass das 19. Jahrhundert in seiner Gesamtheit nach wie vor von großem Interesse für die historische Forschung ist. Daher überrascht es auch nicht, dass in den letzten 20 Jahren einige vorzügliche Darstellungen erschienen sind, die das Jahrhundert insgesamt oder in Teilepochen analysieren. In wünschenswerter Diversität liegen die Schwerpunkte dabei räumlich, methodisch oder perspektivisch jeweils ganz anders: Globalgeschichte setzt andere Schwerpunkte als europäische Geschichte, »erzählende« Geschichtsschreibung ist anders strukturiert als problemorientierte Analyse,
Abb. 1: Europa 1871.
und schließlich befriedigen Handbücher für den Gebrauch in der universitären Lehre andere Ansprüche als pointiert argumentierende Essays, die ein größeres Publikum anvisieren.
Die vorliegende knappe Synthese nimmt die zweite Jahrhunderthälfte bis zum Abschluss des Ersten Weltkriegs in Europa in den Blick und konzentriert sich, wie in der Reihe Europäische Geschichte der Neuzeit üblich, auf sechs Querschnittsbereiche der Lebenswirklichkeit: Staat, Recht, Gesellschaft, Wirtschaft, Technik und Gewalt. Im einleitenden Überblick werden nun zunächst einige Grundlagen über den Raum und die Zeit besprochen, also: Was heißt »Europa 1870–1920«, was zeichnet den Kontinent in dieser Zeit besonders aus, wo liegen die Schwerpunkte der vorliegenden Deutung? Im Anschluss folgt gewissermaßen ein Glossar zu einigen zentralen Prozessen, die für das 19. Jahrhundert in Gänze stehen, in seiner zweiten Hälfte aber eine besondere Steigerung oder Verdichtung erfuhren. Früher sprach die Forschung in diesem Zusammenhang von »Modernisierungsprozessen«; es wird zu klären sein, warum mittlerweile der statischer wirkende Begriff »Moderne« meist vorgezogen wird – und was sich dahinter verbirgt. Am Ende wird mit zwei zeitgenössischen Etikettierungen das Erbe der Epoche für das folgende »kurze« 20. Jahrhundert thematisiert.
1.2 Die Einheit der Epoche: Staat, Nation und Moderne
Wenn einleitend festgestellt wurde, dass das 19. Jahrhundert sich nach wie vor großer Beliebtheit in historischer Forschung und bei interessierten Laien erfreut, dann lässt sich das nicht alleine quantitativ an Verkaufszahlen einschlägiger Werke verdeutlichen. Insbesondere die Zeit um 1900 scheint noch heute eine eigentümliche Faszination auf die Betrachter auszuüben. Ein Band mit jüngsten Forschungsergebnissen thematisierte im Titel etwa den Durchbruch der Moderne, stellte dahinter aber ein Fragezeichen. Der britische Historiker Christopher Bayly war sich sicherer in dieser Einschätzung, als er 2004 mit The Birth of the Modern World eine vielbeachtete Globalgeschichte des 19. Jahrhunderts vorlegte. Auch wenn wir heute in der Post-Moderne leben (die ihren Anfang in den 1970/80er Jahren genommen haben soll), so gibt es doch noch viele Zeitgenossen, die schon lange genug im 20. Jahrhundert lebten, um das vorhergehende vermittels Eltern oder Großeltern als Teil des kommunikativen Gedächtnisses zu erfahren. Das heißt: Über die Familiengeschichten war und ist man auch heute noch vielfach mit diesem Jahrhundert verbunden. Wer um 1970 herum in Deutschland geboren wurde, könnte noch eine Großmutter gehabt haben, die stolz von ihrer Teilnahme an der Wahl zur Nationalversammlung im Januar 1919 berichtete – als Frauen dies erstmals durften.
Aber auch ganz »unpersönlich« weckt die Epoche 1870–1920 immer wieder großes Interesse. Die deutsche Geschichtswissenschaft hat seit den 1960er Jahren große Mühen aufgewandt, um mit dem Beginn des deutschen Nationalstaates auch auf die Frage Antworten zu finden, ob hier schon Keime des späteren »Zivilisationsbruches« von 1933 zu erkennen waren. Aus britischer Sicht wurde in dieser Zeit der Höhepunkt imperialer Weltgeltung erreicht, und der »Great War« war so verlustreich, dass seinem Ende am 11. November 1918 (Waffenstillstand) bis heute ein landesweit begangener »Remembrance Day« gewidmet ist. In Polen wird an diesem Tag der Nationalstaatsgründung von 1918 gedacht. Nicht nur in Russland verbindet man mit der Epoche auch die Oktoberrevolution und den Aufstieg der Sowjetunion. Durch den Weltkrieg hatten auch die USA ihre militärische Stärke als mittlerweile führende Industrienation unter Beweis gestellt. Mochten sie dem Völkerbund dann auch nicht beitreten, so war dennoch ein »Weltstaatensystem« entstanden, dessen natürliches Zentrum nicht mehr Europa war. Schließlich ist auch auf dem Balkan die Epoche bis heute präsent: Bulgariens Nationalfeiertag wird jedes Jahr am 3. März begangen und erinnert an die »Befreiung« vom Osmanischen Reich im Jahre 1878. Beim Nachbarn Rumänien ist es alljährlich der 1. Dezember, der auf die Ausrufung eines territorial erweiterten »Großrumäniens« 1918 verweist. Es ist also sicherlich nicht abwegig, im späten 19. Jahrhundert die Entstehung unserer heutigen Welt zu verfolgen.
Es ließen sich zahlreiche weitere Beispiele aus der »großen« Politik benennen, die die politische Bedeutung der Epoche bis heute belegen. Aber auch in zahlreichen anderen Bereichen besitzt sie einen hohen Wiedererkennungswert, wenn man so möchte: In der Technik entstanden die bis heute gängigen Verkehrsmittel wie das Automobil und das Flugzeug, das Fahrrad wird ebenso zur Massenware wie die Fortbewegung mit Eisen- und Straßenbahnen. Elektrisches Licht erreicht immer mehr Städte und auch ländliche Regionen, das Telefon wird ein wichtiges Kommunikationsmittel, ebenso wie die täglich erscheinende Zeitung. Daneben entwickeln sich bereits Kino und Radio zu den Grundpfeilern der Massenkultur, die dann vor allem in den 1920er Jahren durchbricht. Es lassen sich aber auch »weichere« Faktoren nennen, die vielleicht weniger direkt das Leben der Menschen betrafen, aber dennoch historisch ausgesprochen wirksam und wichtig waren – und die auch heute noch vertraut klingen: Im internationalen Warenverkehr war ein Grad an globaler Verflechtung erreicht, wie es ihn in Europa erst wieder in den 1960er Jahren gab. Mit dem Ende der Sowjetunion 1989/91 glaubten manche Beobachter an den endgültigen Sieg der liberalen Demokratie, gar das Ende des Nationalstaates und seiner historischen Bedeutung. Aber nicht erst die Balkankriege der 1990er Jahre machten deutlich, dass die Ideologie des Nationalismus, ein Kind des 19. mit furchtbaren Steigerungen im frühen 20. Jahrhundert, noch keineswegs an ihr Ende gekommen war. Spätestens mit dem 11. September 2001 ist der Terrorismus wieder ins internationale Blickfeld gerückt; auch dieser hat eine Vorgeschichte im 19. Jahrhundert mit einigen prominenten Opfern, etwa Elisabeth von Österreich 1898. Während dieser Mord keine politischen Folgen nach sich zog, lässt sich das von anderen Attentaten nicht behaupten: Der Deutsche Kaiser Wilhelm I. überlebte 1878 zwei Mordversuche, die Bismarck für das folgenreiche »Sozialistengesetz« ausnutzte. 1881 fiel Zar Alexander II. einem Bombenattentat zum Opfer, das sein nachfolgender Sohn, Alexander III., für die Einfrierung des Reformprozesses nutzte. Er installierte eine stramme Russifizierungspolitik und schränkte die Rechte der Juden – die in Pogromen zu unmittelbaren Opfern der Reaktionen auf das Attentat wurden – erneut ein. Schließlich Sarajewo, 28. Juni 1914, das Attentat auf den österreichischen Thronfolger: Das war nicht die Ursache für den Weltkrieg, aber es motivierte insbesondere diejenigen in Wien, die auf eine militärische Machtdemonstration gegen Serbien setzten. All diese Beispiele können zeigen, wie ein Interesse an der Vergangenheit aus den Problemlagen der Gegenwart entstehen kann. Wer heute, um ein letztes Beispiel zu nennen, nach »Modernisierungsverlierern« fragt – also nach Menschen, die sozioökonomisch, psychisch oder kulturell einer sich rasant beschleunigenden Zeit nicht mehr standhalten können –, der oder die beschäftigt sich mit Themen, die vor über 100 Jahren schon genauso drängend und aktuell waren.
Was heißt aber nun: Europa 1870–1920? Es fehlt hier der Raum, den Kontinent in seiner geografischen und klimatischen, schließlich auch sozialen, kulturellen und politischen Vielfalt zu erfassen. »Europa« ist nicht nur ein Konstrukt, das immer wieder neu definiert werden muss; aber die Diversität war und ist doch so groß, dass letztlich alle Versuche scheitern müssen, über wenige Begriffe und Prozesse eine Einheit herzustellen, die es so nicht gab. Frühere Handbücher haben das Problem zu lösen versucht, indem sie additiv die Nationalgeschichten nebeneinander stellten, zusammengehalten durch einige Querschnittanalysen, die Entwicklungen in mehreren Ländern zugleich verfolgten. Das erforderte ein großes Maß an Kenntnis eines einzelnen Autors oder die Expertise einer ganzen Autorenriege. Bis in die 1990er hinein war es auch nicht unüblich, als Kind des »Kalten Krieges« Geschichte aus rein westlicher oder östlicher Sicht zu schreiben; tatsächlich ist eine solche Trennung noch heute sehr präsent – wissenschaftliche Traditionen sind oft lang- und zählebig. Häufig ist es aber schlicht das Sprachproblem, das eine tiefere Beschäftigung etwa mit dem Balkan in Osmanischer Zeit verhindert. Neuere Ansätze – und das heißt ausdrücklich nicht: konzeptionell überlegene – versuchen hingegen, thematische Schneisen in das Dickicht der historischen Vielfalt zu schlagen. Bevor das näher erläutert wird, soll anhand weniger Beispiele die Vielfalt Europas um 1900 konkreter illustriert werden.
Nähert man sich von der Peripherie Richtung Zentrum, lassen sich schon fundamentale Gegensätze aufzeigen – aber durchaus auch einige Gemeinsamkeiten, auf die dann später zurückzukommen sein wird. Großbritannien und Russland waren Teil der europäischen Pentarchie, das heißt der fünf Großmächte, die seit 1815 erfolgreich versuchten, einen größeren Konflikt auf dem Kontinent zu vermeiden. Auf dieser politisch-diplomatischen Ebene agierte man gewissermaßen als Partner auf Augenhöhe und war seit Jahrzehnten miteinander vertraut. Dies galt auch für die imperiale Konkurrenz, die die beiden Reiche in Asien an den Rand eines Krieges führte. Dieser konnte vermieden werden, es kam zum politischen Ausgleich, am Ende fanden sich die beiden Monarchien mit der Republik Frankreich als »Entente« im Weltkrieg gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn wieder. Erweitert man den Fokus, treten jedoch einige sehr klare Unterschiede zutage: England war um 1900 längst eine bürgerliche Gesellschaft geworden, deren Wirtschaft kapitalistisch organisiert war und auf einer Industrie beruhte, deren Arbeitsformen sich früher als auf dem Rest des Kontinents durchgesetzt hatten. Russland hingegen, ein Agrarstaat mit einer erst seit den 1890er Jahren von oben angeschobenen Industrie, hatte so etwas wie eine Gesellschaft (die dem Staat selbstorganisiert gegenübersteht) allenfalls in Ansätzen entwickelt. Was vor allem fehlte, war ein Bürgertum von nennenswerter Größe, das in der russischen Ständeordnung nicht aufkommen konnte. Zudem war Großbritannien eine parlamentarische Monarchie, während der weiterhin autokratisch regierende Zar nach der Revolution 1905 zwar Zugeständnisse machte, diese aber schnell wieder kassierte. Ähnlich lagen die Verhältnisse in einem weiteren Vielvölkerstaat im Südosten, der durch Besitzungen auf dem Balkan Teil des europäischen Kontinents blieb: Das Osmanische Reich hatte sich im Zuge der Tanzimat-Reformen in vielen Bereichen »dem Westen« angenähert, bis 1876 eine liberale Verfassung verabschiedet wurde. Dieser Versuch scheiterte jedoch schnell, so dass in der Folge auch dieses Imperium wieder autokratisch geführt wurde. Der 1870 noch weitgehend von den Osmanen kontrollierte Balkan wurde zu einem dauerhaften Konfliktherd, in dem sich Großmachtinteressen und nationale Staatsbildungen kreuzten. Kulturelle Differenzen aufgrund unterschiedlicher Religionen spielten erst dann eine konfliktverschärfende Rolle, als sie zunehmend nationalisiert wurden. Die Nationalstaatsgründungen waren hier von massiver Gewaltanwendung und Krieg begleitet – aber das war in Deutschland oder Italien nicht anders. Kein Nationalstaat ohne Krieg, mit der bezeichnenden Ausnahme Norwegens, das sich 1905 von Schweden emanzipierte – per Volksabstimmung.
Betrachten wir noch einige statistische Beispiele, um grundlegende Unterschiede der Lebensbedingungen zu verdeutlichen. Vorausgeschickt sei lediglich, dass Daten, wie die im Folgenden angeführten, nicht immer gleich erhoben wurden, manchmal handelt es sich eher um Schätzungen. Die Erfassung solcher Zahlen durch die Zeitgenossen ist selbst ein Anzeichen für den Grad an bürokratischer Durchdringung und damit an »Modernität«, wie später zu zeigen sein wird.
Einer von vielen Messwerten für eine »moderne« Gesellschaft ist der Grad der Urbanisierung, also: Wieviel Prozent der Menschen leben in einer Stadt mit mehr als 2.–5.000 Einwohnern? Das waren 1910 in Russland erst 20 %, im ländlichen Schweden kaum mehr, in Serbien gar nur 10 %; in Deutschland waren es aber 49 %, in Großbritannien sogar drei Viertel aller Menschen. Der europäische Durchschnitt lag in dieser Zeit bei 36 %; auch Portugal lag mit nur 16 % weit darunter. Einen ähnlichen Einblick bieten auch Daten über die Lese- und Schreibfähigkeit. Auch hier lag Portugal mit 30 % Lesefähigen im Jahre 1910 am unteren Ende der Skala, die von Finnland mit 99 % angeführt worden sein soll (andere Berechnungen geben ca. 7 % Analphabeten an). Für Serbien liegen Zahlen aus dem Jahr 1900 vor, da konnten 33 % der Männer lesen, aber nur 7 % der Frauen. Dieses Missverhältnis zwischen den Geschlechtern gab es fast überall, die Unterschiede waren aber nicht immer derart groß. Selbst das hochindustrialisierte und politisch moderne Belgien hatte 1910 noch eine Analphabetenquote von ca. 25 % bei beiden Geschlechtern – ein Anzeichen dafür, dass eine klare Korrelation zwischen rudimentärer Bildung und wirtschaftlicher Modernität nicht zwingend besteht. Schließlich noch einige Zahlen zur Wirtschaftsentwicklung, die in der Retrospektive oft viel zu vereinfachend als gesamtgesellschaftliche »Industrialisierung« betrachtet wurde; man kann nicht oft genug darauf hinweisen, dass um 1914 noch 50 % der Menschen in Europa von der Landwirtschaft lebten. Preußen ist ein gutes Beispiel für diese langlebige Diversität: Während der Westen, hauptsächlich das Ruhrgebiet, stark von Kohle, Eisen und Stahl geprägt war, blieb der Osten des Landes agrarisch geprägt – was nicht heißt, dass hier nicht auch mit dem Einsatz von immer weiter verbesserten Landmaschinen gearbeitet wurde. Schaut man auf das Sozialprodukt pro Kopf der Bevölkerung, dann zeigt sich eine klare Trennlinie zwischen den Regionen im Norden und Westen zu denen im Süden und Osten des Kontinents. Für das Jahr 1913 wurde ein BSP pro Kopf von 534 US-Dollar in ganz Europa geschätzt; schaut man in die Regionen, stellen sich klare Differenzen heraus: Mit 846 US-Dollar lag das BSP in den »frühindustrialisierten Ländern« Belgien, Frankreich, Großbritannien und der Schweiz am höchsten, während die »Spätindustrialisierer« Deutschland, Österreich-Ungarn und die Niederlande 205 US-Dollar darunter lagen – aber immer noch über dem europäischen Durchschnitt. Anders war das bei Russland, Rumänien und Bulgarien, die gemeinsam nur einen Schnitt von 324 US-Dollar erreichten, sowie bei den Mittelmeerländern Griechenland, Italien, Portugal und Spanien, die auf 393 US-Dollar kamen. Vergleichen wir nun noch die nationalen Volkswirtschaften und ihren jeweiligen Anteil am europäischen BSP, dann relativieren sich die Zahlen erneut. Zwischen 1880 und 1913 hatte Russland Großbritannien überholt: Englands Anteil lag zunächst noch bei 18,6 % und damit an der Spitze aller Volkswirtschaften, 1913 waren es nur noch 17,2 % und der dritte Platz. Überholt worden war es von Deutschland, das vor dem Krieg 19,4 % des Gesamtvolumens erwirtschaftete, an der Spitze lag nun, wie gesagt, das Russische Reich mit 20,4 %.
Die Zahlen sollten Folgendes unterstreichen: Begriffe wie Urbanisierung, Technisierung oder Industrialisierung sind einerseits zentral für die Erfassung von Modernisierungsprozessen in Europa nach 1870. Aber so unklar gelegentlich die Datengrundlage im Allgemeinen ist, so differenziert müssen die Zahlen im Einzelfall grundsätzlich analysiert werden. Begriffe wie »Rückständigkeit« erweisen sich als sehr relativ und nicht zuletzt abhängig vom Standpunkt des Betrachters. So war beispielsweise die russische Industrie noch nicht vergleichbar mit der Konkurrenz im Westen; dennoch hatte Russland ein großes wirtschaftliches Potenzial, das nicht zuletzt – wie in den meisten anderen Staaten – zum Unterhalt einer großen Armee mit modernsten Waffen genutzt wurde. In Deutschland registrierte man diese Entwicklung vor 1914 ganz genau, und es gab politische und militärische Stimmen, die vor Russlands wachsender Wirtschaftskraft in einem kommenden Krieg warnten. Auch die Balkanländer waren gewiss nicht reich im westlichen Sinne, waren wesentlich weniger industriell »entwickelt« oder produktiv – aber dafür waren sie hochgerüstet mit den neuesten Produkten westlicher Rüstungsfirmen, für die sie sich verschuldet hatten: Serbien war schon 1893 insolvent, Bulgarien 1902 bankrott. Gleichwohl verkündete 1910 ein bulgarischer General voller Stolz, mit 350.000 Soldaten sei sein Land das »militaristischste« der Welt.
So unterschiedlich die ca. 20 europäischen Staaten vor 1914 auch waren, so gab es dennoch zahlreiche Konvergenzen. Je leichter das Reisen dank der Eisenbahnen und Dampfschiffe wurde – beides unverzichtbare Symbole für diese Zeit –, desto stärker verflochten sich Staaten, Wirtschaften und Gesellschaften, die sich oft sehr genau beobachteten und voneinander zu lernen versuchten. Eine europäische Gesellschaft entstand zwar nicht (ob es sie heute gibt, ist auch sehr fraglich), aber es gab zahlreiche internationale Vernetzungen, wissenschaftliche Kongresse und Austauschprogramme, Vereinsgründungen auf globaler Ebene. Diese und ähnliche Prozesse werden durch Begriffe wie Urbanisierung, Technisierung, Bürokratisierung und viele mehr erfasst, die in den folgenden Kapiteln ausführlicher besprochen werden.
Wie bereits erwähnt, wird in diesem Buch nicht die Absicht verfolgt, eine additive europäische Geschichte zu schreiben. Dazu gibt es bereits vorzügliche Handbücher zu Europa, die im Literaturverzeichnis nachgewiesen werden. Auch an modernen Nationalgeschichten ist kein Mangel, in ausführlicher wie in kompakter Form. Wir nähern uns der Epoche in sechs Längsschnittanalysen zu den Themen Staat, Recht, Wirtschaft, Technik, Gesellschaft und Gewalt. All diese Dimension stehen in verschiedensten Wechsel- oder Bedingungsverhältnissen. Oder um es so zu formulieren: Aus ökonomischen Gegebenheiten entstehen soziale Fragen, aus denen (mitunter gewaltsame) Konflikte resultieren, die schließlich politisch verhandelt werden, bevor sie unter Umständen Eingang in die Gesetzgebung finden. In allen sechs Dimensionen zeigt sich, wie stark die Epoche von Wandlungsprozessen geprägt wurde; in den Fokus rücken wir dabei vor allem die Entwicklung des Staates, der zum Nationalstaat werden sollte, unter den Bedingungen der »Moderne«. Dieser Begriff hat sich für die um 1870/80 einsetzende Epoche etabliert, bedarf jedoch einiger Erläuterungen vorab.
Der Terminus Moderne taucht vor allem seit den 1980er Jahren in zahlreichen Wissenschaftsdisziplinen auf und ist längst in der Geschichte angekommen, zumindest in Deutschland. Seit den 1960er Jahren war zunächst noch häufiger von »Modernisierung« die Rede, und insbesondere die deutsche Sozialgeschichtsschreibung arbeitete sich an einer Modernisierungstheorie ab, die diese Prozesse oftmals als eine Fortschrittsgeschichte begriff. Modernisierung stand hier für solche Basisprozesse, die im nachfolgenden Abschnitt beschrieben werden. Mit dem begrifflichen Übergang zur »Moderne« wurden diese Entwicklungen nun nicht weniger wichtig oder gar in ihr Gegenteil verkehrt; vielmehr gerieten nun auch viel stärker die politischen, sozioökonomischen, kulturellen oder psychosozialen Kosten von Modernisierungsprozessen in den Blick: Die Moderne zeigte nun auch ihre seither vielberufene »Janusköpfigkeit«, indem sie konkreter auf eine umfassende oder mehrere historische Teilepochen bezogen wurde und nicht nur deren vermeintliche »Fortschritte« in Betracht zog. Statt umfassender theoretischer Erörterungen zum Moderne-Begriff folgen wir hier in erster Linie den kritischen Erwägungen, die der britische Globalhistoriker John Darwin eingebracht hat. Demnach steht »Moderne« für Ordnung, Disziplin, Hierarchie und Kontrolle. Charakteristische Merkmale sind unter anderen:
1) Ein organisierter Nationalstaat mit einer legitimen Regierung, die auf einer loyalen und gesetzestreuen Bürokratie fußt.
2) Ein kodifiziertes Privatrecht zum Schutz der Bürger und ihres Eigentums.
3) Ein starkes Wirtschaftswachstum auf der Grundlage des Industrieund Finanzkapitalismus, beruhend in erster Linie auf naturwissenschaftlichem Wissen.
4) Die Säkularisierung der Lebenswelt durch eine »Entzauberung« des Wissens, beruhend auf allgemeiner Alphabetisierung und einer national identitätsstiftenden Schulbildung.
Unter Berufung auf viele andere Autoren ließen sich hier noch die Gleichzeitigkeit von Individualisierung und Massengesellschaft anführen sowie deutlicher die Einteilung der Staatenwelt nach nationalen Kriterien betonen. Die meisten dieser Begriffe und die dahinterstehenden Prozesse werden in diesem Band auch wieder aufgegriffen und eingehender analysiert. Wichtig ist dabei stets, dass Fortschritte und Schattenseiten gleichermaßen betrachtet werden sollen, um damit stärker den Erfahrungen der Zeitgenossen gerecht zu werden als nachträgliche Erfolgs- oder Niedergangsgeschichten. Um nochmals die globale Perspektive John Darwins einzunehmen: Die vier genannten Merkmale legen den Verdacht nahe, dass hier Entwicklungen beschrieben werden, die tatsächlich in Europa stattgefunden haben. Weltteile ohne diese »Fortschritte« werden dann als »unmodern« eingestuft – obgleich die Prozesse in Europa einerseits eben nicht gleichläufig waren, andererseits sich ähnliche Wandlungen auch in anderen Weltteilen durchaus vollzogen (etwa die Bürokratisierung Chinas lange vor Europa). Der größte Vorbehalt dürfte gegen den (unbewussten) Glauben vorzubringen sein, die Moderne berge »notwendige« oder gar »unvermeidliche« Transformationsprozesse. »Unvermeidlich« war die überlegene Waffengewalt der Europäer und ihr »Vernichtungswille« als Teil ihrer Militärkultur (Wolfgang Reinhard) gegenüber den Völkern und Staaten Afrikas und Asiens – alles andere ist eine Frage des wissenschaftlichen Standpunktes. Im Falle dieses Buches ist es ein europäischer, ohne eurozentrisch sein zu wollen.
Wesentlich länger als historischer Begriff eingeführt ist die Nation, auch wenn man vielleicht sagen kann, dass ihre eigentliche Historisierung erst in den 1980er Jahren begann. Aufbauend auf einige ältere Studien, fragte man erst jetzt intensiver nach den historischen und ideologischen Grundlagen dieses zentralen Bezugspunktes der Politik im 19. Jahrhundert. Mit der Französischen Revolution rückte die Nation als Souverän an die Stelle des Monarchen und sollte deckungsgleich werden mit dem Staat. Das heißt: Im Begriff der Nation steckte auch das Streben, Nationalstaat zu werden. Dies verlief in zwei Richtungen: Nach außen war das immer mit Kriegen verbunden, kein Nationalstaat kam ohne aus. Nationen waren aber auch erst nach innen zu schaffen, um ein Verständnis ihrer selbst zu etablieren; das geschah über Symbole, die einen nationalen Kommunikationsraum füllten, der mit modernen Massenmedien überhaupt erst ermöglicht wurde. Aber auch ganz praktisch strebten die Nationalstaaten danach, die Dinge zu vereinheitlichen: die unterschiedlichen Traditionen der Rechtsprechung, Maße und Gewichte, vor allem aber auch Bildungsinhalte in den überall in nationalstaatliche Aufsicht überführten Schulen. Der Nationalstaat war für seine Mitglieder ein attraktives Partizipationsversprechen, bot er doch – als Verfassungsstaat – politische Teilhabe und Rechtssicherheit, später dann auch soziale Wohlfahrt. Es gab aber keinen Nationalstaat, der nicht zunehmend auch die bedrängende Frage stellte, wer Teil der Nation sein solle; partizipative Inklusion ging also mit Marginalisierung oder Exklusion eine unauflösliche Verbindung ein – auch im Nationalismus zeigt die Moderne ihre Janusköpfigkeit. Jetzt erst tauchte daher auch der Terminus der »Minderheiten« in der politischen Sprache auf, und in der Vorstellung des souveränen und homogenen Nationalstaates wurden sie überall zum »Problem«: Katholische Iren in Großbritannien, Polen im Deutschen Reich, Juden in Russland, aber auch soziale Gruppen wie die politisch organisierten Arbeiter in den Industriestaaten. Vielfach zeigte sich dabei die Verschränkung von unveränderlichen Distinktionsmerkmalen, vor allem von Religion und Ethnie. Das war insbesondere auf dem Balkan zu beobachten, wo Juden von Christen verfolgt wurden, Christen von Muslimen und diese dann – nach erfolgter nationaler Sezession vom Osmanischen Reich – schließlich von den Christen. Im Grunde war aber überall in Europa zu beobachten, dass eine Nation nur schwer konkurrierende Loyalitäten sozialer oder religiöser Art anerkennt, solange sie sich nicht miteinander verbinden (zum Beispiel im Nationalprotestantismus). Der Druck zum klaren Bekenntnis war unterschiedlich und zeigte sich nicht immer in offener Gewalt wie etwa in der Form ethnischer Säuberungen (Kap. 7.4), aber er war überall und stets vorhanden. Dieser Druck konnte sich auch nach außen zeigen, zum Beispiel im Streben von Nationen in Vielvölkerstaaten nach Autonomie. Diese Probleme zeigten sich in Südost- und Osteuropa, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg, als das »Selbstbestimmungsrecht der Völker« zur uneinlösbaren Maxime wurde.
1.3 Basisprozesse des 19. Jahrhunderts
Aufmerksame Zeitgenossen aus den Sozialwissenschaften haben bereits um 1900 herum Begrifflichkeiten geprägt, die noch heute als »Etiketten« entweder für das 19. Jahrhundert in Gänze oder auch nur für die Jahrzehnte vor der Epochenscheide des Ersten Weltkrieges in Gebrauch sind. Manche haben ein hohes Abstraktionsniveau und meinen (je nach Gebrauch) oft ganz unterschiedliche Dinge. Andere hingegen scheinen eindeutiger zu sein. Sie alle können jedoch auch stellvertretend für wichtige Entwicklungen und Trends verwendet werden und sind daher dazu geeignet, zentrale Basisprozesse vorzugsweise der zweiten Jahrhunderthälfte mit einem Wort zu erfassen. Einige von ihnen werden einleitend aufgegriffen und mit wenigen Worten skizziert, ohne Anspruch auf Vollständigkeit; dabei handelt es sich weniger um eindeutige Definitionen als um historisch hergeleitete Annäherungen an unterschiedliche Themen, die sich wechselseitig bedingen und in komplexen Strukturen miteinander verbunden sind. Wo möglich, wird auf weitere Informationen zu den Basisprozessen in den folgenden Sachkapiteln verwiesen. Wichtige Begriffe wie Bürokratisierung (Kap. 2.2), Demokratisierung (Kap. 2.3 und 2.4) oder Urbanisierung (Kap. 4.2) bleiben hier außen vor, da sie in späteren Kapiteln aufgegriffen und erläutert werden.
Emanzipation/Emanzipierung
Damit werden in der Regel verschiedene, voneinander unabhängige Prozesse beschrieben, die zumeist mit fundamentalen Rechtsakten einhergehen. Im Übergang von der Feudalgesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft emanzipierte sich zunächst die kleine Gruppe des Bürgertums, die staats- und gesellschaftstragend wurde. Im Anschluss daran ist die in Deutschland sogenannte Bauernbefreiung zu nennen, von der in vorkapitalistischer Zeit die große Mehrheit der europäischen Agrargesellschaften betroffen ist. Dieser gesamteuropäische Prozess findet in den 1860er Jahren in Russland seinen Abschluss. Weiterhin wird auch die bürgerliche Gleichstellung der jüdischen Minderheiten im Zuge der Verfassungsgesetzgebung als Emanzipation bezeichnet. Zu unterscheiden ist dabei formal zwischen einmaligen Rechtsakten wie etwa im revolutionären Frankreich einerseits und der stufenweisen Verbesserung wie in den deutschen Staaten andererseits. An der Modernisierung der Judenfeindschaft zum Antisemitismus seit den 1870er Jahren zeigt sich, dass rechtliche Gleichstellung und vorurteilsfreie soziale Integration im modernen Nationalstaat nicht zwangsläufig einhergehen (Kap. 7.3). Schließlich werden die vielfältigen Versuche, durch politisch-soziales Engagement die Stellung der Frauen in den männlich dominierten Bürgergesellschaften zu verbessern, als Emanzipation bezeichnet. Hier waren die Ziele sehr unterschiedlich, je nach Land oder gesellschaftlicher Schicht. Mindestens ging es um die Verbesserung der Chancen im Bildungswesen und Arbeitsleben sowie um rechtliche Gleichstellung in den paternalistischen bürgerlichen Gesetzbüchern (Kap. 3.4) bis hin zur Forderung nach vollständiger Gleichheit und damit nach politischer Teilhabe im Wahlrecht (Kap. 4.4). Auch die Entwicklung zu einer fast überall verbreiterten Wählerbasis, die zu den zentralen politischen Auseinandersetzungen bis in den Weltkrieg hinein gehört, kann zu den Emanzipationsprozessen gerechnet werden (Kap. 3.3). Gemeint ist damit insbesondere die Integration der Arbeiterschaft als neuer sozialer Schicht in den Staat.
Fortschritt
Die kulturelle Selbstwahrnehmung zumindest der west- und mitteleuropäischen Gesellschaften war durch den manifesten Glauben an umfassende Fortschrittlichkeit geprägt. Die Zukunft erschien gestaltbar, gerade angesichts erst jüngst erreichter Verbesserungen für eine Vielzahl von Menschen: Eine zumindest rudimentäre Schulbildung wurde Standard, Kanalisationen und die moderne Medizin trugen ebenso zu gesünderen Lebensbedingungen bei wie eine verbesserte Ernährungsgrundlage durch steigende Reallöhne. Das wirtschaftliche Wachstum ging bis zum Weltkrieg ungebremst weiter, und schließlich verbreitete sich im »europäischen Jahrhundert« seine Zivilisationsidee bis in fast jeden Winkel der Erde – und Europa interessierte sich noch wenig dafür, was »Zivilisation« hier bedeuten und anrichten konnte. Um 1900 wuchsen jedoch die Zweifel, überall machten sich Anzeichen einer Kulturkrise breit. Das Heraufkommen der modernen Massengesellschaft mit ihrer beschleunigten Massenkommunikation schien das Individuum vor immer weitere Herausforderungen zu stellen und die persönliche Freiheit einzuschränken (Kap. 4.2). Der Fortschrittsglaube wich hier und da einer desillusionierten Wirklichkeitswahrnehmung, die im extremen Falle auf die befreiende Wirkung eines »Großen Krieges« hoffte.
Globalisierung
Globalisierung ist ein schillernder Begriff der Wissenschafts- und politischen Alltagssprache seit den 1990er Jahren, der längst Eingang in historische Debatten gefunden hat und dazu dient, Aufbau, Verdichtung und Bedeutung weltweiter Vernetzung in allen Daseinsbereichen zu umschreiben. Das heißt: Mit Globalisierung ist nicht (nur) eine Zustandsbeschreibung der Gegenwart mit ihren historischen Ursachen gemeint. Der Begriff selbst wird historisiert und lenkt den Blick auf globale Verflechtungen ökonomischer, politischer oder zivilgesellschaftlicher Art; diese können wachsen und erodieren, sind damit wie alle historischen Phänomene stetigen Wandlungsprozessen unterworfen. Im Gegensatz zu allen anderen hier genannten Begriffen beschreibt Globalisierung aber keinen lokalen, regionalen oder nationalen Prozess, sondern einen weltweiten. Für die Epoche nach 1870 geht die Forschung schon lange von einer intensiven wirtschaftlichen Verflechtung aus, hauptsächlich zwischen den Metropolen und ihren Kolonien in Afrika und Asien, freilich aber auch für den Warenverkehr mit den aufstrebenden USA und den südamerikanischen Staaten. Es konnte jedoch gezeigt werden, dass auch jenseits des Wirtschaftskreislaufs eine massive »Internationalisierung« (so der zeitgenössische Begriff) zivilgesellschaftlicher und politischer Art Einzug hielt (Kap. 3.2). Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts, spätestens jedoch mit dem Ersten Weltkrieg, wurde aus der europäischen Pentarchie zudem ein Weltstaatensystem, zu dem anfangs als Großmächte die USA und Japan (nach dem erfolgreichen Krieg gegen Russland 1904/05) stießen, während beispielsweise Österreich-Ungarn als Imperium ganz von der Landkarte verschwand.
Individualisierung
Auf den ersten Blick scheint es paradox: Das enorme Bevölkerungswachstum in Europa mündete um 1900 herum in urbanisierte Massengesellschaften, die mit immer feineren Verfahren die Menschen zählten, einordneten, nach Schichten oder Gruppen klassifizierten und als Nationen sie in Massenheeren schließlich in den Weltkrieg schickten – das Individuum schien nur noch kleinster Teil einer anonymen Masse zu sein. Gleichwohl wird spätestens mit dem Einsetzen der Aufklärung von einem Prozess der Individualisierung gesprochen, der alle sich wirtschaftlich und politisch modernisierenden Gesellschaften erfasst habe. Was ist also darunter zu verstehen? Im Prinzip waren es die gerade angesprochenen Basisprozesse, die zu einer Individualisierung geführt haben. Vereinfacht lässt sich sagen, dass die ökonomisch bedingte Migration in die größer werdenden urbanen Zentren (Kap. 4.2) zur Auflösung tradierter Familienverhältnisse in der Heimatgemeinde führte. Familie und Gemeinde boten bisher Schutz vor Lebensrisiken wie Hunger, Arbeitslosigkeit oder Krankheit; diese Bande funktionierten auf Distanz nicht mehr und wurden nach und nach aufgefangen durch korporative Gemeinschaften wie etwa Gewerkschaften und Vereine (Kap. 4.2), später auch durch den Staat (Kap. 2). Als weiteres Kennzeichen der Individualisierung ist die Entwicklung von der Ständegesellschaft zur bürgerlichen Gesellschaft rechtsgleicher Individuen zu nennen: Der Mensch tritt dem Staat nunmehr alleine gegenüber, kann individuell seine Rechte einklagen, nicht mehr als Teil eines Berufs- oder Geburtsstandes. Gerade hier ist aber kritisch einzuwenden, dass »Mensch« in diesem Falle »Mann« heißen müsste: Für Frauen galten eben noch andere Rechte im Arbeitsleben und der Familie (Kap. 3.4 und 4.4).
Kapitalismus und Industrialisierung
Der schillernde Begriff des Kapitalismus entstand in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Zunächst in kritischer Absicht von der politischen Linken verwendet, fand er dennoch schnell Eingang ins (bürgerliche) sozialwissenschaftliche Vokabular, wo er zu einem zentralen Begriff der Zeitdiagnose wurde. In diesem Spannungsfeld zwischen Wissenschaft