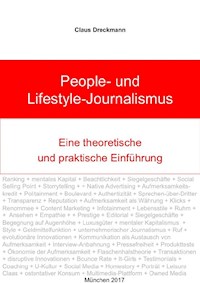
People- und Lifestyle-Journalismus. Eine theoretische und praktische Einführung E-Book
Claus Dreckmann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Medienbranche erlebt durch die Digitalisierung einen gewaltigen Umbruch. Alte Monopole und Oligopole brechen auf, Machtverhältnisse verschieben sich. Dieses Buch widmet sich der Frage, wie professioneller Journalismus im 21. Jahrhundert aussehen muss, um zukunftsträchtig den Wandel mit zu gestalten statt sich selbst aufzugeben. Ausgehend von Georg Francks Entwurf einer Ökonomie der Aufmerksamkeit zeigt die Arbeit Wege auf, in Form des People- und Lifestyle-Journalismus Ansätze für einen zeitgemäßen Journalismus zu finden. Das Buch beschäftigt sich intensiv mit den wissenschaftlichen Wurzeln des People- und Lifestyle-Journalismus als zwei Sonderformen des Boulevard-Journalismus, die sich in der Praxis beim Konsumenten besonderer Beliebtheit erfreuen. Es analysiert, welche Gedankenmodelle aus Soziologie, Psychologie und Philosophie hinter den Begriffen Lifestyle stehen und was unter People-Journalismus zu verstehen ist. Kritisch wird die Verschiebung journalistischen Arbeitens hin zum Content Marketing analysiert. Die Unterschiede zwischen Paid-, Earned- und Owned-Media werden dargestellt, Begriffe wie Native Advertising, Storytelling und Siegelgeschäft erörtert. Diese Verschiebung ursprünglich journalistischen Handwerks hin zum Marketing wird aufgezeigt und medienrechtlich wie ethisch eingeordnet. Zwei qualitative Interviews mit der langjährigen BUNTE-Chefredakateurin Patricia Riekel und der langjährigen INSTYLE-Chefredakteurin Annette Weber beleuchten die praktische Seite des People- und Lifestyle-Journalismus. Im praktischen Teil werden konkret Methoden erläutert, die den erfolgreichen Einstieg in den People- und Lifestyle-Journalimus ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. Einleitung
1.1 Themenfeld und Schwerpunkte
Die Begriffe People- und Lifestyle-Journalismus werden in Deutschland umgangssprachlich verwandt, wenn es um die Beschreibung oder Auseinandersetzung mit besonders populären Formen des Journalismus geht: Gemeint sind Formate, in denen entweder prominente Namen (engl. people) den Stellenwert der Nachricht bestimmen, oder Formate, die eine ganze Produkt- und Lebenswelt (engl. lifestyle) in den Vordergrund stellen. Mischformen ergeben sich, wenn die vorgestellten – und oft zugleich beworbenen – Lebens- und Produktwelten einen Star und sein Star-Sein charakterisieren. Wochenzeitschriften wie „CLOSER1 oder INTOUCH2 gehören zu den jüngeren Presseerzeugnissen, die sich in Deutschland als Mischformen diesem Genre verschrieben haben. Populäre Lifestyle-Blogs (Stand: 2017) wie BIBIS BEAUTY PALACE3 der Kölnerin Bianca Heinicke gehen noch weiter: Hier wird der Blogger selbst zum Star auf YOUTUBE.DE. Der Blogger selbst stilisiert sich zum prominenten Produkttester und zur Lifestyle-Ikone. Aber ist das Lifestyle-Journalismus oder eine neue Spielart von Public Relations4 (PR)? Was genau meinen wir, wenn wir von People- und Lifestyle-Journalismus reden? Der Münchner Kommunikationswissenschaftler Thomas Hanitzsch hat 2012 einen Internet-Beitrag über den Boom des Lifestyle-Journalismus unter der vielsagenden Überschrift „Ein Stück Orientierung in der Welt des Konsums“ 5 veröffentlicht, demnach der Lifestyle-Journalismus die Funktion eines Leit- und Orientierungssystems für den Konsumenten einnimmt. Auch das deutet darauf hin, dass die Grenzen zwischen Journalismus und Content Marketing6 ins Fließen geraten sind. Ein Grund mehr, sich diese modernen journalistischen Formen anzuschauen. Ihr Siegeszug ist mitentscheidend für das Selbstverständnis der Journalisten im 21. Jahrhundert. Ihre Entwicklung entscheidend für eine fundamentale Ortsbestimmung: Wo sind die Grenzen des Journalismus? Wie grenzt sich ein selbstbestimmter Journalismus von der Werbeindustrie ab? Ist eine Abgrenzung überhaupt noch möglich oder nötig?
Im Zentrum dieses Buches stehen der deutsche People- und der Lifestyle-Journalismus und seine oben genannten Mischformen. Die sind auf den ersten Blick dem Bereich des Boulevard-Journalismus zuzuordnen: Superlative, Skandalisierungen, Emotionalisierung und Personalisierung von Themen, knallige Layouts, einfach zu verstehende Texte und der Focus auf die visuelle Darstellung sind typische Boulevardelemente. Beide teilen mehrheitlich Stil- und Erscheinungsformen mit dem klassischen Boulevard-Journalismus, sind aber eigenständige Formate, wie im Rahmen dieser Betrachtungen gezeigt werden soll. Ein Ziel ist es zu zeigen, was diese Formate so einzigartig und so erfolgreich macht.
Häufig wird von Print-Formaten die Rede sein. Dies mag altmodisch erscheinen angesichts des Booms der digitalen Medien. An dieser Stelle möchte ich vorgreifen und behaupten: Es spielt keine wesentliche Rolle, über welchen Medienkanal – Internet, Rundfunk, Print – und in welchem Format – Film, Video, Radio, Print-Online oder Multimedia-Mix – People- und Livestyle-Inhalte angeboten werden, Die Objekte und Personen, die im Zentrum stehen, sind die selben. Die Mechanismen, welche ich aufzuzeigen und zu erklären beabsichtige, sind grundsätzlich die gleichen. Die Frage ist eher: Wie werden sie angewandt? Wie werden sie dem jeweiligen Format angepasst?
Der erste Blick gilt der Presse, also dem Printbereich, der Wiege des deutschen People-Journalismus. Marktführer ist im People-Segment seit Jahren die BUNTE7, ein Magazin mit einer über 60-jährigen Geschichte8, für das ich seit 2001 als Journalist arbeite (Stand 2017). Herausgeberin Patricia Riekel richtete als Chefredakteurin (1997-2016) in den 1990er Jahren die damals klassische Illustrierte inhaltlich und stilistisch neu aus. Sie stellte die Berichterstattung über Prominente aus allen Gesellschaftsbereichen in den Mittelpunkt und prägte dafür in Deutschland den Begriff People-Journalismus. Bis heute gilt die BUNTE als das führende Print-Magazin, wenn es um Prominenten-Geschichten aus der deutschen Gesellschaft geht. Sie ist das vielfach kopierte Vorbild des deutschen People-Journalismus. Weil BUNTE exemplarisch für diese Form des Journalismus in Deutschland steht, wird sie phänotypisch im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Ein Gespräch mit Herausgeberin und Ex-Chefredakteurin Patricia Riekel soll veranschaulichen, wie BUNTE als People-Magazin neue Wege gegangen ist – und warum.
Ein besonders erfolgreicher Print-Titel im Lifestyle-Bereich war lange Zeit die monatliche Zeitschrift INSTYLE9, deren deutsche Lizenzausgabe 1999 BUNTE-Chefin Patricia Riekel als Chefredakteurin mit übernahm. Unter Chefredakteurin Annette Weber wurde sie in den Jahren 2007 bis 2015 weiter auf Erfolgskurs gebracht. INSTYLE ist laut Selbstbeschreibung „Das Magazin für Fashion, Beauty, Lifestyle & Stars“10. Dies ist für unsere Betrachtungen des People- und Lifestyle-Journalismus interessant: Hier wird augenscheinlich zwischen Mode- (Fashion), Körperpflege- (Beauty) Lifestyle- und People-Journalismus (Stars) unterschieden – und zugleich alles vermischt. Das wirft Fragen auf: Was ist mit Lifestyle überhaupt gemeint? Was unterscheidet und verbindet Lifestyle- und People-Journalismus mit seinem Blick auf Prominente? Das ist eine der zentralen Fragen, die zu klären sein wird.
Es ist kein Zufall, dass die INSTYLE ihren Erfolgskurs unter der Führung von Patricia Riekel aufnahm. BUNTE wie INSTYLE folgen einem bestimmten theoretischen Konzept, das von zentraler Bedeutung für das Verständnis des People-Journalismus und eines auf People abgestellten Lifestyle-Journalismus ist: der „Ökonomie der Aufmerksamkeit“11 von Georg Franck, deren Entwurf er 1998 präsentierte. Sie steht im Zentrum der theoretischen Erörterung dessen, was People- und Lifestyle-Journalismus ausmachen. Sie ist das entscheidende Instrument zum Verständnis eines nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Journalismus, für den ich mit diesem Buch mit Blick auf die Transformation des Journalismus ins 21. Jahrhundert eintreten möchte. Dazu später mehr.
Was ist mit dem Rest der Welt? Im englischsprachigen Raum wird der Begriff ,Tabloids’ für Boulevardformate aller Art verwendet und das Genre als ,yellow press’ betitelt – wegen der historischen Vorliebe für gelbe Farbe bei den Titelzeilen. Hier findet augenscheinlich das, was wir People-Journalismus nennen, durch den wachsenden Starkult ebenfalls große Verbreitung. In den USA ist der Online-Dienst TMZ12 einer der Vorreiter, wenn es darum geht, exklusives Wissen über die VIP-Einwohner Hollywoods zu sammeln und zu verbreiten. Ein weiteres Angebot dieser Art stellt RADAR.ONLINE dar. Das Erfolgs-Rezept: RADAR.ONLINE bezahlt für Informationen aus dem Promi-Umfeld ein Honorar und übernimmt deren Aufarbeitung und digitalen Vertrieb. Der Informant muss kein Journalist sein.13 Er muss weder schreiben noch sendereif sprechen oder filmen können, er muss nicht vor die Kamera treten. Die Weiterverwertung der Informationen ist Sache der Profis. Dort gilt: Es gibt keine Schlagzeilen ohne ein prominentes Gesicht. Wir werden allerdings sehen, dass das Verhältnis zwischen RADAR.ONLINE und der Prominenz ein anderes ist als das, was dem Konzept eines qualitativ hochwertigen People- und Lifestyle-Journalismus deutscher Prägung entspricht.
Ein weiteres Anliegen dieses Buches besteht darin zu verinnerlichen, welche journalistischen Ansprüche wir erfüllen müssen, um bei aller Effizienz den Erwartungen der Kunden (User) und unseren eigenen Ansprüchen gerecht zu werden und am Markt erfolgreich zu sein. Damit verbunden ist ein Plädoyer für einen qualitativ wertigen Journalismus, der mehr sein will als ein vereinnahmtes Marketinginstrument.
Soweit ein erster Umriss unseres Themenfelds. Fassen wir kurz zusammen: Wir wollen uns hier mit dem People- und Lifestyle-Journalismus und seinen Mischformen beschäftigen. Im Mittelpunkt dieser stehen Menschen, die durch ihr berufliches oder soziales Agieren von sich Reden machen. Ihr Lebensstil, ihre modischen Präferenzen oder normativen Ausrichtungen werden ebenso thematisiert wie soziales Fehlverhalten oder Beziehungskrisen. In den selbsternannten Lifestyle-Medien des Boulevards wird über Pflegemittel, Wohnaccessoires, kosmetische Tricks oder Ernährungsweisen berichtet, die den VIPs durch ihren VIP-Alltag helfen oder dem Normalverbraucher ein wie auch immer geartetes Wohlgefühl versprechen.
Was aber ist anders am deutschen People—und Lifestyle-Journalismus als am klassischen Boulevard-Journalismus? Die Antwort ergibt sich, wenn wir uns das Beispiel Burda Media anschauen. Das Verlagshaus Burda folgt in seiner strategischen Ausrichtung der erwähnten Theorie der Aufmerksamkeit. Dass eine wissenschaftliche Theorie zur Grundlage eines Medienverständnisses wird, welches den Journalismus des 20. Jahrhunderts ins 21. Jahrhundert transformieren soll – und zwar über einzelne Publikationen und Publikationsformen hinweg, ist ein bemerkenswerter Vorgang. Wobei zunächst zweitrangig ist, ob dies in jedem Fall funktioniert hat. Zumindest für BUNTE und INSTYLE kann ich dies aus eigener Erfahrung bejahen.
Verleger Hubert Burda und Patricia Riekel als Chefredakteurin (1997-2016) von BUNTE- betonen und betonten seit den 2000er Jahren in ihren Reden14, wie wichtig Georg Francks Essay Ökonomie der Aufmerksamkeit aus dem Jahr 1998 für ihre Arbeit und ihr Denken war beziehungsweise ist. Daher ist ein Hauptanliegen dieses Buches zu klären, was es mit dieser Ökonomie der Aufmerksamkeit auf sich hat. Dass sich ihre Umsetzung keineswegs auf Print beschränkt, zeigen die vielfältigen Aktivitäten des Medienhauses in den unterschiedlichsten Bereichen (u.a. INSTYLE, BUNTE, HUFFPOST, FOCUS, CHIP, das Sozialnetzwerk XING, DLD – Digital Life Design Conferences, die Suchmaschine CLIQZ).
Weil sich dieses digital verlegte Buch vor allem an junge und angehende Journalisten richtet, folgt der Theorie eine Einführung in die Praxis des People- und Lifestyle-Journalismus. Selbstgesetztes Ziel ist die Vermittlung grundsätzlicher methodischer Ansätze. Dabei ist es unerheblich, ob der Leser oder User ausschließlich für TV-, Radio-, Online- oder Printformate arbeitet oder arbeiten will. Bei allem technischen Fortschritt bleiben viele journalistische und psychologische Erkenntnisse aus der Arbeit im Alltag trotz neuer digitaler Formate gültig. Der Konsument bleibt der Mensch. Und der ändert in der Regel nur sehr langsam sein einmal entwickeltes Konsumverhalten so, dass es erst langfristig zu einer radikalen Veränderung kommt.
Eine Entwicklung in den Medien besteht darin, dass sich der Journalismus durch die Möglichkeiten des Internets und das dortige Wild-West-Gebaren mit Riesenschritten vom selbstauferlegten Pressekodex15 verabschiedet und sich vom Marketing vereinnahmen lässt. Native Advertising ist einer der Begriffe, der für die bewusste Vermischung von ursprünglich journalistischen Inhalten (Content) und Anzeigengeschäft (Advertising) steht. Drei weitere Begriffe, die Journalisten heute kennen sollten, fallen häufig im Zusammenhang mit dem Begriff Content Marketing im Internet:
Paid Media – der Anzeigenkunde zahlt für mediale Auftritte.
Owned Media – der Produktvermarkter, Händler oder Produzent bedient sich eigener Medienkanäle und entfällt den klassischen Medien im Zweifelsfall als Anzeigenkunde.
Earned Media– Produktvermarkter oder Produzent verdienen sich die mediale Berichterstattung, weil das Produkt oder der Hersteller oder die Geschichte hinter dem Produkt interessant ist.
Schon auf den ersten Blick wird deutlich, welche Folgen solche Abhängigkeitsverhältnisse auf den Content und den Hergang seiner Erzeugung haben können. Über diese Entwicklung des Journalismus hin zum Content Marketing wird zu sprechen sein.
1.2 Hypothesen, Ziele und Methodik
Das Buch will eine theoretische und praktische Einführung in den People- und Lifestyle-Journalismus sein. Allgemein werden beide journalistische Formate dem Boulevard-Journalismus zugeordnet, was in manchen vermeintlich intellektuellen Kreisen schon ausreicht, um eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema im Keim zu ersticken. Meines Erachtens verkennt eine solche Pauschalablehnung das Potenzial des People- und Lifestyle-Journalismus. Zudem stelle ich die Hypothese auf, dass Lifestyle- und People-Journalismus zwei Spielarten des Journalismus darstellen, die in besonderem Maße zukunftsträchtig für die Branche sind – wenngleich die Gratwanderung zwischen Journalismus und Marketing schmal ist, wie wir sehen werden.
In einem ersten Schritt soll herausgestellt werden, wo wir auf dem Medienmarkt dem Lifestyle- und People-Journalismus begegnen. Und es soll kurz dargestellt werden, wie der boulevardeske Zugang beider Formate themenunabhängig an Einfluss gewinnt – begünstigt durch die Ausdifferenzierung des Medienmarktes durch mehr Special Interest-Publikationen und die Konvergenz der Medien16.
In einem zweiten großen Schritt geht es um den Wettbewerb auf dem Medienmarkt. Ich will kurz erläutern, wie sehr die Durchkapitalisierung des Journalismus aufgrund des Wegbrechens der klassischen Werbeerlöse das Erscheinungsbild der Medien verändert hat und wieso dies die Boulevardisierung der gesamten Medienlandschaft vorantreibt. Darüber kommen wir zu dem, was meines Erachtens der Schlüsselbegriff für die Medien-Branche im 21. Jahrhundert ist: die Aufmerksamkeit.
Eine meiner Thesen ist, dass People- und Lifestyle-Journalismus das Grundgerüst für zwei zentrale (virtuelle) Plattformen sind, um den Austausch von Aufmerksamkeit industriell zu steuern und Aufmerksamkeitsgewinne zu generieren. Außerdem möchte ich erklären, warum die Veränderungen in der Medienbranche so revolutionär sind und nichts mit einer gewöhnlichen Krise zu tun haben.
Im Dritten Abschnitt des Buches stelle ich Georg Francks Entwurf einer Ökonomie der Aufmerksamkeit vor – ein Buch, das dem Verleger Hubert Burda als strategisches Grundsatzkonzept zur Ausrichtung seines Konzerns gedient hat. Ich möchte zeigen, wie dieses Werk den Blick auf den Mediennutzer und die Rolle der Medien verändert hat – wenn man sich des Denkmodells annimmt. Eine meiner Hypothesen ist es, dass Franck nahezu prophetisch eine Welt des Tauschens und Schenkens von Aufmerksamkeit beschreibt, die im 21. Jahrhundert mit Social Media realer denn je wird. Die Erörterung der Ökonomie der Aufmerksamkeit soll zeigen, warum der Wunsch nach gegenseitigem Austausch, nach prominenten Lebens-Vorbildern und der öffentlichen Bühne so stark ist. Sie soll zeigen, wie Aufmerksamkeit industriell entsteht – ein entscheidender Punkt, weil dies die zentrale Funktion des People- und Lifestyle-Journalismus als Aufmerksamkeitstauschplattformen ist.
Das vierte Kapitel ist der kritischen Rezeption der Ökonomie der Aufmerksamkeit gewidmet. Hier sollen die Einwände gegen Francks Konzept kurz erörtert und gezeigt werden, warum bei aller berechtigten akademischen Kritik das Modell Francks für die Medien-Praxis so relevant ist.
Warum meine These von der praktischen Relevanz der Ökonomie der Aufmerksamkeit meines Erachtens richtig ist, erläutere ich im fünften Kapitel. Das Medienunternehmen Burda hat die Ökonomie der Aufmerksamkeit zur Neuausrichtung genutzt. Im Bereich Lifestyle- und People-Journalismus waren und sind BUNTE und INSTYLE Paradebeispiele für die Umsetzung der Theorie in die Praxis. Experteninterviews mit den ehemaligen Chefredakteurinnen Patricia Riekel und Annette Weber sollen als eine qualitative Untersuchungsmethode17 Einblick in die Art der Umsetzung geben und die Zusammenhänge zwischen Theorie und Praxis aufzeigen. Im Folgenden zeige ich, was genau sich hinter den Begriffen People-Journalismus und Lifestyle-Journalismus verbirgt, und warum es ein Fehler ist, beiden Formaten grundsätzlich die alleinige Befähigung zu Oberflächlichkeit zu unterstellen. Insbesondere für den Bereich Lifestyle soll aufgezeigt werden, wie eng dieser Begriff mit den philosophisch und soziologisch wichtigen Begriffen wie Lebensführung und Lebensstil verbunden ist und welche Kapazitäten hier freigesetzt werden können.
Das sechste Kapitel widmet sich der Frage, warum Boulevard-Formate so erfolgreich sind und die Unterschiede zwischen sogenannter ernster Kultur und populärer Unterhaltung weiter verwischen werden. Anhand des Pressekodexes als selbstverpflichtendem Qualitätsmaßstab will ich zeigen, dass Boulevard-Journalismus und insbesondere der People- und Lifestyle-Journalismus nicht per se qualitativ minderwertige, journalistische Formate sind. Mit einem kurzen Verweis auf das Medienrecht möchte ich zeigen, welche Kriterien helfen, sich im journalistischen Alltag auf der Seite eines qualitativ hochwertigen Journalismus zu bewegen.
Im Kapitel Nr. 7 steht die Praxis im Vordergrund. Die wichtigen Stilmittel des People- und Lifestyle-Journalismus werden mit Blick auf die Erkenntnisse der Ökonomie der Aufmerksamkeit vorgestellt.
Mehrfach habe ich zuvor auf das kritische Verhältnis zwischen Journalismus und Marketing hingewiesen. Kapitel Nr. 8 stellt einige für Journalisten relevante Marketingbegriffe vor. Marketing-Instrumente wie Native Advertising, Siegelgeschäfte und Storytelling werden kritisch analysiert und mit Blick auf die Gefahren, die von ihnen für einen unabhängigen, qualitativ hochwertigen Journalismus ausgehen bewertet.
Im neunten Kapitel wird der Zusammenhang zwischen Journalismus und Ökonomie vertieft. Die veränderte ökonomische Situation der Medienhäuser, die über ihre klassischen journalistischen Kanäle – Print und Rundfunk – lange ein Monopol auf den Werbemarkt hatten, hat zerstörerische Wirkungen auf die Medienlandschaft. Disruptive Innovation heißt das Stichwort. Der Existenzkampf der Traditionshäuser führt zu einer Durchkapitalisierung aller Bereiche. Der verlegerische und journalistische Ehrgeiz ist in weiten Teilen der Branche bereits der Kosten-Nutzen-Analyse der kaufmännischen Geschäftsführer gewichen. Warum das so ist, soll in diesem Kapitel erörtert werden.
Einen Blick in die Zukunft mit drei möglichen, radikalen Szenarien für den Journalismus im 21. Jahrhundert bildet das neunte Kapitel. Ich will aufzeigen, potentiellen Richtungen der Journalismus der Zukunft einschlagen kann.
Kapitel zehn umfasst die Schlussbetrachtungen und soll die wesentlichen Aspekte der Arbeit bündeln und nochmals zur Rekapitulation aufgreifen. Es soll zusammenfassen, was wir an Erkenntnissen gewonnen haben und welche Probleme sich noch stellen.
2. Journalismus: Der Kampf um Aufmerksamkeit
2.1 People und Lifestyle-Journalismus. Eine erste Standortbestimmung
Wenn wir uns mit Presseprodukten aus dem Bereich People- und Lifestyle-Journalismus wie BUNTE und INSTYLE beschäftigen, bewegen wir uns im Bereich der Publikumszeitschriften18. Das bedeutet: „periodische Druckwerke mit kontinuierlicher Stoffdarbietung (...), die mit der Absicht eines zeitlich unbegrenzten Erscheinens mindestens viermal jährlich herausgegeben werden, soweit sie keine Zeitungen sind“.19 Der Begriff Publikumszeitschriften ist abzugrenzen von den wissenschaftlichen oder berufsbezogenen Fachzeitschriften für Spezialisten: der Fachpresse.
Die inhaltliche Bandbreite der Publikumszeitschriften ist entsprechend der oben zitierten Definition sehr groß. Sie reicht vom Männer-Magazinen und Sport-Publikationen bis hin zur Frauenzeitschriften, Rätselheften und diversen Hobby-Magazinen. Allgemein wird die Auflagenstärke als weiteres Kriterium zur Abgrenzung gegen die Fachpresse hinzugefügt sowie die Verständlichkeit für Nicht-Fachleute angeführt, um die Publikumspresse von der Fachpresse abzugrenzen. Alle Titel haben ein gemeinsames Ziel: Sie wollen am Markt erfolgreich sein, ihr Publikum finden und müssen deshalb um Aufmerksamkeit kämpfen.
Ein Sonderfall sind die modernen Special-Interest-Publikationen. Sie sind deshalb interessant, weil auf der Suche nach Marktnischen immer mehr dieser Angebote erscheinen – eine Entwicklung, die vom Internet kommend auf den Pressemarkt einwirkt. Wie kommt das? Die Zukunft des Journalismus liegt im Bereich der Special Interest-Angebote, diese These stellte 2014 Andreas Wolfers in einem Youtube-Video auf. Der Ex-STERN-Textchef und Chef der Hamburger Journalisten-schule Henri-Nannen erklärte, dass kleinere Publikationen im Special-Interest-Bereich für ein kleines Marktsegment die besten Überlebenschancen auf dem expandierenden Multimedia-Medienmarkt hätten: „In fünf Jahren gibt es keine General-Interest-Magazine mehr“. Seine Prognose stellt sogar die Zukunft von Generalisten im Onlinebereich in Frage: „Die Zukunft liegt in Special-Interest-Angeboten im Netz. Kleine Zielgruppen, die hochwertigen Inhalt genau auf ihre Interessen zugeschnitten erhalten und dann aber auch bereit sind, dafür hohe Preise zu zahlen. Das ist meines Erachtens die Zukunft des digitalen Journalismus."20 Ob Wolfers recht hat? Dann gäbe es in rund zwei Jahren nur noch Special-Interest-Anbieter, was bei allen realistischen Abwägungen 2017 unwahrscheinlich erscheint. Doch eine Tendenz ist, dass seit Jahren mehr und mehr Special-Interest-Angebote auf dem klassischen Print-Markt auftauchen und teilweise schnell wieder verschwinden. Handelt es sich bei diesen Formaten um Publikumszeitschriften oder Fachzeitschriften?
Die traditionellen Fachzeitschriften des 20. Jahrhunderts werden in der Fachliteratur im Allgemeinen wie folgt definiert: Fachpresse sind „periodische Publikationen über bestimmte Fachgebiete, die der beruflichen Information und Fortbildung eindeutig definierbarer, nach fachlichen Kriterien abgrenzbarer Zielgruppen dienen und überwiegend postalisch vertrieben werden.“21 Hat diese Definition noch Gültigkeit in einer Zeit, in der sich praktisch sämtlich Printformate mehr oder weniger multimedial aufstellen? Mit Blick auf die zu Beginn des Abschnitts zitierte Definition von Publikumszeitschrift, die der Kommunikationswissenschaftler Klaus Merten in seinen Ausführungen22 vom Statistischen Bundesamt (1992) übernommen hat, sind die modernen Special-Interest-Publikationen meines Erachtens viel mehr den Publikumszeitschriften zuzurechnen. Durch die zunehmende thematische Vielfalt und fortschreitende Spezialisierung von Medienpublikationen sind moderne Special-Interest-Publikationen Angebote für den Massenmedienmarkt. Sie agieren gleichberechtigt mit den traditionellen Publikumszeitschriften am Markt – und sie agieren multimedial. Damit verlassen sie die klassischen Sektor der Publikumszeitschriften und das reine Printgeschäft. Laut Statistik des Vereins der deutschen Fachpresse wuchs der Umsatz der Fachzeitschriften 2016 um 1,5 %. (2015: 1,5 %). Der Erlös der Digitalmedien in diesem Bereich stieg 2016 um 9,6 % (2015: 8,6 %).23 Mit der klassischen wissenschaftlichen und berufsfachlichen Presse im Postvertrieb hat das nur noch wenig zu tun. Voraussichtlich werden die Unterschiede zwischen Fachpresse und den Special-Interest-Publikationen aus dem Bereich der Publikumspresse thematisch weiter verschmelzen und sich wohl in erster Linie durch ihre Allgemeinverständlichkeit abgrenzen. In diesem Bereich gibt es seit Jahren eine interessante Entwicklung: Dadurch, dass die digitale Medienproduktions-Hardware und -Software frei zugänglich, relativ leicht bedienbar und praktisch für jedermann erschwinglich geworden ist, verfallen die historisch gewachsenen Produktionsmonopole oder –oligopole der Medienunternehmen. Parallel fallen die alten Wissensbastionen. ,Abtrünnige“ Experten und Idealisten bieten ihr Wissen vor den abwehrenden Burgmauern der Allgemeinheit an, so dass sich beispielsweise unter youtube.de Beiträge zur Quantenmechanik finden lassen oder zu komplexen Problemen der Mathematik. Der gesamte Medienmarkt erlebt eine Revolution – oder die Zerschlagung durch disruptive Innovation, je nach Standpunkt des Betrachters.
2.1.1 Disruptive und evolutionäre Innovationen
An dieser Stelle ist ein Exkurs zur Begrifflichkeit der disruptiven Innovation notwendig, weil wir immer wieder über die Beziehung zwischen Medien, Medienmärkten und Ökonomie sprechen werden: Moderne Wirtschaftswissenschaftler unterscheiden grundsätzlich zwischen zwei Innovationstypen – der evolutionären und der disruptiven Innovation. Die evolutionären Innovationen sind klassische Verbesserungen grundsätzlich bekannter Techniken. Ihr Ziel sind beispielsweise Leistungssteigerung, größere Effizienz oder preiswertere Herstellungsverfahren. Disruptive Innovationen hingegen fallen in der Leistung häufig hinter dem ,state of the art’ zurück haben aber andere Qualitäten24. Die daraus resultierenden Produkte „weisen im Vergleich zu konventionellen Produkten hinsichtlich der Anforderungen der wichtigsten Kunden zunächst deutliche Leistungsnachteile auf. (...) Indes zeigen disruptive Innovationen eindeutige Vorteile bei anderen, neuen Kriterien, die zunächst allerdings nur bei einer Randgruppe von Kunden von Bedeutung sind. Disruptive Produkte sind meist billiger, einfacher, kleiner und in der Summe anwendungsfreundlicher. (...) Der Markt und/oder die Produktanwendungen sind anfangs in aller Regel nicht klar zu bestimmen. (...) Für etablierte Unternehmen sind disruptive Innovtionen zunächst uninteressant, da sich ihre wichtigsten Kunden dafür nicht interessieren.“ 25 Eine Grundlage der Analysen von Clayton M. Christensen, Kurt Matzler und Stephan Friedrich von der Eichen sind Beispiele aus der Entwicklungsgeschichte der Computer-Diskettenlaufwerke von 14-Zoll (um 1970) auf , 8-Zoll (um 1978) über 5,25 Zoll (1980) bis zu 3,5-Zoll (ab 1985), 2,5-Zoll (1990) und 1,8 Zoll (1992). Das Entscheidende: Die Minimalisierung der Laufwerke ging nicht mit einer grundsätzlichen Leistungssteigerung einher. Im Gegenteil: Die Speicherkapazität war meist geringer, der Preis pro Speichereinheit in Relation gesehen viel höher. Aber die Einführung von Mini-Computern, Desktops, Laptops und schließlich Notebooks revolutionierte jeweils den Markt, weil neue Käuferschichten mit anderen Präferenzen von neuen Marktteilnehmern erschlossen wurden. Das brachte die etablierten Produzenten in ein Dilemma. Zwar war nicht jede Laufwerkminimierung Ergebnis einer disruptiven Innovation, sondern teilweise nur ein evolutionärer technischer Fortschritt.26 Aber die großen Revolutionen – vom Mainframe-zum Mini-Computer oder vom Desktop zum Laptop – zeigen eindeutig den Charakter disruptiver Innovationen. Man muss kein Ökonom sein, um zu erkennen, welche Parallelen sich zur Entwicklung der Medienbranche ergeben. Die Eroberung der Medienmärkte durch Onlineangebote ist so eine disruptive Innovation: zunächst qualitativ schlechtere, journalistische Inhalte fanden die Aufmerksamkeit von Randgruppen, bevor sich plötzlich große Interessentenkreise fanden – zumal sie äußerst preisgünstig oder gar kostenlos waren. Bevor die Masse der traditionellen Medienunternehmen die Chancen von Multimedia richtig einschätzten, waren die neuen Marktteilnehmer an ihnen in Sachen Innovation vorbeigeschossen.
2.1.2 Special-Interest-Angebote ohne Zugangsbeschränkung – die Revolution durch das Internet
Zurück zur Ausweitung des Felds der Special-Interest-Angebote. Ein Nebeneffekt von größter Tragweite ist, dass Themen, die sonst der Fachpresse und einem Fachpublikum vorbehalten waren, in ständig wachsender Vielfalt das Internet erobern – und damit erstmalig de facto allgemein zugänglich werden. Wenn ich beispielsweise Bärtierchenfan bin, finde ich im Internet mindestens ein spezielles Forum27, das mir diese winzigen Mehrzeller näher bringt. Selbst Grillen ist als Sportdisziplin online vertreten28 – mit einer Themenpallette vom Grillbau bis professioneller Fleischkunde. Beide Internetseiten richten sich an eine hochspezialisierte Interessengruppe. Aber beide Websites sind mühelos von jedem Internetzugang in Deutschland aus für jeden User aufrufbar. In Zeiten der Vorherrschaft von Print und klassischem Rundfunk war der Zugang zu solchen Informationen für den Normalbürger mühsam: Entweder kannte man einen ,eingeweihten’ Fachmann oder musste aufwendig über Kleinanzeigen oder Mund-zu-Mund-Propaganda (heute: Social Media) versuchen, Material zu dem bestimmten Thema aufzuspüren und zu sammeln.
Ein Beispiel aus dem Einzelhandel soll veranschaulichen, was so neu an diesem Trend zum barrierefreien, non-elitären Konsum ist: Noch Ende des 20. Jahrhundert war es gewerblichen Handwerkern vorbehalten, mit Profigerät von Marken wie Stihl, Makita oder Fein zu arbeiten. Diese fürs Gewerbe ausgelegten Maschinen gab es nur bei speziellen Fachhändlern oder im Großhandel. Der Einkauf im Großhandel war Gewerbetreibenden vorbehalten. Profimarken als privater Hobbyhandwerker zu bekommen, war mitunter schwierig. Heute finden sich diese Marken in vielen Baumärkten. Und wenn es sie in einer Filiale nicht gibt, dann bei diversen Internet-Händlern. Oder denken Sie an die seit etwa den 2010er Jahren erblühende Craftbeer-Szene in Deutschland: Früher bezogen ausgebildete Bierbrauer ihre Hefen und ihren Hopfen bei Spezialisten. Es waren weitgehend geschlossene Rohstoff-Fachmärkte. Heute kann sich jeder, der sich etwas bemüht und ,googelt’, die exotischsten Hefen und Hopfensorten nach Hause liefern lassen. Solange keine gesetzlichen Schranken greifen, wie beispielsweise bei Sprengstoff oder bestimmten Waffen, ist praktisch alles legal und frei für jeden verfügbar. Die Gebrauchsanweisung gibt es gratis im Internet dazu. Das ist der größte Gewinn der digitalen Revolution: Das enorme plus an Informations- und Meinungsbildungsfreiheit, der Pluralismus des Netzes der vielen Meinungen und Macher.
2.1.3 People- und Lifestyle-Journalismus und ihre Bedeutung für Special-Interest-Angebote
Warum sollten uns die Special-Interest-Angebote überhaupt interessieren, wenn wir den People- und Lifestyle-Journalismus betrachten wollen?
Erstens: Weil ich aufzeigen möchte, dass diese journalistischen Stilformen praktisch keine thematischen Schranken kennen und deshalb einen wesentlichen Anteil an der Gestaltung der Medien von morgen haben könnten.
Zweitens: Weil die Medien- und Konsumwelt des 21. Jahrhunderts nach barrierefreien Zugängen und einfacher, non-elitärer Konsumierbarkeit verlangt. Deshalb setzt sich die vom US-Medienwissenschaftler Neil Postman für das Fernsehen diagnostizierte Boulevardisierungstendenz (Buchtitel: Wir amüsieren zu zu Tode) vermutlich in allen Medien fort. Neil Postman beschwor düstere Zeiten herauf: „Wenn ein Volk sich von Trivialitäten ablenken lässt, wenn das kulturelle Leben neu bestimmt wird als eine endlose Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen, als gigantischer Amüsierbetrieb, wenn der öffentliche Diskurs zum unterschiedslosen Geplapper wird, kurz, wenn aus Bürgern Zuschauer werden und ihre öffentlichen Angelegenheiten zu Varieté-Nummern herunterkommen, dann ist die Nation in Gefahr – das Absterben der Kultur wird zur realen Bedrohung.“ 29 Eines konnte Neil Postmann damals noch nicht wissen: Die Möglichkeit zum Medienkonsum beschränkt sich nicht mehr auf ein lineares Live-Angebot. Video-on-Demand und Streaming-Dienste heben die Zeitfenster von einst auf, die die oligarchisch operierenden Massenmedien-Unternehmen ausfüllten. Die Konsumzwänge, die das lineare Fernsehen mit sich brachte, sind aufgehoben: Niemand muss mehr zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein, um einen Sendebeitrag zu sehen. Und in der Aufhebung der Informations- und Unterhaltungs-Feudalherrschaft liegen je nach Standpunkt Segen und Fluch: Für nahezu jeden Geschmack und Anspruch findet sich ein Medienangebot. Und das barrierefrei und weltweit – im Internet. Dafür herrschen teilweise anarchische Verhältnisse auf dem einst wohlgeordneten Medienmarkt. Hierin liegt für Journalisten die Chance als weitgehend selbstbestimmter Marktteilnehmer und , Ich-AG zu agieren – ebenso wie die Gefahr des Verlusts des Arbeitsplatzes in einem der traditionellen Medienunternehmen.
Für People- und Lifestyle-Formate ist Postmans Infotainment-Welt prinzipiell keine Bedrohung. Im Gegenteil: Als gefragte journalistische Formen des Boulevard finden sie am ehesten ein Auskommen auf dem hart umkämpften Medienmarkt. In welcher Qualität sie journalistisch geliefert und abgefragt werden, ist ein anderes Thema, zu dem wir noch kommen werden und das einen Kernbereich dieses Buches darstellt.
Nochmal: Warum interessiert uns das? Weil wir uns klar machen sollten, das Lifestyle- und People-Journalismus sich nicht auf eine bestimmte Themenwelt, Zielgruppe oder Medien beschränken. Sie sind Vermittlungsformen, um selbst komplexere Themen allgemein verständlich zu vermitteln. Denn am Ende stehen alle Medienangebote, die nicht öffentlich-rechtlich oder beispielsweise durch Stiftung finanziert werden, vor der gleichen Herausforderung: Sie müssen die Aufmerksamkeit des Kunden gewinnen, halten und in beträchtlichem Umfang Einnahmen erwirtschaften. Das gelingt nur, wenn der Medienkonsument das Angebot annimmt und schätzt.
Ein am Markt erfolgreiches Beispiel für modernen Lifestyle-Journalismus im Bereich Special-Interest ist die Zeitschrift BEEF!30. Am 15.10.2009 begann das Hochglanzheft als Versuchsprojekt. Die Zielgruppe: Fleischliebhaber. Erst später etablierte sich das Magazin aufgrund der wachsenden Nachfrage als Periodika. Heute, bei einer verkauften Auflage von 60.000 Exemplaren und 6 Ausgaben plus weitere Sonderheften pro Jahr, ist das Magazin im klassischen Sinne eine Publikumszeitschrift. Der Interessentenkreis ist klar definiert, aber das Medium ist jedermann überall in Deutschland zugänglich. Die BEEF! ist in meinen Augen typisch für ein neueres Genre: dem Special-Interest-Magazin für alle. Das bedeutet: Niemand wird grundsätzlich von dem Konsum ausgegrenzt. Man muss weder Gewerbetreibender sein noch einem Berufsverband im Bereich der Gastronomie angehören, um barrierefreien Zugang zu dem Medium zu haben. Inhaltlich richtet sich das Magazin an eine sehr spezielle Kundengruppe: an vornehmlich männliche Gourmets, die ein Faible für hochpreisige Küchen- und Kochgerätschaften sowie exquisite und exotische Zutaten hegen. Der hohe Heftpreis um 10 Euro – Abo- und Einzelverkauf variieren leicht – schreckt Nichtinteressierte ab und stellt eine wirtschaftliche und psychologische Zugangsbegrenzung dar, trotzdem ist der grundsätzlich freie Zugang sichergestellt. Bei der BEEF! Handelt es sich nicht um eine Fachpublikation im traditionellen Sinne. Sie ist ein Lifestyle-Magazin für ein Nischenpublikum auf dem Massenmedienmarkt. Es hilft dem fachinteressierten Leser, sich in seiner ausgesuchten Warenwelt zu orientieren und im Idealfall seine Vorstellung vom Kochen und dem luxuriösem Genießen zu verwirklichen. Das Magazin arbeitet mit Elementen des Lifestyle- und People-Journalismus: People-Geschichten, spektakuläre Food(!)-Fotos, aufmerksamkeitsheischende Schlagzeilen und Layouts, Verknappungen, Verkürzungen und emotionale Überschriften prägen die BEEF! Trotzdem ist sie ein Luxus-Produkt für den High-End-Foodmarkt innerhalb des Medienmarktes. Damit ist sie ein zukunftsweisendes Beispiel für die Ausdifferenzierung auf immer speziellere Publikumsgruppen, obwohl sie auf dem Markt der Publikumszeitschriften agiert. Statt Fachmedium im klassischen Sinne zu sein zielen journalistische Angebote wie BEEF! auf ein Publikum, das selbst entscheidet, wie fachkundig es ist. Das hat einen doppelten Effekt: Zum einen werden solche Special-Interest-Plattformen zu Prestigeträgern und Expertenforen und erregen damit Aufmerksamkeit. Zum anderen wächst durch den barrierefreien Zugang die potenzielle Kundschaft beträchtlich. Dagegen ist der Online-Auftritt von BEEF! bewusst bescheiden31 gestaltet: Hier werden nicht kostenlos wertvolle Inhalte verschleudert. Der Auftritt ermöglicht den Einzelbezug des Heftes, den Abschluss eines Abos und einen Blick ins Inhaltsverzeichnis. Außerdem wird der Besucher zum Online-Shop weitergeleitet und beispielsweise auf BEEF!-eigene Veranstaltungen und Seminare hingewiesen. Doch das war es schon. Den folgenreichen Fehler der Anfangsjahre des Online-Journalismus, Inhalte sorglos zu verschenken, hat man bei BEEF! nicht mehr gemacht. Das Hochglanzheft ist das journalistische Produkt. Die Internetseite ist ein ergänzendes Marketingelement, mehr nicht. Es wird klar vom journalistischen Inhalt abgegrenzt.
Die sogenannte „Konvergenz der Medien“32 sorgt dafür, dass die Grenzen zwischen Presse, Rundfunk, Film und Multimedia-Angeboten mehr und mehr verschwimmen. Zeitungen- und Zeitschriftenverlage betreiben Online-Portale, ebenso TV- und Radiosender, die mitunter Printtitel vertreiben. Im Gegenzug bieten Internet-Plattformen Film- und Video- oder Hörfunkbeiträge an. Deshalb macht die klassische Einordnung von Medien in zu eng gewordene, tradierte Schubladen meines Erachtens wenig Sinn, weshalb ich für meine zugangsdefinierte Einordnung plädiere, die sich durch eine thematische Unterteilung noch verfeinern ließe. Wozu überhaupt beschäftigen wir uns an dieser Stelle mit der Einordnung von Medienformaten?
Weil uns der Auftritt verschiedener Formate auf dem Medienmarkt interessiert. Wir haben bereits über die Tendenz zur Boulevardisierung gesprochen. Das hat einen Grund: Es gibt einen Wettbewerb um Werbekunden und Sponsoren und einen Wettbewerb um Konsumenten (Leser, Zuschauer, Zuhörer, User). Die Frage ist: Hat dieser Wettbewerb in seiner fortschreitenden Entwicklung Auswirkungen auf den Journalismus, die Art des journalistischen Arbeitens? Welche journalistischen Stilformen haben die besten Überlebenschancen?
Immer wieder wird Kritik seitens der klassischen Medien laut, dass ungleiche Wettbewerbsbedingungen es Rundfunk und Presse schwer machten, gegen die Online-Anbieter zu bestehen. Während die einen selbstauferlegten normativen und formalen Beschränkungen unterliegen, bewegen sich die anderen noch immer in einer juristischen Grauzone, in der teilweise nach Wild-West-Manier agiert wird und der stärkere oder dreistere gewinnt. Wenn wir später über Qualitätsmerkmale des Lifestyle- und People-Journalismus diskutieren werden, ist das von entscheidender Bedeutung.
Ein Beispiel für die Wettbewerbs-Brisanz, welche die teilweise noch immer juristisch unklare Stellung von Internet-Angeboten in Deutschland mit sich bringt, soll folgender Fall verdeutlichen: Im Frühjahr 2017 sorgte Tobias Schmid, Chef der Landesmedienanstalt von Nordrhein-Westfalen, für Aufsehen in der Branche, als er angesichts des Falls des in die Kritik der Landesmedienanstalt geratenen Online-Kanals „Piet Smiet TV“ erklärte: „Was aussieht wie Rundfunk, und sich bewegt wie Rundfunk, ist Rundfunk“33.
Hintergrund ist, wie gesagt, die juristische Stellung neue Medien-Angebote. Konkret: Die des Gamer-Kanals Piet Smiet TV, der sieben Tage die Woche 24 Stunden am Tag sogenannte „Let’s Play“-Videos zur Verfügung stellt und 2,1 Mio. Abonnenten hat (Stand: März 2017). Deshalb und weil er seinen Kunden ein Angebot nach Sendeplan liefert, ist er nach Ansicht der Medienwächter lizenzpflichtig. Wenn aber ein solcher Onlineanbieter lizenzpflichtig ist, untersteht er der Aufsicht der jeweiligen Landesmedienanstalten. Und die sind nicht nur Lizenzgeber, sondern Wächter über die Einhaltung von Menschenrechten, Jugendschutz, Naturschutz und Medienvielfalt. Klingt langweilig? Folgt man der Argumentation und denkt weiter, steht mittelfristig die juristische Neu-Einordnung von FACEBOOK & Co zur Diskussion: Wer bestimmt, was diese Medien dürfen und was nicht? Wer darf Kontrolle auf sie ausüben? Wie sieht diese Kontrolle aus? Dürfen die Landesmedienanstalten zukünftig Facebook überwachen? Im Fall von Piet Smiet TV endete der Vorstoß der Landesmedienanstalt NRW mit der Kapitulation des Online-Anbieters: Piet Smiet TV beantragte innerhalb der gesetzten Frist keine Rundfunklizenz und nahm das betroffene Produkt vom Markt.
Gerade weil sich die Medienangebote thematisch und multimedial immer weiter auffächern, wächst der Grad des Verdrängungswettbewerbs. Und das ist entscheidend für das Verständnis von Boulevardmedien, zu denen wir die modernen Lifestyle- und People-Journalismus-Formen am Anfang gezählt haben. Mit dem Wettbewerb erklärt sich die Boulevardisierung der Medien: Nur wer laut genug schreit, wird wahrgenommen – so scheint es zumindest. Und das über alle inhaltlichen und formalen Einordnungen hinweg. Es ist ein Wettbewerb um Konsumenten und Anzeigenkunden. Es ist ein Wettstreit um Aufmerksamkeit. Im folgenden möchte ich allerdings zeigen, dass das ungerichtete Schreien allein nicht genügt, mittel- und langfristig Aufmerksamkeit zu generieren. Der Content, seine Aufbereitung und seine Präsentation müssen stimmen. Der Journalist wird – zumindest teilweise – zum Unternehmer in eigener Sache.
2.2 Der klassische Wettbewerb
Es gibt grundsätzlich zwei historisch gewachsene Möglichkeiten, journalistische Inhalte (Content) zu verkaufen: über Abo-Systeme (Paid Services) oder den Einzelverkauf (Paid Content). Beim Abo-System zahlt der Kunde (User) im Vertrauen auf die gewohnte Form, Qualität und gesellschaftspolitische Ausrichtung der Berichterstattung eines Medienerzeugnisses für die kontinuierliche Belieferung. Deshalb wurde und wird in diesem Umfeld gerne wertend von seriösem Journalismus oder Qualitätsjournalismus gesprochen – was meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß und heute sachlich falsch ist. Zumal die Konsumenten heute mehr wollen, als nackte Fakten und wohl recherchierte, aber trocken aufbereitete Hintergrundberichte. Ein gutes Beispiel für den gesellschaftlichen Wandel und die Folgen für die Medienwelt ist die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG.34 Jahrzehntelang war sie das selbst ernannte Flaggschiff eines seriösen, konservativen Journalismus in Deutschland. Bis 2007 verzichtete die Zeitung grundsätzlich auf Bilder auf der Titelseite. Nur bei außergewöhnlichen Ereignissen wie zuletzt der Wahl des deutschen Kardinals Josef Ratzinger zum Papst 2005 machte die FAZ eine Ausnahme35. Erst unter dem Druck eines sich wandelnden Leseverhaltens und ausbleibender Kunden wurde die FAZ – zumindest für ihre Verhältnisse – boulevardesker. Die schwer leserlichen Frakturschrift-Überschriften mussten weichen. Ein leserfreundlicher Sonntagsableger, die FRANKFURTER ALLGEMEINE SONNTAGSZEITUNG36, wurde gegründet. Hier finden sich Elemente des Lifestyle- und People-Journalismus. Plötzlich wird der Kleidungsstil von Stars analysiert, gehen Rubriken wie ,Leben’ oder ,Wohnen’ auf die Gefühlswelt des Kunden ein. Sogar eine wöchentliche Nabelschau auf die Berichte der Kollegen aus dem Boulevard gibt es unter dem Titel ,Herzblatt-Geschichten’, sodass sogar der FAS-Leser in den Genuss kommt, etwas über Pop- und Schlagersängerin Helene Fischer zu erfahren37 – wenn auch indirekt und unter der meines Erachtens bigotten Maske der Medienkritik. Ob die Qualität der FAS hinter der FAZ zurücksteht? Es hat nicht den Anschein. Mag der Abonnent auf die FAS setzen, weil er auf die Qualität der journalistischen Beiträge vertraut. Die junge FAS zielt mit ihrem ansprechenden Layout und moderner Themensetzung eindeutig auch auf den Einzelkäufer. Womit wir zum zweiten Einnahmemodell kommen.
Diese andere Möglichkeit ist die Einnahmequelle Einzelverkauf (kurz EV; Retail Sale). Der Einzelverkauf ist das Kerngeschäft der sogenannten Boulevardpresse. Das Wort Boulevard hat seine Wurzeln im mittelniederländischen Wort „bulwerc“ – im Deutschen: Bollwerk. Der Begriff wurde als Bezeichnung für befestigte, städtische Ringstraßen auf oder neben der ehemaligen Stadtmauer üblich. Der Boulevard, also die belebte Straße, wurde zu dem Ort, an dem Propaganda-Verkäufer38 skandalisierte Nachrichten und Klatsch in Form von gedruckten Zeitungen im Einzelverkauf anboten. Der Begriff Einzelverkauf ist ein Schlüssel zum Verständnis der Boulevardmedien. Während beispielsweise auf nachrichtliche Berichterstattung setzende Presseorgane auf ihren guten Ruf bei Abonnenten und Werbepartnern, als Informationsquelle und verlässliche Institution bei der Einordnung von Nachrichten bauen, wollen Boulevardmedien unterhalten – daher der Begriff Infotainment39 – und im Einzelverkauf Konsumenten (User) gewinnen. Dem liegt die Erkenntnis zugrunde, dass die ins Visier genommene Straßenkundschaft die langfristige Abo-Bindung eher scheut und nur auf bestimmte Schlüsselreize reagiert und journalistischen Content konsumiert. Nachteil: Nicht alle potentiellen Werbekunden schätzen das boulevardeske Umfeld. Vorteil: Gerade das Massen-Geschäft kann für potentielle Werbekunden, die Massenware anbieten, interessant sein. Im Extremfall wird das Medienunternehmen selbst zum Werber und Produktanbieter. In Deutschland hat sich die Tageszeitung BILD40 unter anderem mit eigenen Bibel-Editionen (Dürer-Bibel, Licht-Bibel und zuletzt Jerusalem-Bibel41) zum Vorreiter dieses Geschäftsmodells gemausert. BILD ist längst mehr als eine Zeitung. BILD ist eine Marke und Vermarktungsplattform inklusive Digital-, Sonder- und Wochenendausgaben sowie themenspezifischen Extensions.
Um gegen die Konkurrenz zu bestehen, waren und sind aufmerksamkeitsheischende Schlagzeilen, spektakuläre Geschichten und bewegendes Bildmaterial der Schlüssel zum Erfolg. Eine ältere Lexikon-Definition fasst die Merkmale der Boulevard-Presse wie folgt zusammen: „Bezeichnung für einen Zeitungstyp, der in Aufmachung, Textteil und Gestaltung durch einen plakativen Stil, große Balkenüberschriften mit reißerischen Schlagzeilen, zahlreiche, oft großformatige Fotos sowie eine einfache, stark komprimierte Sprache gekennzeichnet ist.“42 Diese vom digitalen Zeitalter in der Aktualität scheinbar überholten Aussagen lassen sich problemlos auf Boulevard-Formate in TV, Radio und Internet übertragen – versteht man unter Text Content im Allgemeinen und unter Schlagzeilen mehr als nur grafisch hervorgehobene Druckzeilen, sondern multimediale optische und akustische Anreize (Eye- und Earcatcher) und inhaltliche Sensationsversprechen (Teaser), die den Konsumenten abholen und fesseln sollen. Hinzu kommt als einstiges Alleinstellungsmerkmal der Boulevardpresse die populistische Emotionalisierung von Nachricht und Kommentar.43 Ein Paradebeispiel hierfür ist die Ausgabe der BILD-Zeitung vom 20. April 2005 als der Deutsche Joseph Kardinal Ratzinger überraschend zum Papst (Papstname: Benedikt XVI) gewählt wurde und die BILD titelte: „Wir sind Papst!“. Das klingt oder liest sich wie eine Fußball-Schlagzeile zur Weltmeisterschaft nach dem Baukastenprinzip „Wir-sind-Weltmeister“ oder dem berühmten Protestruf der DDR-Bürgerrechtsbewegung: „Wir sind das Volk“ 44. Für die BILD war es der gangbare Weg, ein eigentlich weniger boulevardgeeignetes Thema wie die Wahl des Oberhauptes der Katholiken zur Hauptschlagzeile zu machen.
Vielleicht wundert sich der eine oder andere Leser, warum hier Begriffe wie User, Propaganda-Verkauf oder Paid Media fallen und teilweise assoziativ in Klammern gestellt werden, die ursprünglich aus der Betriebswirtschaftslehre und insbesondere dem Bereich Marketing stammen. Der Grund ist: Boulevard bedeutet verkaufen. Ursprünglich kannte der Boulevard keine Abonnenten. Selbst wenn heute im Print- und Onlinebereich Sonderformen wie beispielsweise BILDPLUS oder Abo-E-Paper-Formate existieren, Boulevardmedien sind traditionell auf den Einzelverkauf ausgerichtet. Im Printbereich wird beispielsweise bei Magazinen ein konstantes Abo-Geschäft unterstellt und bei der internen periodischen Bewertung vor allem auf den Einzelverkauf über den Presse-Zwischenhandel (Grosso-West) als Indikator geschaut. Im TV-Bereich zählen Ein- und Abschalt-Quoten. Online gibt es eine größere Zahl komplexer Messwerte wie Page Impressions (Seitenaufrufe pro Besucher), Unique Visits (Anzahl der einzigartigen Besucher einer Website), die durchschnittliche Verweildauer (Average Time on Site) oder die Bounce Rate (Absprungrate unzufriedener Nutzer). Hier kann nahezu in Echtzeit analysiert werden, welche Schlagzeilen geklickt und vom User bevorzugt werden. So oder so: Nichts interessiert Boulevardmedien mehr, als genaue Zahlen über Präferenzen und Nutzerverhalten der Kunden (User) zu erhalten – mit dem Ziel, die Kundenwünsche herauszufinden und zu befriedigen, um das beim Publikum erfolgreichste Medienformat zu sein. Insofern ist Boulevard-Journalismus immer Marketing. Doch haben die Interessenüberschneidungen zwischen Marketingabteilung und Redaktion ihre Grenzen, wie noch zu zeigen sein wird.
2.3 Aufmerksamkeit als Schlüsselbegriff
Halten wir fest: Boulevardmedien leben davon, mit jeder Ausgabe von Neuem die Aufmerksamkeit der Kunden zu gewinnen. Schenkt der Kunde einem Medium genug Aufmerksamkeit, um sich in Folge zum Konsum und/oder Kauf (Transaktion) des journalistischen Angebots (Content) zu entschließen, hat das Boulevardmedium sein Ziel erreicht. Dies kann es dadurch schaffen, dass es eine Person von öffentlichem Interesse zur Titelfigur macht. Oder einen unbekanntem Akteur in den Mittelpunkt der Berichterstattung stellt, wenn er Hauptdarsteller- oder –opfer in einem tragischen oder zumindest skandalösen Vorfall ist. Hier haben wir seine Abgrenzung des People-Journalismus zum klassischen Boulevard aufgespürt: Eine der Öffentlichkeit unbekannte Person wird nur unter außergewöhnlichen Umständen zur Titel-Figur eines People-Magazins. Im klassischen Boulevard kann die Geschichte hinter einem unbekannten Gesicht die Sensation sein. Das findet sich im People-Bereich beispielsweise nur bei Katastrophen wie ,9/11’ oder dem Absturz der Concorde45. Solche Katastrophen müssen dann von den Journalisten mit Mühe personalisiert werden. Dadurch wird eine unbekannte Person kurzfristig zu einer prominenten Figur erhoben – quasi zur Person der temporären Zeitgeschichte oder zum Gegenstand des öffentlichen Interesses. Das Einzelschicksal der ausgesuchten Person ,n.n.’46 steht dann symbolisch für das Schicksal aller Opfer. Sie merken: wir nähern uns dem Phänomen People-Journalismus.
Wir erinnern uns an die journalistischen Grundlagen: Typische Merkmale des klassischen Boulevard-Journalismus sind neben aufmerksamkeitsheischenden Schlagzeilen das Komprimieren und Vereinfachen komplizierter Sachverhalte auf wenige Kernaussagen, die Verwendung von Superlativen und prägnanten Neologismen, die Emotionalisierung (Kommentar, Meinung) und Personalisierung der Ereignisse, lebendige, bildhafte Einstiege (Feature, Reportage) und die verständliche Einordnung der Umstände in den Alltag des Konsumenten (Editorial)47. Diese Stilmittel finden wir auf den ersten Blick in einem People-Magazin wie BUNTE. Rubriken wie Szene, Society, Adel, Politik/Wirtschaft oder Salon dienen lediglich zur Einordnung der People-Geschichten in ein bestimmtes Umfeld. Stilistisch unterscheiden sich die Rubriken nicht sonderlich. Eine einheitliche Sprache und Bildsprache ist kein Zufall, sondern Ziel, um den Konsumenten nicht zu verunsichern. Selbst der Bereich ,Medizin’ wird thematisch an einer prominenten Person festgemacht. Wo aber sind die wesentlichen Unterschiede zwischen klassischem Boulevard- und People-Journalismus? Wie der Name schon andeutet, dreht sich im People-Journalismus alles um „People“. Im Zentrum stehen konkret genannte natürliche Personen und ihre Schicksale. Wobei die gesellschaftliche Relevanz der Person bei der Themenauswahl entscheidend ist. Ist die Person populär oder zumindest einflussreich, ist ihr berufliches Betätigungsfeld – Sportler, Manager, Schauspieler, Schriftsteller – Nebensache. Die Prominenz der Person ist bereits ein Grund, eine journalistische Geschichte zu erzählen. Aber wieso diese Einschränkung? Weil der deutsche People-Journalismus einem theoretischen Konstrukt folgt, dass das Thema Aufmerksamkeit viel differenzierter sieht als lange Zeit üblich. Die Aufmerksamkeit des Konsumenten (Users) steht nicht allein im Interesse des People-Journalismus. Er beruft sich auf ein komplexes Aufmerksamkeiten-Gefüge, ein System, dass nicht den anonymen Medienkonsumenten als Kunden ins Zentrum der Betrachtung stellt, sondern die Akteure in der von den Medien mitgestalteten Aufmerksamkeits-Arena.
2.4 Neue Akteure im Kampf um die Aufmerksamkeit
Was sind das für neue Aspekte der Aufmerksamkeit? Die klassische Sichtweise stellt, wie erläutert, die Aufmerksamkeit des Konsumenten in den Vordergrund: Der Mensch ist trotz aller naturwissenschaftlicher Forschungsbemühungen ein Lebewesen mit einer endlichen Spanne an Lebenszeit. Folglich muss er haushalten und überlegen, welcher Person oder welcher Tätigkeit er einen Teil seiner Lebenszeit in Form von Aufmerksamkeit widmet. Das gilt nicht nur für die Verteilung von Aufmerksamkeit für soziale Bereiche wie Familie, Hobby oder Beruf, sondern auch für die Mediennutzung. Das bedeutet: Es gibt eine harte Konkurrenz unter den Medien – ein Buhlen um Aufmerksamkeit, die der potenzielle Kunde (User) und Käufer bereit ist, für den Medienkonsum zu opfern.
Möglichkeiten zur Darstellung des Zusammenhangs aus psychologischer Sicht sind die sogenannten Filter- oder Flaschenhals-Modelle. Der britische Psychologe Donald Eric Broadbent (1926-1993) stellte 1958 die sogenannte Filtertheorie der Aufmerksamkeit48 auf. Sie besagt vereinfacht zusammengefasst, dass das menschliche Individuum in der Lage ist, den auditiven Wahrnehmungsapparat auf eine Nachrichtenquelle einzustellen und andere bewusst auszuschließen. Die ausgewählte Information wird in einen Kanal mit begrenzter Aufnahmekapazität zur Weiterverarbeitung weitergeleitet. Nur die ausgewählte Information passiert zur Weiterverarbeitung den Flaschenhals beziehungsweise Filter. Der Rest hat keine Chance, wahrgenommen zu werden. Theorien über die begrenzten Ressourcen der Aufmerksamkeit erweitern diesen Gedanken um den Aspekt, demnach das Maß der Aufmerksamkeit, die ein Individuum aufbringen kann, begrenzt ist durch seine freien mentalen Ressourcen. Ohne auf einzelne Theorien, ihre Weiterentwicklung oder Kritik einzugehen, ist das Grundprinzip verständlich: Aufmerksamkeit ist ein knappes Gut – das ahnten wir schon. Ökonomisch gesehen handelt es sich um ein einfaches Marktgefüge von Angebot und Nachfrage. Eine wie auch immer bedingte Konsumneigung auf der einen Seite (User; Konsument) trifft auf ein Konsumangebot auf der anderen Seite (Medien; Produzent). Ist es wirklich so einfach? Was bestimmt die Konsumneigung der Käufer? Warum kaufen und konsumieren sie? Die Ökonomie der Aufmerksamkeit von Georg Franck hat einen komplexeren Ansatz, den Zusammenhang zwischen Konsumverhalten und Medienangebot zu analysieren. Der Schlüssel ist bei ihm die Aufmerksamkeit. Dazu kommen wir jetzt.
3. Georg Franck und sein Entwurf einer Ökonomie der Aufmerksamkeit
Wir haben kurz erörtert, dass der Boulevard-Journalismus ein Format ist, welches sich mit aller Macht um die Aufmerksamkeit der Kunden bemüht. Dieser muss immer wieder neu zum Kauf verleitet werden. Wobei wir extreme Präferenzen der Konsumenten für ein bestimmtes Boulevardmedium (Abonnenten) außer Acht lassen. Das Boulevardmedium buhlt immer wieder neu laut und bunt um potenzielle Kunden: Es will ihre Aufmerksamkeit wecken. Doch was ist mit den Menschen, die Gegenstand der Berichterstattung sind? Geht es auf dem Medienmarkt nur um Geld-Geschäfte (finanzielle Transaktionen)? Erregen die Medien Aufmerksamkeit nur, um zahlende Käufer zu gewinnen? Oder hat Aufmerksamkeit noch eine ganz andere Bedeutung und Funktionsweise, die uns letztendlich das Mediengeschäft besser verstehen lässt?





























