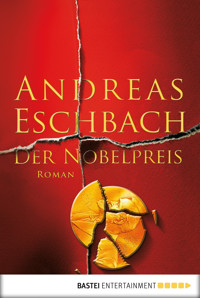12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Tor
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Wer ist Perry Rhodan? Bestsellerautor Andreas Eschbach erzählt die Vorgeschichte des legendären Weltraumhelden. Cape Kennedy, 1971: Nach dem katastrophalen Scheitern der Apollo-Missionen unternehmen die Amerikaner einen letzten verzweifelten Versuch, das Rennen zum Mond zu gewinnen. Der Name des Raumschiffs: Stardust. Der Name des Kommandanten: Perry Rhodan. Mit diesem bahnbrechenden Ereignis startete die Science-Fiction-Serie Perry Rhodan. Und wurde zur erfolgreichsten Fortsetzungsgeschichte der Welt. Doch erst jetzt erfahren wir, wie alles wirklich begann: Perry Rhodans Jugend, seine politischen Eskapaden, seine Abenteuer als Testpilot und die geheime Geschichte der bemannten Weltraumfahrt. Andreas Eschbach erzählt, wie Perry Rhodan zu der legendären Gestalt wurde, die die Menschheit zu den Sternen führt. »Perry Rhodan – Das größte Abenteuer« ist der Science-Fiction-Roman, auf den alle gewartet haben, für Fans von Frank Schätzing und Cixin Liu. Ausgezeichnet mit dem Kurd Laßwitz Preis als »Bester Roman des Jahres«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1305
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andreas Eschbach
Perry Rhodan - Das größte Abenteuer
Roman
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© Deutsche Erstausgabe 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Das Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
»Perry Rhodan« ist eine eingetragene Marke der Heinrich Bauer Verlag KG. Die Figur Perry Rhodan ist eine Schöpfung von K. H. Scheer und Clark Darlton
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München,unter Verwendung eines Bildes von shutterstock/Sergey Nivens
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490598-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Das größte Abenteuer (I)
1
Das größte Abenteuer der irdischen Menschheit begann am 4. Oktober 1957 alter Zeitrechnung. An jenem Tag gelang es Menschen zum ersten Mal, einen Satelliten in eine Umlaufbahn um die Erde zu befördern.
Dieser Satellit hieß Sputnik 1.
Viele Menschen wissen das heute immer noch – was erstaunlich ist, liegt dieses Ereignis doch fast so lange zurück wie aus damaliger Sicht der Bau der Pyramiden.
Um jedoch wirklich zu verstehen, welch eine Zeitenwende dies bedeutete, genügt es nicht, nur einen Namen zu kennen. Man braucht auch eine Vorstellung davon, wie die Erde zu jener Zeit ausgesehen hat, welche politischen und gesellschaftlichen Strukturen das Leben und das Denken der Menschen des 20. Jahrhunderts prägten. Das vorliegende Werk muss in der Tat auf ein gewisses historisches Vorwissen seiner geneigten Leserschaft hoffen: Es gilt, sich zurückzuversetzen in eine Zeit, in der auf der Erde mehr als tausend verschiedene Sprachen gesprochen wurden. Es gilt, sich vorstellen zu können, wie Menschen ernsthaft glaubten, sie seien allein im Universum. Es gilt, sich hineinzudenken in eine Welt, die zersplittert war in weit über hundert große und kleine, schwache und mächtige Staaten, die in vielfältiger Weise untereinander konkurrierten.
Das ging beileibe nicht immer friedlich vor sich, im Gegenteil. Man stritt um Ressourcen, man stritt um Einflussgebiete, man stritt über weltanschauliche Fragen – und nicht selten arteten derartige Streitereien in bewaffnete Konflikte aus.
Tatsächlich hatte die Menschheit des Jahres 1957 gerade zwei erbitterte Kriege hinter sich. Die Frontlinien dieser Kriege waren erstmals überall auf dem Globus verlaufen, weswegen man sie die Weltkriege nannte. In deren Folge hatten sich zwei Machtblöcke entwickelt, nämlich der Westen und der Osten, die einander nun argwöhnisch belauerten. Und der Zweite Weltkrieg war mit Nuklearwaffen beendet worden: Man darf sich dieses Belauern also durchaus als höchst bedrohlich vorstellen.
Das war die Situation, als am 4. Oktober 1957 um 19 Uhr 28 Minuten und 34 Sekunden damaliger Standardzeit eine 30 Meter hohe und 267 Tonnen schwere Verbrennungsrakete startete. Sie tat dies in der Nähe von Baikonur, einer Stadt im südlichen Kasachstan, zweihundert Kilometer westlich des Aralsees. Damals gehörte dieses Gebiet zu einem Staatenbund namens Sowjetunion, der die zentrale Rolle im Osten spielte. Die Nutzlast der Rakete bestand in einer 58 Zentimeter durchmessenden Kugel aus Aluminium, die vier Antennen trug, von denen jede rund zweieinhalb Meter lang war.
Der Start erfolgte ohne jegliche Ankündigung. Erst als feststand, dass das Vorhaben geglückt war, gab man bekannt, dass nun erstmals ein von Menschen geschaffener Satellit die Erde umkreiste, der unablässig Funksignale von sich gab.
Für die Führung der westlichen Zentralmacht, der auf dem amerikanischen Nordkontinent angesiedelten Vereinigten Staaten von Amerika, auch USA genannt, kam diese Nachricht völlig überraschend. Und sie war ein Schock. Denn: Wer einen Satelliten in eine Erdumlaufbahn schießen konnte, die jeden Punkt der Erdoberfläche überquerte, der konnte auch eine Bombe an jeden Punkt der Erdoberfläche befördern. Der Osten hatte damit einen Vorsprung, von dem sich der Westen existentiell bedroht fühlte.
Nach außen hin gab man sich in Washington, der Hauptstadt der USA, gelassen. Hinter geschlossenen Türen jedoch diskutierten Politiker, Militärs und Wissenschaftler überaus hitzig. Was sollte man tun? Was konnte man tun?
Rund fünfhundert Kilometer weiter nordöstlich, in der Stadt Manchester im amerikanischen Bundesstaat Connecticut, war zur gleichen Zeit ein junger Mann von 21 Jahren damit beschäftigt, Bauteile aus dem Elektrogeschäft seines Vaters zusammenzulöten. Er versuchte, einen Empfänger zu basteln, mit dem sich die Signale des Sputnik auffangen ließen.
Zu jenem Zeitpunkt hätte niemand ahnen können, dass dieser junge Mann in diesem Wettlauf ins All noch eine überaus bedeutende Rolle spielen sollte, am allerwenigsten er selbst. Sein Name war Perry Rhodan.
2
Etwas mehr als 13 Jahre später, am Abend des 21. Juli 1971, schob sich eine dunkle, nach viel Geld und Macht aussehende Limousine durch eine aufgebrachte Menschenmenge im Herzen von Washington, D.C., der Hauptstadt der Vereinigten Staaten von Amerika. Es handelte sich um einen Lincoln Continental Mark III mit getönten Scheiben, auf dessen Vordersitzen zwei bewaffnete Männer des Secret Service Ausschau nach möglichen Gefahren hielten, die ihren Schutzbefohlenen auf dem Rücksitz drohen mochten: Dort saßen Jake und Mary Rhodan, hielten einander an den Händen und konnten nicht fassen, was um sie herum geschah. Es war schon ein Schock gewesen, als Präsident Nixon sie angerufen und – durchaus freundlich – gebeten hatte, ins Weiße Haus zu kommen, aber was sie nun zu sehen bekamen, übertraf ihre schlimmsten Befürchtungen. Rings um das Auto prügelten sich Menschen – Amerikaner wie sie! –, wobei die einen Schilder trugen, auf denen »Eine Welt – jetzt!« stand, »Nie wieder Krieg!« und dergleichen, die anderen aber Schilder mit Aufschriften wie »Rhodan – Verräter!« und »Mondfahrer an den Galgen!«.
»O Jake«, flüsterte Mary Tibo Rhodan, die Hand ihres Mannes umklammernd wie einen Rettungsring. »Was haben wir nur falsch gemacht?«
Jake Rhodan war nicht der Mann, der je auf solche Fragen mit billigen Trostworten reagiert hätte. Er dachte vielmehr gründlich darüber nach, ließ alles, was geschehen war, vor seinem geistigen Auge Revue passieren und erklärte schließlich: »Ich glaub nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Es ist was falsch gelaufen, das wohl schon – aber uns trifft daran keine Schuld.«
Zwei ineinander verkeilte Streithähne prallten krachend gegen das Auto, brachten die tonnenschwere Limousine zum Schaukeln. Eine Tafel mit einem großen Konterfei von Jake Rhodans Sohn, über das jemand eine Zielscheibe gemalt hatte, klebte am Fenster und rutschte quälend langsam abwärts.
»Und Perry auch nicht«, fügte Jake unbeirrt hinzu.
Je näher sie dem Weißen Haus kamen, desto mehr berittene Polizisten patrouillierten. Die Dämmerung brach an. Hier und da hielten Demonstranten brennende Fackeln in Händen, was die ganze Szenerie noch unheimlicher wirken ließ.
Endlich erreichte der Wagen die Zufahrt zum Sitz des Präsidenten. Hunde schnüffelten den Wagen ab. Ausweise wurden vorgezeigt. Durch die offenen Fenster drang das Geschrei der Randale herein und eine Wärme, wie man sie zu dieser späten Stunde nicht gewohnt war, wenn man aus Connecticut kam.
Endlich ein Wink, der Wagen rollte weiter, nur ein paar Schritte bis zum Seiteneingang, dann öffnete man ihnen den Wagenschlag und ließ sie, von mehreren Soldaten abgeschirmt, aussteigen. Eine nervöse Frau in einem teuren Kostüm und mit großen, für Mary Rhodans Augen bestürzend echt aussehenden Perlenohrringen empfing sie, bedankte sich, dass sie es hatten einrichten können, und beteuerte, wie leid es ihr tue, dass heute alles drunter und drüber gehe; sie hätten es ja sicher mitbekommen, die Chinesen mit ihrem Ultimatum, sehr beunruhigend das alles. »Aber der Präsident will Sie beide unbedingt kennenlernen«, bekräftigte sie, »sobald er Gelegenheit dazu findet. Es ist nur gerade unklar, wann das sein wird.«
»Well«, erwiderte Jake Rhodan gelassen, »wir haben heute Abend jedenfalls nichts anderes mehr vor.«
Man führte sie durch die überraschend schmalen Flure und Gänge des Weißen Hauses und wollte sie gerade in einen kleinen Raum komplimentieren, in dem Getränke und ein Büfett mit Häppchen bereitstanden, als ein untersetzter Mann mit dichtem, lockigem Haar und einer dicken schwarzen Hornbrille auftauchte und zu der Frau mit den Perlenohrringen sagte: »Bringen Sie sie gleich runter in die Schutzräume. Wir sind gerade auf DEFCON 1 gegangen. Bis in einer halben Stunde muss das ganze Haus evakuiert und gesichert sein.«
»Oh my goodness«, stieß die Frau hervor.
Jake Rhodan, der einen Moment gebraucht hatte, um in dem Mann Sicherheitsberater Henry Kissinger zu erkennen, fragte: »Können wir vielleicht mal erfahren, was eigentlich los ist?«
Kissinger, schon auf dem Sprung weiter den Flur hinab, blieb stehen und sah ihn an. »Sie sind der Vater, nicht wahr?«
»Ja«, sagte Jake.
»Dann beglückwünschen Sie sich mal zu Ihrem Sohn. Wie es aussieht, ist er gerade dabei, den dritten Weltkrieg auszulösen.«
3
Ich saß an jenem Tag in London im Gefängnis, und zwar in Her Majestys Prison Pentonville im Bezirk Borough of Islington.
Während sich in Amerika der 21. Juli 1971 seinem Ende zuneigte, waren in London schon die frühen Morgenstunden des 22. angebrochen. Wie an jedem Tag hatte man uns um halb fünf Uhr geweckt. Nach zehn Minuten, um seine Notdurft zu verrichten, sich ein wenig Wasser ins Gesicht zu spritzen und sein Bett zu machen, hieß es wie stets: antreten, sich beim Durchzählen laut und vernehmlich zu Gehör bringen und anschließend in die Kantine marschieren, wo uns das gute englische Gefängnisfrühstück erwartete, bestehend aus faden weißen Bohnen in wässriger Tomatensoße, kaltem, hartem Speck, Würstchen, in denen alles Mögliche enthalten sein mochte, nur kein Fleisch, labberiger Toast und ein Spülwasser von Kaffee.
Nur dass uns das alles an diesem Morgen nicht erwartete. Als wir in den Speisesaal kamen, lag die Essensausgabe leer und dunkel da, stattdessen lief der Fernsehapparat, der, geschützt durch ein stabiles Gitter, hoch oben in einer Ecke des Raums hing, und die ganze Küchenmannschaft stand einträchtig versammelt davor.
Besagter Fernsehapparat wurde äußerst selten eingeschaltet, im Grunde nur, wenn wichtige Endspiele im Fußball oder Rugby stattfanden. Solche Übertragungen wurden stets lange vorher angekündigt; wer sich nicht benahm, musste damit rechnen, davon ausgeschlossen zu werden – und der Apparat war noch nie morgens gelaufen.
Das hieß: Irgendetwas noch nie Dagewesenes war passiert oder im Begriff zu geschehen.
Eine atemlose Anspannung lag in der Luft. Niemand kam auf die Idee, wegen des Frühstücks zu randalieren, nicht einmal die ganz harten Burschen, die sonst keinen Anlass vermieden, sich zu streiten. Frühstück war irgendwie gerade völlig unwichtig; das schien jeder zu begreifen, ohne dass es eines Wortes bedurft hätte.
Neben mir hörte ich einen meiner Mitinsassen, den alle nur Crazy Bruce nannten, flüstern: »Der Mond. Ich hab’s euch immer gesagt, der Mond ist unser Unglück!«
Niemand antwortete ihm. Wir gingen alle einfach weiter, durch die Reihen der Stühle und Tische bis nach vorn, wo sich alle unter dem Fernseher versammelten, Insassen und Küchenleute und Wärter, Schulter an Schulter stehend, alle Blicke auf den Bildschirm gerichtet. Dort verlas gerade ein BBC-Sprecher einen Bericht, die laufenden Ultimaten der Atommächte betreffend, und man konnte sehen, dass seine Hände zitterten.
Crazy Bruce hatte recht, es ging immer noch um die amerikanische Mondrakete und die Krise, die diese ausgelöst hatte, als sie bei ihrer Rückkehr nicht in den USA gelandet war, sondern in China, im hintersten Winkel der Wüste Gobi. Zuerst hatte es geheißen, es sei eine Notlandung gewesen, doch inzwischen sah es eher so aus, als sei das SOS der Mondfahrer nur eine Finte gewesen – doch aus welchem Grund?
Die USA warfen China vor, die Rakete illegal an sich gebracht zu haben. Was China entschieden bestritt.
China warf den USA vor, mit Hilfe ihrer Rakete einen illegalen Stützpunkt auf ihrem Territorium errichtet zu haben. Das wiederum bestritten die USA entschieden.
Ich merkte auf, als der Uhrzeiger, wie jeden Morgen, mit einem unverkennbaren, lauten Klack! auf fünf Uhr sprang.
Im selben Moment ließ der Sprecher seine Papiere sinken, legte eine Hand an den Knopf, den er im Ohr trug, und sagte: »Ladies and gentlemen, gerade erreicht uns die Nachricht, dass die Volksrepublik China wie angedroht ihre gegen die USA gerichteten Atomraketen in Marsch gesetzt haben soll.« Er lauschte einen Moment, dann fuhr er fort: »Es handelt sich dabei allerdings nur um bislang unbestätigte Gerüchte. Ich rufe unseren Korrespondenten Philip Coyle in Amerika – Philip, wissen Sie Genaueres?«
Das Bild eines pausbäckigen Mannes wurde eingeblendet. Die Telefonverbindung war nicht besonders gut.
»Hallo, Jim. Ich stehe hier zusammen mit etwa hundert Kriegsgegnern an einem Ort außerhalb von Washington, D. C., von dem es heißt, dass hier einige der amerikanischen Atomraketen stationiert seien. Man sieht davon nichts, nur mit Maschenzaun und Stacheldraht umzäunte Wiesen, aber die Menschen hier harren seit Tagen mit Zelten und Plakaten –«
Der Rest des Satzes ging in vielstimmigem Entsetzensgeschrei unter. Als man die Stimme des Korrespondenten wieder hören konnte, sprach er deutlich hastiger und aufgeregter. »… werden Augenzeugen, wie sich hier überall gewaltige Metalldeckel aus dem Erdreich heben, die offenbar bislang die Siloschächte der Raketen verschlossen haben. Das heißt wohl, dass nun so etwas wie höchste Alarmbereitschaft herrscht, wenngleich natürlich zu hoffen ist, dass es nicht zum Äußersten –«
Dann brach ein Höllenlärm los, ein ohrenbetäubendes Krachen, das kein Ende zu nehmen schien. Ich sah unwillkürlich zur Wanduhr, doch die zeigte erst drei Minuten nach fünf Uhr, und ich weiß noch, wie ich dachte: Schlechter kann ein Tag ja wohl kaum anfangen.
Endlich ließ das Tosen und Dröhnen nach, und man hörte den Reporter rufen: »London? Die Raketen sind gestartet … Keine Ahnung, ob ihr mich hört, ich bin taub, ich höre mich selber nicht mehr, aber wir sehen noch die Triebwerke am Nachthimmel, dünne Lichtstreifen, die sich rasch entfernen … das Unausdenkbare, es ist geschehen … die Atomraketen sind gestartet!«
»Danke, Philip Coyle.«
Der Sprecher, kreidebleich im Gesicht, legte seine Unterlagen beiseite, wandte sich der Kamera zu und faltete die Hände. »Gott sei uns allen gnädig. Das ist das Ende der Welt.«
Sternzeichen
1
Am 8. Juni 1936 um 6 Uhr 31, astrologisch betrachtet also im Zeichen der Zwillinge, Aszendent ebenfalls Zwillinge, brachte die einundzwanzigjährige Mary Tibo Rhodan, Ehefrau von Jakob Edgar Rhodan, genannt »Jake«, im Hartford Hospital in Hartford, Connecticut, einen gesunden Jungen zur Welt. Den Aufzeichnungen zufolge wog er 3050 Gramm und maß 49 cm, der diensthabende Arzt hieß Dr. Frederick Stone, die betreuende Hebamme Grace Pearson, ansonsten ist vermerkt: Keine besonderen Vorkommnisse, Mutter und Kind wohlauf.
Dies sei erwähnt, weil es im Lauf der Zeit immer wieder Versuche gegeben hat, die Geburt Rhodans mystisch zu überhöhen: Nichts dergleichen lässt sich belegen. Weder regnete es Rosenblätter, noch erschienen Zeichen am Himmel; es tauchten auch keine geheimnisvollen Männer mit wertvollen Gaben auf oder was immer man sonst versucht hat, Wundersames dazuzudichten, als sei eine glücklich verlaufende Geburt nicht Wunder genug. Tatsächlich war der 8. Juni 1936 einfach ein gewöhnlicher Montagmorgen in Neuengland, der im weiteren Verlauf sonnig bei leichter Bewölkung werden sollte, und man darf vermuten, dass irgendjemand eine Bemerkung gemacht hat wie: »Na, die Woche fängt ja gut an!«
Wäre es ein Mädchen geworden, hätten die Eltern noch eine Weile diskutieren müssen, denn die Mutter hätte das Kind in diesem Fall Alice nennen wollen, der Vater Jane. Aber glücklicherweise war es ein Junge, genau wie es Marys Mutter, Katherine Tibo, vorhergesagt hatte, und dass ein Sohn Perry heißen sollte, darüber waren sie sich seit jeher einig.
»Kein Mittelname?«, fragte der Beamte, der die Geburtsurkunde auszustellen hatte.
»Nein«, erwiderte der frischgebackene Vater.
»Wenigstens ein Initial?«
»Auch nicht«, beharrte Jake Rhodan, der die ganze Nacht kein Auge zugetan und darüber hinaus die Nase voll hatte von Diskussionen über Vornamen.
»Er wird sein Leben lang Probleme haben, wenn’s drum geht, ein Formular auszufüllen«, gab der Beamte zu bedenken, in dessen Begriffswelt dem Ausfüllen von Formularen naturgemäß ein hervorragender Stellenwert zukam. »Ein Mann ohne Mittelname ist irgendwie kein richtiger Amerikaner.«
»Abraham Lincoln hatte meines Wissens auch keinen Mittelnamen«, erwiderte Jake Rhodan, »und ich würd’ mal sagen, das war ein richtiger Amerikaner.«
Der Beamte ließ sich das durch den Kopf gehen. »Schon«, gab er zu. »Aber damals gab’s auch noch nicht so viele Formulare.«
Das Gespräch ging noch eine Weile weiter, aber Jake ließ sich nicht beirren, wie er sich überhaupt selten beirren ließ im Leben, und so endete es damit, dass in der Geburtsurkunde schlicht stand:
Name des Kindes: Perry Rhodan
2
Es war ein ziemlich pflegeleichtes Baby, ganz so, als hätte der kleine Perry instinktiv sofort begriffen, was von ihm erwartet wurde, nämlich, viel zu trinken, viel zu schlafen und möglichst schnell größer zu werden. Und genau das tat er, sehr zur Freude und Erleichterung seiner Eltern, die zuvor allerlei schreckliche Geschichten über stundenlang grundlos schreiende Babys und durchwachte Nächte gehört hatten: Nichts dergleichen erlebten sie mit ihrem Sohn. Auch in seinen wachen Stunden hatte Perry Besseres zu tun, als zu schreien, nämlich seine unmittelbare Umgebung gründlich zu erforschen, so gut er konnte, und mit den seltsamen, riesigen Wesen Kontakt aufzunehmen, die ab und zu in seinem Gesichtsfeld auftauchten. Und wenn er es für notwendig befand, sich akustisch zu melden, hatte das immer einen einsichtigen und leicht behebbaren Grund: meistens Hunger – oder das Gegenteil davon.
Uns, die wir versuchen, dem Mysterium Perry Rhodan auf den Grund zu gehen, hilft das nicht weiter, gilt es doch als eine der Binsenweisheiten der Psychologie, dass es eher die Schwierigkeiten und Probleme sind, die eine Persönlichkeit formen: Unter diesem Aspekt betrachtet, gibt uns der Umstand, dass Perry Rhodan ein ungewöhnlich gewöhnliches Baby war, keinerlei Hinweise auf die Kräfte, die den späteren Erwachsenen geprägt haben.
Wenden wir uns also, während das Baby zum Kind heranwächst, zunächst der Betrachtung seines familiären Umfelds zu: Dass die Herkunftsfamilie einen starken Faktor in der Persönlichkeitsentwicklung darstellt, ist schließlich ein weiterer Gemeinplatz der Psychologie.
Beginnen wir mit seinem Großvater, Alois Roden, geboren am 17. Mai 1889 in Scheernsting, einem kleinen, heute nicht mehr existierenden Dorf in Oberbayern, einer Region in Deutschland, einem der Länder im damaligen Europa. Alois war nach Gregor Roden und einer Schwester, Ilse Roden, das dritte Kind des Landwirts Edgar Roden und seiner Frau Martha und muss nach allem, was wir von ihm wissen, ein überaus wissbegieriger, allem Neuen gegenüber aufgeschlossener Mensch gewesen sein. Da er sich keine Hoffnungen auf eine Übernahme des Hofes machen durfte – dieser würde an seinen älteren Bruder gehen –, zog es ihn früh aus Scheernsting fort, und zwar nach München, der bayerischen Landeshauptstadt, wo er das Handwerk eines Elektrikers erlernte: Die allgemeine Einführung des elektrischen Stroms, die sogenannte »Elektrifizierung«, war zu dieser Zeit gerade das große Thema der Technik.
Im Juli 1907 heiratete Alois die aus Garmisch-Partenkirchen stammende Gerda Mayr, im Jahr darauf, am 19. Mai 1908, kam der erste Sohn Karl zur Welt, zwei Jahre später, am 5. Oktober 1910, der zweite Sohn Jakob Edgar. Die Familie lebte noch in Scheernsting, aber Alois verdiente gut, sie hatten ein Haus am Stadtrand von München in Aussicht, und ein schönes Leben hätte vor ihnen liegen können, wäre es nicht im Sommer 1914 zu jenem Krieg gekommen, den man später den Ersten Weltkrieg nennen sollte.
Alois, der den Wehrdienst widerwillig über sich hatte ergehen lassen und jeglicher Waffengewalt zutiefst abhold war, wurde eingezogen und zur U-Boot-Flotte abkommandiert. U-Boote stellten damals eine völlig neue Erfindung dar, von der die altgedienten Militärs noch nicht wussten, was davon zu halten und wie sie am besten einzusetzen war; sie sollten sich im Verlauf des Krieges als furchtbare Waffe erweisen, furchtbar sowohl in ihrer Wirkung gegen die Angegriffenen als auch furchtbar für die Insassen, die, eingeschlossen in eine klaustrophobisch enge Stahlröhre und ständig gegen Luft- und Treibstoffmangel kämpfend, nicht selten dem Wahnsinn nahe waren. Alois Roden verbrachte praktisch den gesamten Krieg an Bord des Schiffes U-17, einem der wenigen U-Boote, die das Ende der Kämpfe erlebten, allerdings hätte er die Behauptung, »Glück« gehabt zu haben, weit von sich gewiesen, war doch im letzten Winter des Krieges seine Frau Gerda, als in der Heimat Heizmaterial knapp geworden war, an Tuberkulose erkrankt, an der sie kurz nach Kriegsende starb. Der überlebende Alois Roden stand nun als Witwer mit zwei Söhnen da, acht und zehn Jahre alt, und gewann, während er die Nachrichten über Verlauf und Inhalte der sogenannten Friedensverhandlungen im französischen Versailles verfolgte, den Eindruck, dass der nächste Krieg nur eine Frage der Zeit war.
Aber dieser nächste Krieg, beschloss er, würde ohne ihn stattfinden müssen. Er setzte alle Hebel in Bewegung – und da er seit jeher ein umgänglicher, kontaktfreudiger Mensch gewesen war, verfügte er über eine Menge solcher Hebel – und schaffte es schließlich im Herbst 1919, mit seinen beiden Buben in die USA überzusiedeln.
Bei der Einreise geriet er an einen kreativen Beamten, der es sich angelegen sein ließ, die Schreibweise des Familiennamens Roden zu amerikanisieren, und so wurde aus dem Deutschen Alois Roden der Anwärter auf die amerikanische Staatsbürgerschaft Al Rhodan. (Die Einbürgerung erfolgte am 18. Oktober 1924.)
Al Rhodans Überzeugung, dass gute Elektriker überall auf der Welt gefragt seien, bewahrheitete sich. Er vervollkommnete innerhalb kürzester Zeit das Englisch, das er brockenweise während seiner Zeit in der Marine aufgeschnappt hatte, knüpfte rasch neue Kontakte und konnte sich bald vor Aufträgen kaum retten, erstens, weil die USA eine spürbar aufstrebende Nation waren, in der tüchtige Leute überall gebraucht wurden, und zweitens, weil den Deutschen der Ruf vorauseilte, besonders tüchtig und vor allem zuverlässig zu sein. Die Rhodans wohnten die ersten paar Wochen in einem billigen Hotel, dann fanden sie eine kleine Wohnung am Rand der Riesenstadt New York, und das Geld reichte sogar, um eine Haushälterin einzustellen, eine füllige, resolute Dame, die Rosemary White hieß, obwohl sie schwarz war, und die nicht nur den Haushalt in Ordnung hielt, sondern auch den beiden Jungs Manieren beibrachte – und die englische Sprache: Sie gestattete ihnen nicht, in ihrer Gegenwart Deutsch miteinander zu sprechen, und beanstandete jeden Fehler, den sie an ihrem Englisch bemerkte, was anfangs eine Tortur war, sich aber auf Dauer auszahlte, denn so gelang es auch den beiden Söhnen, denen die Umstellung auf die neue Umgebung mehr zu schaffen machte als ihrem Vater, sich zurechtzufinden und in der Schule bald einigermaßen brauchbare Noten zu schreiben.
Nach der Schule bestand ihr Vater darauf, dass sie beide ein Handwerk erlernten. Nicht, dass Al grundsätzlich etwas gegen das Studieren gehabt hätte, aber, so meinte er, man solle doch besser zuerst eine solide Grundlage legen, und das Handwerk, das sähen sie ja an ihm, habe nun mal goldenen Boden. Jakob folgte dem väterlichen Beispiel und ging bei einem Konkurrenten seines Vaters in die Lehre, um ebenfalls Elektriker zu werden. Sein großer Bruder Karl dagegen, dem das für den Umgang mit Strom nötige abstrakte Denken nicht so lag, fand eine Lehrstelle als Zimmermann, ein Handwerk, das ihm zusagte: »Schließlich hab ich große Hände«, erklärte er.
Al Rhodans Traum war gewesen, eine richtige eigene Firma zu gründen, doch dazu sollte er nie kommen, zuerst, weil er immer viel zu viel zu tun hatte, als dass er Zeit für den nötigen Formularkram gehabt hätte, und später, weil er krank wurde: Lungenkrebs, wie der Arzt ihm kurz vor seinem 44. Geburtstag offenbarte. Über die Ursache gab es kaum Zweifel, Al Rhodan war zeitlebens ein starker Raucher gewesen. Er quälte sich noch eindreiviertel Jahre mit allerhand unwirksamen Behandlungen und starb schließlich im Januar 1932.
Jakob war zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt, Karl 23. Nach dem Tod des Vaters hielt die beiden nichts mehr in dem immer hektischer werdenden New York, außerdem wollten sie beide mehr sehen von dem Land, in das ihr Vater sie gebracht hatte. Also gaben sie nach der Beerdigung der untröstlichen (von Al testamentarisch durchaus wohlbedachten) Rosemary einen letzten Abschiedskuss und zogen hinaus in die Weiten Amerikas.
Jake bewarb sich auf eine Stellenanzeige einer Renovierungsfirma in Chicago, die einen Elektriker suchte, und bekam die Stelle sofort. Der Job war nicht sonderlich gut bezahlt, aber interessant, und Geld war ihm zu jener Zeit noch nicht so wichtig.
Einer der ersten größeren Aufträge, bei dem er dabei war, beinhaltete die Erneuerung der elektrischen Installationen im Children’s Memorial Hospital. In diesem Krankenhaus arbeitete auch eine junge Krankenschwester namens Mary Tibo, und als die beiden sich begegneten, muss es wohl Liebe auf den ersten Blick gewesen sein.
Und das, stellten sie bald darauf fest, war ein Problem.
3
Mary Tibo, jüngste Tochter von Gerald Tibo und Katherine Tibo, geborene Moore, war der Sproß eines alten Geschlechts von Händlern, das seine Wurzeln in Frankreich hatte, genauer gesagt in Lothringen, einer Region an der Mosel, die einst ein eigenes Herzogtum war. Die Familie lässt sich mühelos zurückverfolgen zu einem Urahn namens Louis-Fréderic Thibeau, der während der Herrschaft von Napoleon Bonaparte in allerlei mehr oder weniger dunkle Geschäfte mit Leuten im Dunstkreis des Kaisers verwickelt war. Nach dessen Sturz fand er es ratsam, sich umgehend ins Ausland zu begeben, je weiter weg von Frankreich, desto besser, und landete schließlich in den unlängst unabhängig gewordenen Vereinigten Staaten von Amerika. Auch hier begegnen wir wieder dem Motiv, dass sich ein Familienname in der Schreibweise änderte, nur war es in diesem Fall Louis-Fréderic selber, der seinen Namen abwandelte, um es eventuellen rachsüchtigen Verfolgern nicht unnötig leicht zu machen, und fortan als Fred Tibo durchs Leben ging.
Sei es, dass dieser Trick funktionierte, sei es, dass es weniger rachsüchtige Verfolger gab, als er befürchtet hatte, jedenfalls blieb er unbehelligt. Er siedelte sich in dem seit dem Bau der Ost-West-Eisenbahnlinie aufstrebenden Chicago an und begründete die Dynastie der Tibos, die von da an in Handelsgeschäften aller Art mitwirkten und allerlei Aufs und Abs erlebten, mal mehr, mal weniger reich waren, immer aber wohlhabend; die nie zu den ganz Großen zählten, aber auch nie in der Versenkung verschwanden.
Dass eine Tibo sich mit einem Handwerker einließ, passte ganz und gar nicht in dieses Konzept.
Mary hatte einen Bruder, Michael, der schon verheiratet war, selbst Kinder hatte und längst in dem väterlichen Kontor mitarbeitete, das er einst übernehmen würde, ferner zwei Schwestern, Helen und Eleonore, die mit standesgemäßen Männern aus der besseren Chicagoer Gesellschaft verheiratet oder, in Eleonores Fall, zumindest liiert waren. Mary, die Nachzüglerin, war schon dahingehend aus der Art geschlagen, dass sie, anstatt Klavier spielen und sticken zu lernen und Ausschau nach einer »guten Partie« zu halten, durchgesetzt hatte, den Beruf einer Krankenschwester zu ergreifen. Das hatte man im Kreis der Familie degoutant gefunden und seufzend als Marotte abgetan, als eine Laune, die sich zweifellos irgendwann geben würde, spätestens, wenn die hässliche Realität dieses Berufes die Oberhand über die wohlmeinenden Illusionen gewann, was, wie man meinte, unweigerlich war.
Und nun hatte man die Bescherung.
Der Verfasser dieser Zeilen muss an dieser Stelle gestehen, dass es seine detektivischen Fähigkeiten überstieg zu eruieren, was im Einzelnen versucht wurde, um die beiden Liebenden auseinanderzubringen; dafür widersprechen sich die wenigen Aussagen, die dazu getan wurden, zu sehr. Rhodans Eltern zogen es seinerzeit vor, mir gegenüber nur zu erklären, es sei »nicht ganz einfach« gewesen, schwiegen sich aber über alles Weitere aus, und es schien mir unangebracht, bohrende Fragen zu stellen. Katherine Tibo wiederum, Marys Mutter, ließ sich immerhin zu dem Eingeständnis hinreißen, es seien »wohl Fehler gemacht worden«, und versicherte, nichts gegen ihren Schwiegersohn zu haben, der »sich ja als sehr tüchtiger Mensch und Patriot erwiesen« habe, »im Gegensatz zu seinem Sohn«.
Lassen wir es also bei der Feststellung bewenden, dass sich zwei Liebende getroffen hatten, deren Liebe auf gesellschaftliche und familiäre Widerstände stieß, gegen die sie sich jedoch letztlich durchsetzten – wobei es vor allem, glaube ich, Mary oblag, ihrer Herkunftsfamilie die Stirn zu bieten, um ihr eigenes Glück zu sichern.
Jakob, der sich, seit er in Chicago war, meistens selber als »Jake« vorstellte, weil ihn seine Kollegen ohnehin so nannten, trug seinen Teil dazu bei, indem er eine andere, weitaus besser entlohnte Stellung fand, in Neuengland zumal, von dem Mary seit jeher träumte, genauer gesagt: in Manchester im amerikanischen Bundesstaat Connecticut.
Manchester war damals Sitz zweier großer, weltberühmter Firmen. Die größte und berühmteste war die Seidenfabrik der Cheney Brothers, 1838 von den Brüdern Ward, Rush und Frank Cheney gegründet und im Lauf der Zeit zum weltgrößten Hersteller von Seide aufgestiegen: Geschäftlicher Höhepunkt war der Erste Weltkrieg gewesen, als eine bis dato unvorstellbare Menge Seide für Fallschirme aller Art benötigt wurde. Doch der Krieg war lange vorbei, und zu dem Zeitpunkt, als Jake und Mary Rhodan nach Manchester zogen, ging es mit der Cheney Brothers Silk Factory langsam, aber sicher abwärts.
Jake hatte sich jedoch bei der zweiten bedeutenden Firma Manchesters beworben, der Seifen- und Reinigungsmittelfabrik The Bon Ami Company, die einen Betriebselektriker suchte, und prompt die Zusage bekommen.
Diese Firma ging auf einen gewissen J.T. Robertson zurück, der 1885 in Glastonbury eine auf Feldspat beruhende, besonders schonende Mineralienseife entwickelt und begonnen hatte, sie mit dem Bild eines frisch geschlüpften Kükens und dem Slogan Hat noch nie gekratzt zu vermarkten. 1891 war er mit seinem Betrieb nach Manchester gezogen, wo er die Seife anfangs mit drei, vier Mitarbeitern in einer alten Schrotmühle an der Ecke Oakland / North Main Street herstellte. Als sich Jake Rhodan bewarb, befand sich das Betriebsgelände schon lange an der Hilliard Street, und die millionenschwere Firma mit offiziellem Sitz in New York beschäftigte allein in dieser Fabrik 150 Mitarbeiter, unterhielt aber noch weitere Werke, unter anderem in Kanada.
Wie die gesamte amerikanische Wirtschaft litt auch die Bon Ami Company damals an den Auswirkungen der Great Depression, einer Wirtschaftskrise, die mit einem spektakulären Börsenkrach am 24. Oktober 1929 begonnen hatte. Sie überstand diese Zeit jedoch relativ gut, genauso wie übrigens später jene noch zu schildernde Krisenzeit, die letztendlich zur terranischen Einigung führen sollte. Tatsächlich gibt es diese Firma heute noch, wenn sie ihren Sitz auch nicht mehr auf der Erde hat: In mindestens drei extraterrestrischen Reichen erfreut sich die Bon Ami Seife nach wie vor großer Beliebtheit.
Nachdem Jake Rhodan seine neue Stellung angetreten hatte und auf einmal vergleichsweise gut verdiente, genug, um eine Familie zu unterhalten, wie es damals als unabdingbar betrachtet wurde, heirateten Jake Rhodan und Mary Tibo am 10. August 1934 auf dem Standesamt Manchester.
Dass niemand von Jakes Familie an diesem Ereignis teilnahm, ist verständlich, denn schließlich bestand diese Familie, abgesehen von den Verwandten im fernen Deutschland, zu denen sie längst keinen Kontakt mehr hatten, nur noch aus Jake und seinem Bruder Karl. Karl wiederum arbeitete inzwischen bei der American Telephone and Telegraph Company, kurz AT&T, und war ständig irgendwo im Amerika unterwegs, um alte Telefonleitungen zu erneuern oder neue zu verlegen, was für ihn bedeutete, im Lauf der Jahre Tausende von hölzernen Masten aufzustellen – und vor allem, dass er selber quasi nie telefonisch zu erreichen war, abgesehen von den Momenten, in denen die Telefontechniker, mit denen er reiste, testeten, ob die neuverlegte Leitung auch funktionierte.
Dass hingegen auch von Marys überaus zahlreicher Familie niemand bei der Trauung zugegen war, darf wohl als deutliches Zeichen verstanden werden, dass das junge Paar zum Tibo-Clan erst einmal nicht nur auf räumliche Distanz gegangen war.
Das Glück war Jake und Mary Rhodan auch weiterhin hold: In einer der vielen Zwangsversteigerungen, die mit dem Niedergang der Cheney Brothers einhergingen, ergatterten sie aus dem Immobilienbestand der einstmals reichsten Familie der Stadt ein malerisch am Nordwesthang des Case Mountain gelegenes Einfamilienhaus, und das zu einem überaus günstigen Preis. Es war nicht nur groß genug für mehrere Kinder, es verfügte auch über einen großen Garten und eine Garage. Eine Garage! Die freilich erst einmal leer bleiben musste, denn einstweilen fuhr Jake noch täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit, bis er, dank einer Sonderprämie, imstande war, sich ein Auto zu leisten, einen gebrauchten dunkelblauen 1932er Ford Model B: Im Jahre 1935 noch bei weitem keine Selbstverständlichkeit! Da das Haus weitab des Stadtzentrums lag, erlernte auch Mary das Autofahren, um Jake morgens zur Arbeit fahren zu können, wenn sie das Auto tagsüber benötigte.
So lebten die beiden sich ein, ziemlich auf sich gestellt, knüpften Beziehungen zu Nachbarn und gewannen Freunde in der Umgebung. Karl kam sie kurz nach ihrer Hochzeit besuchen und sorgte dafür, dass sie einen eigenen Telefonanschluss zu besonders günstigen Konditionen bekamen. Der Einzige aus Marys Familie, der sie ebenfalls kurz nach der Hochzeit besuchte, war Marys Großcousin Kenneth Malone, der Sohn ihrer Tante Patricia, der älteren Schwester ihres Vaters, die mit einem gewissen James F. Malone verheiratet war. Kenneth war bei der US Army und ein unverbesserlicher Junggeselle, aber er und Mary verstanden sich seit Kindertagen bestens.
4
Währenddessen durchlebte Jakes Bruder Karl sein eigenes Liebesdrama. Ein größerer Auftrag hatte das Team, zu dem er gehörte, in den Norden Wisconsins geführt, genauer nach Florence County, wo sie, wie er später erzählte, »eine Million Telefonmasten aufstellten, um Bauern miteinander zu verbinden, die kaum den Mund aufkriegen«. Bei einem Fest, das die Männer von AT&T des Abends besuchten, um ein wenig Abwechslung zu erleben, lernte Karl eine gewisse Laura Kelley kennen, mit der er sich so angeregt und so lange unterhielt wie noch nie zuvor mit einer Frau, und danach war er unsterblich verliebt.
Da ihr Auftrag auch beinhaltete, eine Telefonleitung zur Farm des Rinderzüchters Patrick Kelley zu legen, bot sich Gelegenheit, Laura wiederzusehen. Die fand Karl nicht unsympathisch, erklärte ihm aber beizeiten, dass das mit ihnen nichts werden könne, denn sie sei als einziges Kind ihrer Eltern die Erbin der Farm und könne deswegen nur einen Farmer heiraten. Dann werde er eben auf Farmer umlernen, erwiderte Karl, das sei schließlich nichts anderes als das, was sein Großvater auch gemacht habe; er stamme quasi aus einer Rinderzüchterfamilie!
Damit würden ihre Eltern nie einverstanden sein, erwiderte Laura, und außerdem gebe es da schon jemanden, dem sie, nun ja, sozusagen versprochen war.
Karl muss wohl gespürt haben, dass die Verbindung mit diesem anderen (ein Junge von einer rund zwanzig Meilen entfernt liegenden Farm namens Will Buckner) keine Angelegenheit des Herzens war, denn er gab nicht auf, sondern begann erst, Laura Kelley zu umwerben, auf jede Art, die ihm einfiel. Ausschlaggebend wurde aber, dass er ihrem Vater, der von der unglücklichen Romanze nichts ahnte, das Angebot machte, ihm den neuen, dringend benötigten Rinderstall zu einem guten Preis zu bauen. Er nahm unbezahlten Urlaub, engagierte zwei Freunde und errichtete gemeinsam mit ihnen in Rekordzeit ein Prachtstück von einem Stall. Und nicht nur das, er übernahm es auch, die Rinder höchstpersönlich aus dem alten in den neuen Stall zu führen und dort zu versorgen: Wie man das machte, hatte er sich von einem der anderen Farmer, die sie ans Telefonnetz angeschlossen hatten, zeigen lassen.
Patrick Kelley war beeindruckt, und als Karl ihm gestand, dass er dessen Tochter Laura über alles in der Welt liebe und alles auf sich nehmen würde, was nötig sei, um mit ihr zusammen sein zu können, konnte sich dieser das durchaus vorstellen. »Aber die Frage ist natürlich«, schränkte er ein, »was Laura dazu sagt.«
Die brach in Tränen aus vor Erleichterung, denn inzwischen war sie dem unbeholfenen Charme des deutschen Brummbärs erlegen und wäre untröstlich gewesen, ihn nie wiederzusehen. Die beiden heirateten etwa um die Zeit, als Mary Rhodan schwanger war. Karl kündigte bei AT&T, ging bei seinem Schwiegervater in die Lehre und erwies sich als so gelehrig wie noch nie zuvor im Leben: Karl Rhodan hatte seine Bestimmung gefunden.
Dann wären da noch die in Frankreich verbliebenen Thibeaus zu erwähnen, die sich auf lange Sicht als der fruchtbarste Zweig der Familie erweisen sollten. So war zum Beispiel ein gewisser Charles Thibeau einer der bekanntesten und eloquentesten politischen Gegner von Perry Rhodans Politik gegenüber den Kolonien, was nicht nur zu deutlichen Korrekturen dieser Politik geführt hat, sondern unter anderem auch dazu, dass auf vielen Kolonialwelten heute Statuen stehen, die Charles Thibeau darstellen, während bekanntlich von Perry Rhodan keine einzige Statue existiert, da es nicht zu den menschlichen Gepflogenheiten gehört, Denkmäler für noch Lebende zu errichten. Es deutet übrigens nichts darauf hin, dass sich Thibeau und Rhodan damals ihrer entfernten verwandtschaftlichen Beziehung bewusst waren.
Erwähnt werden muss an dieser Stelle auch noch »Oma« Eli, die in Wahrheit keine Großmutter war, sondern eine Großtante von Mary Rhodan, nämlich die jüngste Schwester ihres Großvaters Richard. Elena Thibeau, verheiratete Durkheim, hatte die französische Provinz Lothringen erst nach dem Tod ihres Mannes im Jahre 1939 verlassen, zu einem Zeitpunkt, als dort die von Deutschland drohende Gefahr schon deutlich zu spüren gewesen war. Der Einladung einer Freundin aus Kindertagen folgend, verschlug es sie ebenfalls nach Manchester, wo die beiden alten Frauen in bescheiden möblierten Zimmern in ein und demselben Mietshaus wohnten, ungefähr fünf Kilometer vom Haus der Rhodans entfernt.
Mary Rhodan erachtete es als ihre familiäre Pflicht, sich um die greise Großtante zu kümmern, ein Gefallen, den diese erwiderte, indem sie sich nach Perrys Geburt als Babysitterin betätigte, wenn Mary und Jake einmal einen Abend in Ruhe ausgehen wollten. Sie machte sich ein Vergnügen daraus, dem staunend lauschenden Baby Märchen auf Deutsch und Französisch vorzulesen, und als Jake das mitbekam und meinte, er wolle aber schon, dass sein Sohn ein richtiger Amerikaner werde, erwiderte sie, ein paar Fremdsprachenkenntnisse hätten noch niemandem geschadet. Dass Perry Rhodan auf diese Weise Deutsch oder Französisch gelernt haben soll, ist allerdings ein Gerücht; tatsächlich beherrscht er von beiden Sprachen nur ein paar Brocken, und wir kommen noch dazu, woher.
5
Beenden wir an dieser Stelle die Erkundung von Perry Rhodans weitverzweigter Herkunftsfamilie, obgleich man damit noch lange weitermachen könnte. Es sind nicht unkomplizierte, gleichwohl aber auch nicht untypische Verhältnisse, haben die diversen Kriege und Krisen des 20. Jahrhunderts alter Zeitrechnung doch viele Familien in ähnlicher Weise durcheinandergewirbelt und oft genug auch über den Erdball zerstreut. Stellen wir uns der Frage, ob und gegebenenfalls was uns das Wissen über die Familienverhältnisse, aus denen Perry Rhodan stammt, über ihn als Menschen verraten mag, insofern manche Eigenschaften vererbt und nicht erworben werden (und ignorieren wir für den Moment, dass sich die Gelehrten der gesamten bekannten Galaxis nach Jahrtausenden der Forschung immer noch streiten, in welchem Maße das gilt).
Auf der väterlichen Seite finden wir zunächst die praktische Begabung wieder, die Bereitschaft zu entschlossenem Handeln und hohe moralische Standards, die an die eigenen Taten angelegt werden.
Auf der mütterlichen Seite haben wir die Verbindung zu einer Dynastie von Kaufleuten und Händlern, Leuten also, die es gewohnt waren, in großen Dimensionen zu denken, und auch fähig und willens, zu Tricks zu greifen, um Ziele zu erreichen – beides Elemente, die im Leben Perry Rhodans bekanntlich schon oft eine Rolle spielten. Damit haben wir vielleicht auch einen der inneren Konflikte Rhodans benannt, denn ein Ziel vermittels einer List zu erreichen lässt sich nicht unbedingt immer mit den erwähnten moralischen Ansprüchen in Einklang bringen. Jakob Rhodan war, das glaube ich mit Sicherheit sagen zu können, mit vielen der Handlungen seines Sohnes nicht einverstanden, auch wenn man ihn nie dazu gebracht hätte, das zuzugeben, denn familiäre Loyalität zählte ebenfalls zu den Werten, die er unverbrüchlich hochhielt.
Aber bleiben wir noch eine Weile bei der Mutter, deren Einfluss man meines Erachtens kaum hoch genug einschätzen kann. Wir haben es bei Mary Tibo mit einer Frau zu tun, die sich entschlossen gegen Fremdbestimmung durchgesetzt hat und unbeirrbar ihren Weg gegangen ist: eine Beschreibung, die wortgleich auch auf ihren Sohn passt. Außerdem finden wir bei ihr ein hohes Maß an Hilfsbereitschaft, ein starkes Gefühl der Verpflichtung, anderen zu helfen – und paradoxerweise zugleich die Bereitschaft, das Familienleben dafür aufs Spiel zu setzen und das eigene Kind zu vernachlässigen, wie wir noch sehen werden: Auch das findet sich, wenn auch in abgewandelter Form, bei Perry Rhodan wieder, von dem wohl niemand je behauptet hat, er sei ein guter Vater.
Insbesondere die letztgenannte Schwäche, die zu seinen am häufigsten kritisierten Eigenschaften zählt, lässt sich unmöglich auf ein schlechtes Vorbild zurückführen, denn wenn Jakob Rhodan eines war, dann ein guter Vater. Dem Verfasser dieser Zeilen, der von sich bekennen muss, zu den eigenen Eltern nicht das beste Verhältnis gehabt zu haben, wird es unvergesslich bleiben, mit Jake Rhodan am Wohnzimmertisch zu sitzen, einem ruhigen Mann mit klar blickenden Augen und einer gelassenen, die Konsonanten immer ein wenig zu hart betonenden Stimme: Um diesen Vater beneide ich Perry Rhodan!
Was bleibt uns im Moment? Nur die Ahnung, dass die Erbanlagen zwar, wie so oft, eine Rolle spielen, aber das Wesen und das Schicksal eines Menschen dennoch nicht erklären. Folgen wir also weiter dem unbekannten Teil von Rhodans Leben, und schauen wir uns an, welche Ereignisse ihn geprägt haben, in der Hoffnung, auf diesem Weg tiefere Erkenntnisse zu gewinnen über das, was man das »Rätsel Rhodan« nennt.
6
Am 1. Dezember 1937 kam das zweite Kind der Rhodans zur Welt, ein Mädchen diesmal, das sie auf den Namen Deborah taufen ließen.
Nach ihren Erfahrungen mit dem ersten Kind hatten sie der Niederkunft relativ entspannt entgegengesehen. Doch nun mussten sie feststellen, was alle erfahreneren Eltern wissen, nämlich, dass keine zwei Kinder gleich sind und man in gewisser Weise jedes Mal neu anfangen muss. Bei Deborah war alles anders als bei Perry. Es fing schon damit an, dass sie nicht ganz richtig im Mutterleib lag und sich die Geburt dadurch schier endlos hinzog, die Mutter viel Blut verlor und das Kind schließlich mit der Zange geholt werden musste; es ging damit weiter, dass man das Baby erst einmal wegen Verdachts auf Gelbsucht im Krankenhaus behielt, ein Verdacht, der sich zum Glück nicht bestätigte. Und als die kleine Deborah endlich zu Hause war, war sie ein äußerst unruhiges Kind, das kaum einmal eine Stunde am Stück schlief, und wenn, dann nur vor Erschöpfung, weil es die übrige Zeit unablässig schrie oder zumindest quengelte. Zudem kränkelte sie ständig, hatte immer wieder Fieber, von dem der Arzt nicht sagen konnte, woher es kam; sie trank schlecht und nahm demzufolge nur zögerlich zu; kurzum, die ersten Monate waren für die Rhodans ein Albtraum. Keiner der beiden schlief in dieser Zeit auch nur eine einzige Nacht durch.
Perry, noch keine zwei Jahre alt, scheint die Ankunft eines jüngeren Geschwisters, zumal von einem, das die Aufmerksamkeit der Eltern so umfassend von ihm abzog, nicht als Bedrohung empfunden zu haben – im Gegenteil, er war offenbar von Anfang an fasziniert von seiner kleinen Schwester. Immer wieder fragte er, was sie denn habe, wieso sie schreie, und konnte stundenlang geduldig an ihrer Wiege sitzen und versuchen, sie zu beruhigen. Wundersame Heilkräfte besaß aber auch er nicht; Deborah ließ sich zwar manchmal eine Weile von ihm ablenken, um dann aber umso heftiger weiter zu schreien, zu quengeln oder zu weinen, gerade so, als müsse sie das Versäumte aufholen.
Nach drei bis vier Monaten ließ dieser »Weltschmerz«, wie Großmutter Katherine es nannte, allmählich nach, erstaunlicherweise etwa um die Zeit herum, als der erste Zahn durchkam, was normalerweise eher die entgegengesetzte Wirkung zu zeitigen pflegt. Wie auch immer, jedenfalls war Deborah ab da gut zu haben, und sie ließ sich auch überaus bereitwillig von ihrem Bruder durch die Gegend schleppen. Die beiden schienen in dieser Zeit eine Art geschwisterliche Geheimsprache zu entwickeln, denn sie lagen oft nur da, schauten einander an, machten seltsame Laute dazu und kicherten dann plötzlich los, als habe einer dem anderen einen guten Witz erzählt.
Deborah erwies sich als höchst intelligentes Kind. Wie es für zweite Kinder nicht untypisch ist, lernte sie, angeregt durch das Beispiel des älteren Geschwisters, alles schneller – sie krabbelte eher, lernte eher laufen und begann auch eher zu sprechen, der Erinnerung des Kinderarztes zufolge von Anfang an in Zweiwortsätzen, was diesen enorm verblüffte. Verblüfft muss auch »Oma« Eli gewesen sein, die berichtete, Deborah habe während einer ihrer fremdsprachlichen Märchenstunden einwandfrei französische und deutsche Wörter nachgesprochen, eine Beobachtung, für die wir allerdings nur ihr Wort haben, denn Deborah war nicht dazu zu bewegen, dieses Kunststück in Gegenwart ihrer Eltern zu wiederholen.
Überhaupt war sie nur schwer zu irgendetwas zu bewegen. So zeigte sie beispielsweise noch weniger Sinn für Ordnung als der kleine Perry. Das Konzept, Dinge aufzuräumen, blieb ihr fremd; jedes Spielzeug, an dem sie das Interesse verlor, blieb auf der Stelle liegen, und so herrschte in und um das Haus der Rhodans immer ein buntes Chaos aus Puppen, Holzautos, Bausteinen und dergleichen mehr.
Außerdem vermochte Deborah in einem Spiel völlig aufzugehen. Sie konnte seelenruhig in einer Zimmerecke sitzen und ihrer Puppe die Haare bürsten, während sich der Rest der Familie die Hälse nach ihr wundschrie: Nichts davon bekam sie mit, wenn sie in ihr Spiel vertieft war.
Dies spricht für eine außerordentliche Phantasiebegabung – eine grundsätzlich bewundernswerte, in Deborahs Fall aber leider womöglich eine verhängnisvolle Eigenschaft.
Am 18. Mai 1940 fuhr Mary Rhodan mit beiden Kindern zum Einkaufen. Derartige Ausflüge begeisterten Perry und Deborah immer, zogen sich aber auch immer viel zu lange hin, als dass die beiden nicht irgendwann angefangen hätten, sich zu langweilen. Sobald das Auto an der Auffahrt zur Garage zum Stillstand kam, hatten die Kinder also nichts anderes im Sinn, als so schnell wie möglich hinauszuspringen und sich auf eine der Spielsachen zu stürzen, die rechts und links der Auffahrt im Gras lagen, wo sie sie fallen gelassen hatten.
So geschah es auch an diesem Tag. Perry kehrte zu seinem Holzbagger zurück, Deborah zu ihrer Lieblingspuppe, die den Vormittag unter einem Busch verbracht hatte.
Ihre Mutter war derweil, die Fahrertür geöffnet und mit einem Fuß fast auf dem Asphalt stehend, im Wageninneren auf der Suche nach dem Einkaufszettel, der ihr heruntergefallen war und nun irgendwo zwischen den Sitzen lag. Obwohl der Einkauf schon erledigt war, brauchte sie diesen Zettel noch, da einige Dinge daraufstanden, die sie nicht bekommen hatte, die sie aber dringend benötigte und deswegen auf eine neue Liste für einen weiteren Einkauf andernorts übertragen wollte.
Mary Rhodan bemerkte bei ihrer emsigen Suche nicht, dass sich die Handbremse gelöst hatte, und, da ihr linker Fuß noch einen Fingerbreit über dem Boden schwebte, auch nicht, dass der Wagen allmählich ins Rollen kam. Dass irgendetwas nicht stimmte, fiel ihr erst auf, als sie Perry gellend aufschreien hörte, doch was vor sich ging, begriff sie auch in diesem Moment noch nicht. Sie schreckte nur hoch, bemerkte, dass der Wagen sich bewegte, und sah im Rückspiegel, wie ihr Sohn ausgerechnet hinter das bereits rollende Auto zu rennen im Begriff war!
Dieser Anblick versetzte sie in Panik, und entsprechend kopflos reagierte sie. Anstatt nach der Bremse zu greifen und sie wieder anzuziehen, anstatt zu verstehen, dass Perry losgerannt war, um seine Schwester zu retten, die wie üblich alles um sich herum vergessend direkt hinter dem Auto saß und ihrer Puppe ein Lied vorsang, sprang Mary Rhodan aus dem Auto, bekam ihren Sohn zu fassen und schleuderte ihn mit aller Kraft aus der Gefahrenzone, was zur Folge hatte, dass Perry mit dem Gesicht gegen einen der Zaunpfosten prallte und bewusstlos zu Boden fiel.
Dass das Auto anschließend über ihre Tochter hinwegrollte – das konnte Mary Rhodan nicht mehr verhindern.
Die hintere Stoßstange warf das Mädchen um, das rechte Hinterrad des tonnenschweren Ford rollte über ihre Oberschenkel, das rechte Vorderrad über Unterleib und Brust. Allen Versuchen der Mutter trotzend, es anzuhalten, kam das Vehikel erst an der Böschung auf der gegenüberliegenden Straßenseite zum Stillstand.
Mary Tibo Rhodan war als ausgebildete Krankenschwester geübt, ihre eigene Befindlichkeit auszublenden, wenn es darum ging, zu tun, was getan werden musste. Diese Fähigkeit, in den Jahren ihrer Ehe gewissermaßen eingerostet, wurde nun wieder wach. Trotz des Entsetzens, das sie beherrscht haben muss, schaffte sie es, den Notarzt zu rufen und anschließend ihrer Tochter Erste Hilfe zu leisten, bis der Krankenwagen eintraf. Während der Arzt sich um Deborah kümmerte, brachte sie den immer noch benommenen, Perry zur Nachbarin, rief ihren Mann in der Firma an und stieg dann mit in den Krankenwagen.
Doch alle ärztliche Hilfe kam zu spät. Noch in derselben Nacht, um kurz nach acht Uhr abends, starb Deborah an den inneren Verletzungen, die sie erlitten hatte.
7
Körperlich hatte Perry von dem Unfall nichts weiter davongetragen als eine leichte Gehirnerschütterung, die sich von selbst wieder gab, und jene kleine Narbe auf dem rechten Nasenflügel, die er bis zum heutigen Tag nicht hat entfernen lassen.
Seelisch aber war der Tod seiner Schwester ein Schock, der jahrelang nachwirken sollte.
Wohl infolge der Gehirnerschütterung hatte er eine leichte Amnesie erlitten, was hieß, dass er sich nicht mehr an Einzelheiten des Vorfalls erinnern konnte. Alles, was zwischen dem Aussteigen aus dem Auto und dem Moment, in dem es drüben gegen die Böschung rollte, geschehen war, war wie ausgelöscht. Er hatte nur das vage, überaus bedrückende Gefühl, an Deborahs Tod schuld zu sein.
Von diesem Tag an war es, als hätte sich ein düsterer Schatten auf die Familie Rhodan gelegt, ein Schatten, der entschlossen schien, nie wieder zu weichen. Die Beerdigung, die Trauerfeier – all das rauschte an dem noch nicht ganz vier Jahre alten Knaben vorbei, der die ganze Zeit nur an den Anblick seiner toten Schwester denken musste und zu begreifen versuchte, dass sie nie wieder aufwachen, dass sie nie wieder mit ihm zusammen Quatsch machen würde. Ganz bestimmt waren diese schmerzvollen Tage für ihn ein erstes Begreifen, wie zerbrechlich das Leben ist und wie wertvoll jeder Moment davon und wohl auch, wie sehr Liebe schmerzen kann, denn zweifellos hatte er seine Schwester über alles geliebt und würde nun ohne sie weiterleben müssen.
Doch eigentlich war es nicht der Unfall selbst, der diesen bedrückenden Schatten auf die Familie herabgezogen hatte, sondern die verhängnisvolle Art, wie damit umgegangen wurde, genauer gesagt, dass man sich quasi wortlos darauf geeinigt hatte, niemals darüber zu reden. Auch Perry hat, so jung er war, zweifellos gespürt, dass dies eines der Themen war, über die Fragen zu stellen unstatthaft und ungehörig war – ähnlich der unbeantwortet gebliebenen Frage, woher die Schwester denn eigentlich gekommen war. (Dem heutigen Leser mag das unglaublich vorkommen, aber tatsächlich kann das Ausmaß des sexuellen Unwissens zu jener Zeit kaum überschätzt werden. Aus Gründen, die selbst ich, obwohl ich ebenfalls in dieser Epoche aufgewachsen bin, heute nur noch schwer nachvollziehen kann, hielt man es für moralisch verderblich, Kinder über ihre eigene biologische Entstehung zu informieren, und für sittlich korrekt, ihnen stattdessen allerlei Märchen darüber zu erzählen oder ihnen den gesamten Themenbereich komplett zu verschweigen. Und wenn Sie das unfassbar finden sollten, so haben Sie völlig recht.)
In der Art, wie sie mit dem Verlust ihrer Tochter umgingen, offenbarte sich ein grundlegender Unterschied zwischen Jake Rhodan und seiner Frau.
Jake war, erstens, zwar vor der Eheschließung zum Protestantismus konvertiert, da Marys Familie keinen Katholiken akzeptiert hätte, aber er war im Katholizismus aufgewachsen und von daher an den Gedanken gewöhnt, dass Sünden vergeben werden können. Zweitens war er nicht sonderlich fromm – die sonntäglichen Kirchgänge waren für ihn in erster Linie eine dem gedeihlichen Zusammenleben in der Gemeinde geschuldete soziale Notwendigkeit. Lediglich an manchen, besonderen Tagen vermochte ein Gottesdienst es, ihn daran zu erinnern, dass das Leben, ja, die gesamte Existenz letzten Endes ein unerklärliches Mysterium war und immer bleiben würde und man gut daran tat, das Gefühl dafür nicht zu verlieren. Jake hatte sich über die Ankunft seiner Tochter gefreut und betrauerte ihren Fortgang, versuchte, die Erinnerung an die schönen Momente zu bewahren, doch dass das Leben weitergehen musste und würde, stand für ihn außer Frage.
Für Mary hingegen, die auf den ersten Blick Frommere der beiden, war die Religion im Grunde bislang ein reines Geschäft mit Gott gewesen: Sie hatte geglaubt, dass Gott, wenn sie alle seine Gebote befolgte, die erforderlichen Gebetsworte sprach und auch sonst tat, was er, gemäß den kirchlichen Lehren, von ihr erwartete, dann seinerseits alles Unheil von ihr und ihrer Familie fernhalten würde. Das war es, was sie, Mary Tibo Rhodan, von Gott erwartet hatte.
Und nun hatte Gott, indem er ihr Deborah weggenommen hatte, gegen diese Abmachung verstoßen. Ja, womöglich hatte es eine solche Abmachung nie gegeben? Dass dies möglich war, versetzte Mary geradezu in Panik. Wenn es gar nichts half, Gottes Gebote zu befolgen, wenn einen das vor nichts bewahrte – dann hieß das doch, dass sie einem übermächtigen Universum voller Gefahren hilflos ausgeliefert war!
Ihrer Beziehung zu Gott, dem Allmächtigen, solcherart die Geschäftsgrundlage entzogen zu sehen, überwältigte sie derart, dass sie keine Kraft hatte, sich auch noch um das Seelenleben ihres Sohnes zu kümmern. Dabei hätte nicht viel dazu gehört: Hätte sie bemerkt, wie sehr Perry unter dem Gefühl litt, schuld am Tod seiner Schwester zu sein, hätte sie ihm nur die Wahrheit zu sagen brauchen, nämlich: »Du hast keine Schuld.« Doch das brachte sie nicht fertig, denn dann hätte sie zugleich eingestehen müssen: »Ich war schuld!«
Und so zog sie es vor, Perrys seelische Nöte nicht an sich heranzulassen.
Selbst diese vertrackte Situation hätte sich zweifellos mit der Zeit klären lassen – hätten die beiden Eheleute nur darüber gesprochen! Jake, dem die Nöte seiner Frau nicht verborgen blieben, versuchte mehrmals, ein solches Gespräch zu beginnen, doch Mary reagierte mit so heftiger Abwehr, dass er irgendwann kapitulierte.
Und so wurden die dunklen Wolken über der Familie dunkler und dunkler.
8
Den selbstgemachten gesellten sich weitere dunkle Wolken hinzu, die aus der Ferne kamen.
In Europa herrschte inzwischen seit bald zwei Jahren Krieg. Das hatte Perry gehört, wenn er auch keine rechte Vorstellung davon hatte, wo dieses Land »Europa« lag und eigentlich auch nicht, was Krieg war. Er wusste nur: Krieg war etwas Schlimmes.
Das Schlimmste aber war, dass sein Dad daran würde teilnehmen müssen.
Eines Abends, während Mom in der Küche war und man hören konnte, wie sie weinte, nahm Jake Rhodan seinen Sohn auf den Schoß und versuchte, ihm zu erklären, worum es ging, nämlich: Das Land, aus dem Perrys Vater stammte – Deutschland –, hatte einen Krieg gegen die ganze Welt angefangen. Und es durfte diesen Krieg nicht gewinnen, weil sie andernfalls alle ihre Freiheit verlieren würden, was eine schlimme Sache wäre, vielleicht die schlimmste, die es gab.
»Noch schlimmer, als wenn man stirbt?«, fragte Perry skeptisch.
»Ja, viel schlimmer.« Sein Vater kratzte sich am Kopf. »Das ist schwer zu verstehen, wenn man erst vier ist, aber glaub mir, so ist es.«
Irgendwie verstand Perry es wohl doch, vor allem, dass es seinem Vater überaus ernst damit war. Er hatte es sich nicht ausgesucht, in den Krieg zu ziehen, sondern die amerikanische Regierung hatte ihn dazu einberufen – er zeigte Perry einen Brief mit allerlei imposanten Emblemen und Stempeln darauf –, aber da es nun einmal so war, würde er seine Pflicht tun, nicht zuletzt, um zu beweisen, dass nicht alle, die aus Deutschland kamen, schlechte Menschen waren.
Perry verstand an diesem Abend aber auch, dass das hieß, dass sein Dad Soldat werden würde, und dass Krieg darin bestand, dass die Soldaten beider Seiten aufeinander schossen, was es bisweilen mit sich brachte, dass sie einander totschossen.
Jake Rhodan, der nie viel davon gehalten hatte, Kindern unangenehme Tatsachen des Lebens vermittels tröstender Märchen zu verschweigen, sprach an diesem Abend mit seinem Sohn Klartext: »Ich werde natürlich auf mich aufpassen, so gut es geht. Aber man kann nicht wissen, was geschehen wird. Falls ich nicht zurückkommen sollte, bist du jedenfalls der Mann im Haus und musst für deine Mutter sorgen.«
»Okay«, sagte Perry.
»Ich will, dass du verstehst, dass ich es tue, weil es sein muss. Wenn ich nicht gehen würde, warum sollten dann andere gehen? Und wenn niemand gehen würde, dann würden die Bösen gewinnen, diejenigen, die uns die Freiheit nehmen wollen. Und das darf niemals geschehen.«
Am Morgen nach diesem Gespräch fuhren sie Dad zum Bahnhof von Manchester. Er hatte nur einen kleinen Koffer dabei, küsste sie alle beide zum Abschied und hatte danach feuchte Augen. »Bis bald«, sagte er, als er in den Zug stieg.
Aber es stimmte nicht, dass Dad bald zurückkam, im Gegenteil, es dauerte ganz schön lange, bis er wiederkam, und dann war er auch nur für ein Wochenende da, trug eine Uniform und roch nach Zigarettenrauch, den er doch eigentlich hasste?
An dieser Stelle ist es notwendig, sich den geschichtlichen Hintergrund zu vergegenwärtigen. Im Frühjahr des Jahres 1940 hatte die deutsche Wehrmacht Dänemark, Norwegen, Belgien, Luxemburg, die Niederlande und Frankreich erobert, Polen und die Tschechoslowakei waren bereits annektiert. Dieser Entwicklung konnte der amtierende amerikanische Präsident, Franklin Delano Roosevelt, nicht tatenlos zusehen. Er musste sich sagen, dass, wenn er es zuließ, dass sich das Deutsche Reich mehr und mehr Länder mitsamt seiner Ressourcen einverleibte, am Ende ein militärischer Gigant entstehen würde, dem der Rest der Welt nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Noch befanden sich die USA nicht im Krieg mit Deutschland – aber es war notwendig, sich darauf vorzubereiten.
So wurden eine Reihe von Gesetzen erlassen, unter anderem im September 1940 der Selective Training and Service Act, der erstmals in Friedenszeiten die Wehrpflicht einführte: Es geschah auf Grundlage dieses Gesetzes, dass Perry Rhodans Vater zum Militär einberufen wurde.
In der Rückschau kann man feststellen, dass Jake Rhodan seinem Sohn nicht ganz so viel Angst hätte machen brauchen, denn einstweilen bestand für die amerikanischen Soldaten keine Gefahr für Leib und Leben. Es ging zunächst nur darum, die kampftauglichen Männer zu erfassen und auszubilden, und das war es, was im Lauf des Jahres 1941 geschah. Ein Jahr nach Jake Rhodans Einberufung verfügten die USA über ein Heer von mehr als 1,6 Millionen Mann. Die Rüstungsindustrie war ebenfalls vergrößert worden; der Staat investierte in diesem Jahr 4,5 Milliarden Dollar in Waffen und Kriegsgerät, eine für die damalige Zeit ungeheure Summe.
Jake Rhodan wurde nach der Grundausbildung dem Army Air Corps zugeteilt, einer Einheit, aus der später die Air Force als eigene Waffengattung hervorging. Dort brachte er es im Lauf des Krieges bis zum Rang eines Master Sergeant.
Und: Ja, er kam heil zurück. Aber bis dahin sollten sechs Jahre vergehen.
Zwischenspiel (1)
22. Juli 1971 – London, Gefängnis Pentonville
Was immer es über das Verhältnis von Polizei und Justiz zum Verbrechen oder über das Wesen des Verbrechens an sich aussagen mag, Tatsache ist, dass die Insassen einer Strafanstalt in der Regel nicht die hellsten Sterne am Himmel sind. Faktisch waren die meisten meiner Mitinsassen dumm wie zwei Meter geteerter Weg – eine Aussage, mit der man zweifellos so manchem geteerten Weg unrecht tut –, und von den übrigen waren nicht wenige effektiv geisteskrank oder mental schlicht nicht leistungsfähig genug für ein Leben in Freiheit.
Doch an diesem Morgen begriffen sie irgendwie alle, was die Stunde geschlagen hatte. Und es war erschütternd mit anzusehen, wie breitschultrige Hünen, die einen Menschen mit bloßen Händen erschlagen konnten und hier waren, weil sie genau das getan hatten, auf die Knie fielen, die Hände falteten und anfingen, das Vaterunser zu beten. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Rattengesichtige Drogenkuriere taten es ihnen gleich; stumpfäugige Schlägertypen, die Raubüberfälle wegen ein paar hundert Pfund begangen hatten, gesellten sich zu ihnen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden.
Irgendwo schlugen Gittertüren heftiger als sonst. Hastige Schritte näherten sich: der Gefängnisgeistliche, noch im Begriff, die feierlichen Teile seiner Berufstracht an Ort und Stelle zu bringen. Als der anglikanische Geistliche die Kantine betrat, scharten sich die Männer um ihn, auch die Protestanten und Katholiken unter ihnen, sehnten sich nach seiner segnenden Hand auf ihren kahlgeschorenen Schädeln, suchten Beistand in der Angst, die sie befallen hatte.
Der Fernsehapparat wurde ausgeschaltet, Tische und Stühle gerückt, um einen improvisierten Gottesdienst abzuhalten, und das eilig, denn es wusste ja niemand, wie viel Zeit noch blieb bis zum großen Blitz und dem abrupten Ende. Ein Wärter schloss die Tür zu einem Nebenraum auf, für vier Insassen muslimischen Glaubens, die sich ein letztes Mal vor Allah niederwerfen wollten, ehe sie vor ihn gerufen wurden.
Ein fünfter, Abdul, ebenfalls Muslim, betete nicht, sondern gesellte sich zu mir, der ich mir einen Platz im Hintergrund der Kantine gesucht hatte. Abdul war ein bärtiger Mann mit vertrauenerweckenden blauen Augen, die zweifellos dazu beigetragen hatten, dass es ihm gelungen war, Tausende seiner Glaubensbrüder und -schwestern mit einem Investitionsschwindel um Millionen von Pfund zu betrügen.
»Wenn es geschieht, geschieht es, weil Allah es will«, meinte er, zog sich einen Stuhl heran und setzte sich neben mich. »Alles ist bei ihm beschlossen.«
»Bedauerlich allerdings, dass wir es aus der Froschperspektive der Eingesperrten erleben müssen«, erwiderte ich. »Immerhin wird es das letzte bedeutende weltpolitische Ereignis sein.«
»Denkst du, es wird uns überhaupt treffen?«
Ich hob die Augenbrauen. »London? Der Sitz der britischen Königin und ihrer Regierung? Das Zentrum der Weltfinanz? Das Herz des britischen Militärs? Ich denke, sie werden keinen Stein auf dem anderen lassen.«
Abdul seufzte schicksalsergeben. »Und anderswo? Werden anderswo Menschen überleben?«