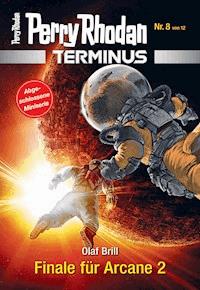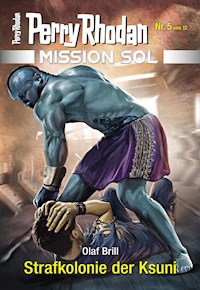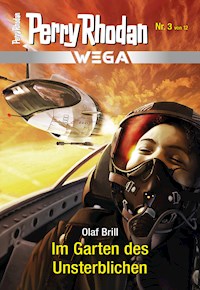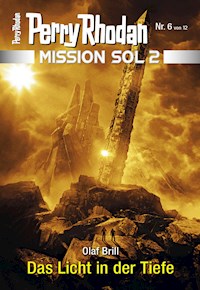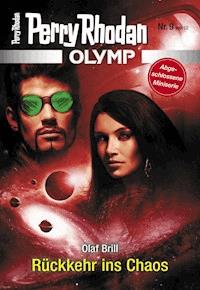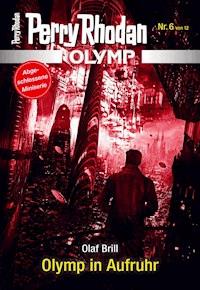Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Perry Rhodan digitalHörbuch-Herausgeber: Eins A Medien
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Perry Rhodan Neo
- Sprache: Deutsch
Vor sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan auf Außerirdische getroffen. Seither ist die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen und hat fremde Welten besiedelt, ist aber auch in kosmische Konflikte verwickelt worden. Seit einiger Zeit umkreisen Erde und Mond eine fremde Sonne im Sternhaufen M 3. Außerdem haben Leticrons Überschwere fünf Jahre lang das Solsystem und terranische Kolonien besetzt. Mittlerweile sind sie verjagt worden. Im Jahr 2107 wird Rhodan als körperloses Gehirn nach Naupaum entführt. Er ist nicht der einzige Mensch von der Erde, der sich als Ceynach in einem seltsamen Wirtskörper wiederfindet. Allerdings stammt der andere Terraner aus einer Ära, die mehr als drei Jahrhunderte zurückliegt. Um in einer für ihn völlig beängstigenden Welt zu überleben, ist er auf die Hilfe seines Körpers angewiesen. Der hegt ganz andere Pläne als DER MANN AUS DER VERGANGENHEIT ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Band 282
Der Mann aus der Vergangenheit
Olaf Brill
Cover
Vorspann
Teil I: Frankreich, 18. Jahrhundert
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Teil II: Yaanzar, 22. Jahrhundert terranischer Zeitrechnung
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Teil III: Die Suche nach Perry Rhodan
15.
16.
17.
18.
19.
Impressum
Vor sieben Jahrzehnten ist der Astronaut Perry Rhodan auf Außerirdische getroffen. Seither ist die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen und hat fremde Welten besiedelt, ist aber auch in kosmische Konflikte verwickelt worden.
Seit einiger Zeit umkreisen Erde und Mond eine fremde Sonne im Sternhaufen M 3. Außerdem haben Leticrons Überschwere fünf Jahre lang das Solsystem und terranische Kolonien besetzt. Mittlerweile sind sie verjagt worden.
Im Jahr 2107 wird Rhodan als körperloses Gehirn nach Naupaum entführt. Er ist nicht der einzige Mensch von der Erde, der sich als Ceynach in einem seltsamen Wirtskörper wiederfindet.
Allerdings stammt der andere Terraner aus einer Ära, die mehr als drei Jahrhunderte zurückliegt. Um in einer für ihn völlig beängstigenden Welt zu überleben, ist er auf die Hilfe seines Körpers angewiesen. Der hegt ganz andere Pläne als DER MANN AUS DER VERGANGENHEIT ...
Teil I
Frankreich, 18. Jahrhundert
Erinnerst du dich?
Erinnerst du dich an deinen Tod, Georges Jacques?
Weißt du noch, wie die kalte Klinge auf dich herabgefahren ist?
Spürst du, wie sie deinen Hals durchtrennt?
Ein scharfer Schnitt, und dein Kopf fällt in den Korb.
So banal, so endgültig.
Doch noch ist es nicht zu spät. Noch jagen die letzten Gedanken durch dein Gehirn.
Willst du schon tot sein, oder willst du dein Leben festhalten, im allerletzten Augenblick?
Den kleinen Zipfel, der dir noch bleibt.
Nun ist deine Existenz also eine abgeschlossene Einheit, vom Anfang bis zum Ende. Längst geschehen, eingebettet in die Geschichte des Universums. Wenn du willst, kannst du sie immer wieder durchleben. Dadurch ändert sich nichts.
Geburt und Tod. Das sind Singularitäten, Anfangs- und Endpunkte, aus denen es kein Zurück gibt. Dazwischen hat sich alles abgespielt, was du erlebt hast. All deine Gedanken und Gefühle, Handlungen und Verbrechen. Rebellion, Ungehorsam, Liebe, Verrat und Loyalität. Alle Wünsche, alle Hoffnungen. Deine Heldentaten und dein Versagen.
Könnten die Menschen von außen auf ihr Leben zurückblicken, würden sie versuchen, einen Sinn darin zu finden. Ein Ziel, das sie immer verfolgt haben. Einen Fluch, der sie stets begleitet hat. Etwas, das sie erreicht haben oder an dem sie gescheitert sind.
Stattdessen sterben sie einfach und fallen in die unendliche Schwärze.
Doch bei dir war es anders, nicht wahr? Du bist gestorben, und dennoch bist du immer noch da und denkst über dein Leben nach. Es ist ein unerklärliches Rätsel.
Aber da ist noch etwas, das dich begleitet.
Ein anderer Geist, so vertraut, so nah.
Etwas Großes.
Ein Name.
Was ist das für ein Name?
1.
Der Mann im Schilf schreckte hoch und strich mit der Hand über seinen Hals.
»Was hast du, Georges?«, fragte die junge Frau kichernd. »Magst du mich nicht mehr?«
In seinem vernarbten Gesicht arbeitete es. Verblüfft sah er auf seine fleischige Hand hinab.
Da war kein Blut. Die Hand war vollkommen trocken. Alles war genau dort, wo es hingehörte. Er nahm an, das war eine gute Nachricht. So absurd es war, er hatte gerade geprüft, ob sein Kopf noch auf dem Rumpf saß.
Ihm war, als sei die Welt gerade erst von einem grauen Nichts zu einem mit Leben erfüllten Etwas geworden, mit Farbe und Geruch und Geschmack. Voller Erstaunen blickte er hinab auf die Bauerntochter, die halb entblößt vor ihm am Ufer des Flüssleins Aube lag. Ihr Blick war fordernd und reizvoll, die junge Frau ließ keinen Zweifel daran, dass sie vollständig zu seiner Verfügung stand. Oder er zu ihrer. Man hatte so seine Verpflichtungen.
Zu seiner eigenen Überraschung legte er den Kopf in den Nacken und lachte. Es war ein urwüchsiges, dröhnendes Gelächter. Das Gelächter eines einfachen Mannes. Ja, dies war das echte, wahre Leben. Erfüllt mit leuchtenden Farben und rauschenden Tönen und einer weichen Frauenhaut, auf der sich vor Erregung die kleinen Härchen aufrichteten und unter der ein kleines, schnelles Herz pochte. Alles in diesem Leben roch und schmeckte und fühlte sich so gut an. Er hoffte fast, der Augenblick würde für ewig verweilen.
»Es war nichts, Fantine«, raunte er. »Ich musste nur grad an einen schlechten Traum denken von heute Nacht. Mir wurde der Kopf abgeschlagen.«
Sie blickte mit großen Augen zu ihm auf. »Du machst mir Angst, Georges!«
Wieder lachte er und blickte die junge Frau dann voller Wohlgefallen an. »Vergiss, was ich gesagt habe. Es war nur ein blöder Traum, nichts weiter. Du bist schön wie die Sonne, Fantine.«
Er senkte sich auf sie nieder, drückte seine wulstigen Lippen auf ihre und genoss den Augenblick.
Er wusste, dass er gemeinhin nicht gerade als Schönheit galt. Doch das war ihm schon immer egal gewesen. Als Kind hatten die Bauernjungen ihn gern verprügelt. Es hatte ihm nichts ausgemacht. Er hatte gelegentlich eine Rauferei gewinnen können, und das reichte ihm. Er sammelte Erfahrung und gewann immer öfter. Wichtiger war, dass die Mädchen ihm immer nachgelaufen waren. Das hatte die Bauernjungen umso mehr gereizt, und am nächsten Tag hatten sie ihm hinter der Mühle am Fluss gleich wieder aufgelauert. Er hatte ihnen ins Gesicht gelacht.
Seine platt gedrückte Nase stammte nicht von den Schlägereien. Sie war das Souvenir an eine Begegnung mit einem wilden Stier. So etwas konnte leicht passieren, wenn man im ländlichen Arcis aufwuchs.
Ein paar Jahre vorher hatte ihm schon ein anderes Rind die Oberlippe aufgerissen. Der Wulst war nie richtig verheilt. Dazu kamen die Narben in seinem massigen Gesicht. Sie stammten von den Pocken und einem schlimmen Nesselfieber, das ihn in der Jugend ereilt hatte. Die Frauen störte es nicht. Im Gegenteil, sie mochten einen Raufbold. Sein herbes Aussehen erschien ihnen wohl tollkühn und erwachsen. Zudem war er, wie er sehr wohl wusste, charmant und redegewandt, erst recht, nachdem er den König in Reims gesehen hatte und in die Stadt Troyes gezogen war. Die tumben Bauernburschen machten sich neben ihm aus wie stammelnde Kinder.
»Erzähl mir von der Königin«, hauchte Fantine. »Wie nah kamst du Marie-Antoinette? Konntest du ihr Parfüm riechen? Hatte sie rosa Kleider an? Hat sich euer Blick gekreuzt?«
Während er voller Vorfreude an ihrem Ohrläppchen knabberte, flüsterte er ihr Geschichten von der Anmut und der Schönheit der Königin zu. Nur die Hälfte davon war erfunden, der Rest entsprach der vollkommenen Wahrheit. Fantine seufzte und jauchzte. Die Aristokratie leistete dem Bourgeois mit der platten Nase gute Dienste.
Nachdem sie fertig waren und beide nackt, schwitzend und erschöpft im Gras lagen, reckte er den Kopf in Richtung Himmel, hob die Nase und richtete sich auf. Die frische, würzige Luft des Frühlings füllte seine Lungen.
Die Welt gehörte ihm, Georges Jacques Danton!
Zufrieden ließ Danton seinen Blick über die goldene Landschaft streifen, durch die sich die Aube schlängelte wie ein grüner Faden. Die verschlafene Champagne mit ihren kargen Feldern und sanften Hügeln war das Reich seiner Kindheit. Die Bauern arbeiteten hart, um dem Boden Nahrung abzutrotzen. Die Abgaben an die adligen Lehnsherren machten sie zu armen Leuten. Dennoch waren sie stolz und gottesfürchtig.
Danton liebte es, an diesen Ort zurückzukehren. Er wusste, dass er immer hierherkommen würde. Wegen Maman natürlich und dem Landwein und der Luft und der Freiheit. Und weil es ihm daheim jederzeit gelang, eine willige Konkubine wie Fantine zu finden, mit der er im Gras herumtollen konnte. Nicht, dass er in Troyes zu wenige Geliebte gehabt hätte. Aber keine von ihnen war so ehrfürchtig wie Fantine, die zu ihm aufblickte, als wäre er selbst ein König.
Nur dass sie ständig gluckste wie ein junges Huhn, ging ihm auf die Nerven.
»Was stehst du da nackt in der Landschaft, dass jeder deinen Hintern sehen kann?«, fragte sie gerade wieder feixend. »Wonach hältst du Ausschau? Was siehst du da, was ich nicht sehe? Wollen wir dieses Kinderspiel spielen?«
Danton hielt tatsächlich nach etwas Ausschau, nur wusste er nicht, wonach. Ein starkes Gefühl sagte ihm, dass da etwas in der Landschaft war, das nicht dorthin gehörte. Mürrisch antwortete er, ohne sich umzudrehen. »Gefällt dir mein Hintern nicht?«
Das war der Moment, als Danton zum ersten Mal den Dämon erblickte.
Er war so erschreckend und so echt, dass Dantons Herz von einem Moment zum anderen wild zu pochen begann.
Plötzlich war er da, in der Ferne, wie ein schwarzer Fleck in der Natur, als sei er soeben aus dem Höllenschlund aufgestiegen. Er stand starr und blickte aus roten Augen zu Danton herüber. Gesicht und Kopf hatte er unter der Kapuze eines Umhangs verborgen.
Und obwohl das Wesen so weit entfernt war, konnte Danton ihn kurioserweise riechen, fein nuancierte Noten nach Schwefel und Kupfer und vielen anderen Düften, die ihm vorkamen wie von einer fremden Welt. Er konnte den Dämon spüren und so scharf sehen, als ob die Kreatur direkt vor ihm stünde. Danton glaubte sogar, das Herz des Wesens zu hören. Der wuchtige Herzschlag des Dämons mischte sich zu seinem eigenen. Beide Herzen schlugen in einem eigenartigen doppelten Rhythmus.
Da streifte der Dämon die Kapuze zurück, und Danton erschauderte.
Es war unverkennbar kein Mensch, der da auf dem Feld stand. Es musste wahrhaftig ein Dämon sein. Statt Haaren trug er eine Art moosiges, grünes Fell. Dazu hatte er die Nase eines Hunds oder einer Katze und große, aufgerichtete Ohren wie die einer Fledermaus. Er sah aus wie ein Waldgeist aus den Märchenbüchern, die Maman ihm in Kindertagen vorgelesen hatte. Und er starrte über eine halbe Meile hinweg genau in Dantons Richtung.
Die nackte und warme Fantine schmiegte sich von hinten an seinen Körper. Ihr Herz schlug jung und unschuldig. »Dein Hintern ist königlich. Was hältst du von meinem? Du hast ihn lange nicht berührt.«
Danton wirbelte herum. Fantine kicherte. Er packte sie am Kinn und drehte ihr Gesicht in die Landschaft. »Siehst du das?«, rief er. »Siehst du das?«
Verstört löste sie sich aus seinem Griff. »Sehe ich was? Du bist seltsam heute. Denkst du schon wieder an deinen bösen Traum?«
»Nein, nein. Da ist nur ...« Danton kniff die Lider zusammen.
Der Dämon war verschwunden, so plötzlich, wie er gekommen war. Aber wohin war er verschwunden? An der Stelle, wo er gestanden hatte, gab es kein Höllenloch, in das er versinken, keinen Baum, hinter dem er sich verstecken, und keinen Hügel, über den er hätte fliehen können.
War der Dämon doch nichts weiter gewesen als ein Trugbild, die Erinnerung an einen bösen Traum, vermischt mit den Märchen seiner Kindheit?
Danton schüttelte verstört den Kopf. Es war helllichter Tag, er war wach wie ein Rotkehlchen am Morgen und vollkommen bei Sinnen. Noch immer stand der Geruch des Waldgeistes in seiner Nase.
»Ach, Fantine«, flüsterte er, nahm sie sanft in die Arme und küsste sie auf den Kopf. »Da war nichts, das dich belasten müsste. Ich habe gewiss nur einen Hund gesehen oder einen Vogel – einen Kranich oder eine Krähe.«
Aber sein Blick ging zurück auf die Felder der Champagne, die nun wieder unbewegt dalagen wie auf einem Gemälde. Nur ein sanfter Wind strich über die Grashalme, und in der Ferne zogen ein paar Schwalben ihre Bahn.
2.
Dämonen erblicken und vom Tod träumen, bevor sein Leben überhaupt erst richtig angefangen hatte? Das kam für Georges Danton überhaupt nicht infrage! Das Leben war dazu da, gelebt zu werden, und nicht, um auf den Tod zu warten.
Die frische Luft der Champagne, die sanfte Landschaft und die warme Haut der Bauerntöchter waren viel zu schön, als dass er sich von irgendeinem flüchtigen Schreckgespenst die Laune verderben ließe.
Dennoch beschloss er, alsbald nach Troyes zurückzukehren. Dort, im Herzen der Champagne, in der er den Großteil der zurückliegenden acht Jahre verbracht hatte, wollte er endgültig die düsteren Gedanken vertreiben, die ihn in Arcis erfasst hatten. Außerdem vermisste er die Schlägereien, den Wein, die Mademoiselles der Stadt und das Kartenspiel.
Deshalb suchte Danton nur wenige Tage später das nächstbeste Etablissement auf, von dem er wusste, dass im Hinterzimmer ein neues Spiel gespielt wurde, das Reisende aus England mitgebracht hatten und das sich bei den Bourgeois steigender Beliebtheit erfreute. Als er in die Stube trat, empfing ihn der Wirt, ein fetter, schwitzender Mann, dessen fleckiger Frack sich Mühe gab, gerade noch den dicken Bauch zu umspannen. Die Knöpfe erweckten den Eindruck, als hätten sie große Lust, davonzuspringen.
Danton hingegen war so vornehm gekleidet, dass es leichtfiel, ihn mit einem Adligen zu verwechseln. Er trug Herrenrock, Weste, Spitzenhemd, Stehkragen, Kniehosen und sogar Perücke und Dreispitz, den er im Innern von Gebäuden und zum Gruß auf der Straße abnahm. Seine vorzüglichen Manieren gefielen den jungen Damen in der großen Stadt genauso gut wie ihren Konkurrentinnen auf dem Lande. Die kreisende Bewegung, mit der Danton die Hand zum Gruß hob, hatte er perfektioniert.
»Ich höre, man kann hier ein ausgezeichnetes Blatt spielen«, eröffnete er liebenswürdig. »Wie hoch ist der Einsatz? Ich würde gern mitgehen.«
Der Wirt sah aus, als wollte er noch ein bisschen mehr schwitzen. Er machte ein paar unbeholfene Schritte auf Danton zu und fragte misstrauisch: »Wie viel gedenken Sie zu setzen, Monsieur?«
Danton nickte verständnisvoll, klopfte mit der Hand mal da und mal dort auf seinen Rock, zeigte ein formvollendet unterdrücktes Gähnen, lächelte und winkte den dicken Mann mit einer eleganten Bewegung noch näher zu sich heran. »Je suis désolé«, flüsterte er, wobei er dem Wirt den Kopf entgegenneigte. »Ich stelle soeben fest, dass ich meine Brieftasche nicht am Körper trage. Wie viel Crédit könnt Ihr mir gewähren?«
Gewann er beim Spiel, so sein Kalkül, wollte er den Schankwirt großzügig auszahlen. Verlor er, würde er den Mann auf spätere Zurückzahlung vertrösten, seinen Dreispitz nehmen und sich für ein paar Wochen in diesem Teil der Stadt nicht mehr sehen lassen.
Aber der fette Kerl überraschte ihn. »Ich habe mir gedacht, dass Sie das sagen würden«, behauptete er. »Sie sind dieser Danton, der seit einer Weile die Spielzimmer mit den hohen Einsätzen aufsucht, und wenn er verliert, auf ungeklärte Weise für immer verschwindet, nicht wahr? Ich habe mir Ihre Méthode bereits ausführlich schildern lassen. Mein Schwager betreibt nämlich einen ganz ähnlichen Club.«
»So, so«, säuselte Danton, als wäre er an dieser Auskunft nur milde interessiert. Er hatte nicht damit gerechnet, dass der Fette so viel reden würde.
»Exactement«, bestätigte der Mann und richtete tollkühn seinen Finger auf Dantons Bauch. »Sie sind weder adlig noch solvent. Und Sie sind in meinem Haus alles andere als willkommen. Gaspard! Vincent!«
Die beiden Namen rief er laut aus, und als hätten sie hinter einer Tür gewartet, bis sie gebraucht wurden, kamen Gaspard und Vincent schon heran. Es waren kräftige junge Männer, jeder einen Kopf größer als Danton, und beide offensichtlich nicht am Austausch von Höflichkeiten interessiert.
Danton zeigte ein müdes Lächeln. Er dachte noch: Die schaffe ich locker! Da packten sie ihn bereits am Rock und warfen ihn ohne viel Federlesens aufs Straßenpflaster.
Danton lachte überrascht, rappelte sich auf, richtete seine Kleidung und blickte vergnügt auf die bunten Fachwerkhäuser ringsherum. Ja, er war wieder in Troyes.
Eine zahnlose alte Frau, die auf der Bank vor einem der Häuser saß, kicherte boshaft.
Danton entbot ihr einen stummen Gruß.
Das Leben war ein großer Spaß.
Zwei Stunden später lag Danton verkehrt herum und nackt neben der süßen Anwaltstochter Jacqueline und zählte aufreizend langsam ihre Zehen.
Sie ließ es über sich ergehen und knabberte wie ein Mäuschen an einem Apfel, den sie von einer Schale auf dem Nachttisch genommen hatte. Ihre Frisur war derangiert, und sie sah entzückend aus in dem Leinenhemd, das sie behelfsmäßig übergeworfen hatte. Ihre Haut hatte einen fabelhaft blassen Teint, und sie roch nach Mandelholz und zarter Vanille.
Jacqueline war die Frau, vor der Danton keine Geheimnisse hatte. »Woher ich die frische Schramme auf der Stirn habe? Die wird wohl von meiner Begegnung mit ein paar unfreundlichen Gesellen in einer Seitengasse stammen, vier oder fünf waren es. Stell dir vor, diese Herrschaften erhoben Anspruch auf meine Brieftasche! Zum Glück konnte ich sie in die Flucht schlagen.«
Er hob spielerisch die Fäuste und lachte laut, wie es seine Art war. Mit großer Geste griff er ebenfalls einen Apfel von der Schale und schlug seine Zähne hinein. So machte man das, wenn man ein Mann war.
Zugegeben, vielleicht sagte er Jacqueline nicht immer die ganze Wahrheit. Zum Beispiel glaubte sie, er sei nach Arcis gereist, um seine Mutter zu besuchen. Das war nicht gelogen. Er hatte aber keinen gesteigerten Wert darauf gelegt, von seiner erneuerten Bekanntschaft mit Fantine im Schilf zu berichten.
Dennoch, so seltsam es klang, war er jederzeit bereit, Jacqueline sein ganzes Leben zu Füßen zu legen. »Erinnerst du dich an meine exzentrischen Träume vor ein paar Monaten?«, fragte er kauend und stocherte mit dicken Fingern in den Zähnen. »Du fandest sie amüsant.«
Jacqueline verdrehte die Augen. »Deine Träume sind dir wohl wichtiger als alles andere, was du mit deinem Leben anstellst, mon cher.«
Danton fuhr nervös durch seinen Schopf, bis die langen Haare in alle Richtungen abstanden. Die Geliebte hatte einen wunden Punkt getroffen. Manchmal hatte er das Gefühl, die zurückliegenden fünf Jahre seien an ihm vorbeigestrichen wie ein flüchtiger Augenblick. An manches hatte er nur eine schleierhafte Erinnerung. Aber seine Träume waren stets lebhaft und klar gewesen. Darin sah er stählerne Ungeheuer, die sirrend und mit feurig leuchtenden Augen auf ihn zukamen. Er lag festgeschnallt auf einer metallenen Folterbank und konnte sich nicht bewegen. Die Monster kamen näher und wollten ihn sezieren, in genau derselben Art, wie er es in den Anatomiekursen des Collège mit Fröschen gemacht hatte. Ein andermal sah er flammende Feuerbälle, die durch die Nacht flogen, silberne Riesen mit langen Armen und rätselhafte Katzenmenschen, die geschmeidig um Geräte schlichen, wie er sie noch nie zuvor erblickt hatte.
Mürrisch wischte er sich über den Mund und warf den Rest des Apfels weg. »Das waren dumme Jungenträume. All das liegt hinter mir. Ich bin erwachsen geworden, wie du sehr wohl weißt. Aber in Arcis hatte ich einen neuen Traum. Er fühlte sich so ... echt an. Ich will wissen, was du davon hältst.«
Unbehaglich strich er mit den Fingern über seinen Hals. »Ich träumte von meinem Tod. Und von einem Geist in der Dunkelheit, der meinen berührt. Aber ich kann mich an seinen Namen nicht erinnern. Ich habe das Gefühl, wenn ich den Namen wüsste, könnte ich einen Sinn in all dem finden.« Er wedelte vage mit der Hand in der Luft.
Jacqueline sagte nichts, aber in ihren Mundwinkeln zeigten sich zwei belustigte Falten. Ein sicheres Zeichen, dass sie seinen philosophischen Darlegungen mit äußerstem Amüsement zu folgen gedachte.
Nun, da er damit angefangen hatte, ließ er sich nicht mehr irritieren. »Hast du mal einen Traum gehabt, der dir so echt erschien, dass du selbst nach dem Aufwachen gedacht hast, er wäre das Leben? Der so echt war, dass du versucht hast, ihn auf deinen Reisen wiederzufinden? Das ist mir in Arcis passiert. Da habe ich nämlich einen Dämon gesehen. Nicht geträumt, sondern mit eigenen Augen gesehen. Er erschien mir so real, wie ich dich jetzt sehe.«
»Und was war das für ein Dämon?« Jacqueline beugte sich vor. »Der Tooooood?«
Er gab ihr einen kräftigen Biss in die Wade.
Sie kreischte auf, zog das Bein zurück und kroch in die hinterste Ecke des Betts. Als sie ein Kissen zu fassen bekam, pfefferte sie es in seine Richtung.
Er lachte und hielt sie an den Beinen fest.
Sie ließ sich zurückfallen. »Komm zu mir!«. Sie breitete die Arme aus. »Ich glaube, du hast ein wenig Entspannung verdient. Kommt zu mir und liebe mich, Roi!«
Er kletterte auf sie zu. »Wie hast du mich genannt?«
»Roi – König. Das ist doch der Spitzname, den die Leute in Troyes dir geben, wenn sie dich auf der Straße sehen. Wusstest du das nicht?«
»Sie nennen mich Roi?« Danton legte verblüfft den Kopf schief. »Dann gefällt es ihnen, wie ich mich gebe? Du weißt, ich bin kein Adliger qua Geburt. Niemand, dem der Reichtum der Welt in die Wiege gelegt wurde. Der Vater meines Vaters war selbst noch ein Bauer. Mein Vater brachte es zum Gerichtsvollzieher und Steuerbevollmächtigen. Nun gehören die Dantons schon zu den Bourgeois. Ich denke also, man kann sich einen solchen Namen verdienen. Ich ein König? Das gefiele mir.«
Er beugte sich über sie. »Verzeiht, Madame. Wenn ich nicht irre, habt Ihr soeben Eurem König einen Befehl erteilt? Erlaubt Ihr, dass ich ihn umsetze?«
»Ich bitte darum, Majestät.«
Danton saß mit hinter dem Kopf verschränkten Armen im Bett und dachte über Dämonen und Könige nach.
Jacquelines warmer Körper, nur halb bedeckt, lag neben ihm auf der Seite, den Kopf unter ihrem Arm vergraben. Ihr Brustkorb hob und senkte sich in leisem Rhythmus. Nach dem Grad der Dunkelheit und Stille auf der Straße zu urteilen, gab Danton der Sonne noch eine Stunde, um hinter dem Horizont der Champagne hervorzutreten. Er hatte die vollen vier Stunden geschlafen, die er benötigte, und war voller Energie.
Danton dachte an den Spitznamen, von dem Jacqueline ihm erzählt hatte, und wie der fette Wirt ihn mithilfe seiner Spießgesellen aufs Straßenpflaster befördert hatte. Vielleicht war es an der Zeit, die Stadt zu verlassen. Andernfalls würde eines Tages jedermann in Troyes Georges Danton für einen Gauner halten.
»Roi Danton«, sprach er den Namen laut aus. Er gefiel ihm. Trotzdem durfte er nicht zulassen, dass er unter diesem Namen bekannt wurde. Zu anmaßend war er, sogar für einen plattnasigen Jungen mit dem Selbstbewusstsein eines Georges Danton. Einstweilen musste es ihm genügen, wenn die Menschen ihn gelegentlich mit einem Adligen verwechselten – und sich ihm dadurch die richtigen Türen öffneten.
»Hm?«, machte Jacqueline, drehte sich um und zog die leichte Sommerdecke hoch. Sie brauchte mehr Schlaf als er. Aber während sein Schlummer ihn stets tief ins Reich der Bewusstlosigkeit schickte, war ihrer leicht wie der eines Vögelchens.
Sie blinzelte. Als sie sah, dass er grübelte, legte sie ihren Arm um ihn und murmelte schläfrig: »Hast du wieder geträumt?«
»Ich habe darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben anfange«, entgegnete er ernsthaft. »Ich bin jung, ich kann alles erreichen.«
Widerwillig wurde sie wach, richtete sich halbwegs auf und tippte ihm auf die behaarte Brust. »Willst du etwa doch noch Priester werden? Schlafe ich mit einem Mann Gottes?«
Entschlossen schüttelte er den Kopf. »Das sähen meine Onkel gern, der Pfarrer von Barberey und der Domherr von Troyes. Ich habe meine Ausbildung am Priesterseminar vor mehr als fünf Jahren beendet und dabei vor allem festgestellt, dass ich mit den Betbrüdern nicht viel gemeinsam habe.«
Jacqueline streckte sich und kicherte.
»Sie waren im Übrigen derselben Meinung«, fuhr Danton fort. »Meine Lehrer sagten, ich sei ein Faulpelz. Meine Handschrift sei zu krakelig, mein Latein abscheulich, meine Ergebenheit zu Gott fragwürdig. Lediglich das Collège der Oratorianer war keine vollständig verschwendete Lebenszeit. Da habe ich etwas über Natur- und Geisteswissenschaften gelernt. Das fand ich wenigstens brauchbar. Ich habe mit einem Teleskop in den Himmel geblickt und Sterne gesehen, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Weißt du, ganz so wie Charles Messier, der Kometenjäger. Er hat einen Katalog astronomischer Objekte erstellt. In meinem Geburtsjahr ist es ihm gelungen, den Halleyschen Kometen zu erspähen, der sich überhaupt nur alle siebzig oder achtzig Jahre der Erde nähert.«
Jacqueline zog beeindruckt die Mundwinkel nach unten.
Danton setzte sich vollständig auf. »Wir leben in einer neuen Zeit, Jacqueline. Im Zeitalter Voltaires! Im Zeitalter Newtons! Weißt du, was das bedeutet? Die dunkle Zeit des Mittelalters ist endgültig vorbei. Wir Menschen können alles erreichen. Dazu brauchen wir die Kirche nicht mehr, die an ein allmächtiges Wesen glaubt, das uns leitet – und uns verbietet, in der Seine zu baden. Stattdessen wird die Wissenschaft uns den Weg in die Zukunft weisen. Hier, sieh!«
Er tastete hinüber zum Nachttisch, fand eine Kerze und entzündete sie. Er suchte nach einem Zettel aus seiner Schulzeit, der bei den Briefen seiner Mutter liegen musste. Eine der wenigen Notizen, die er jemals aufgehoben hatte. Inzwischen kannte er die Worte auswendig. Aber als er das Blatt Papier gefunden hatte, reichte er es stolz Jacqueline.
»Deine Handschrift ist wirklich abscheulich!« Sie rieb sich den letzten Schlaf aus den Augen und las vor: »Natur und ihre Ordnung im Dunkeln sah man nicht – da sprach Gott: ›Es werde Newton!‹ Und es ward Licht.«
»Es ist ein Epitaph des englischen Dichters Alexander Pope«, erläuterte Danton. »Er wollte es in der Westminster Abbey anbringen lassen, wo Newton begraben liegt, der große Naturwissenschaftler. Es wurde ihm nicht erlaubt. Aber die Zeiten ändern sich.«
Bedächtig griff Jacqueline ebenfalls auf den Nachttisch. Sie nahm sich den Apfel vom Vorabend und biss noch ein winziges Stück davon ab. Brauchten Frauen grundsätzlich einen ganzen Tag, um einen einzigen Apfel zu essen?
»Ich habe über den Namen nachgedacht«, behauptete sie.
»Isaac Newton?«
Sie bedachte Danton mit einem strafenden Blick und legte den Apfel zurück. »Den Namen aus deinem Traum, an den du dich nicht erinnern kannst. Der Geist, der deinen berührt hat.«
»Was ist damit?«
»Vielleicht steht dieser Name ja für den Georges Danton, der du einmal werden sollst. Du hast die Schule vor fünf Jahren beendet, aber du weißt nichts mit deinem Leben anzufangen, außer bizarren Träumen nachzuhängen. Was willst du damit machen? Wohin willst du gehen? Willst du Physiker werden wie Newton, Astronom wie Messier oder Dichter wie Pope?«
Jacqueline war eine Frau von scharfem Verstand. Danton gestand sich ein, dass er die Antwort auf ihre Fragen nicht kannte.
3.
Georges Danton fluchte, denn er war spät dran.
Der Mann, der sich der besten Manieren der Stadt rühmte, hastete im kräftigen Tritt eines Bauernjungen die Rue Geoffroy-l'Asnier entlang. Noch im Gehen straffte er seinen Frack und richtete den Hut.
Ein Ochsenkarren, der im Schlamm stecken geblieben war, versperrte ihm den Weg. Danton fluchte erneut und drückte sich an der Hauswand entlang vorbei. Sobald es stark geregnet hatte, verwandelten sich die engen Gassen von Paris in ein einziges Sumpfland. Genauso stank es auch, und der üble Mief blieb in den Straßen, klebte an den Wänden und auf dem Pflaster und verließ die Stadt niemals.
Ein paar vor Schmutz strotzenden Kindern machte es nichts aus. Sie patschten barfuß im Matsch und jauchzten dabei vergnügt. Der Dreck spritzte so hoch, dass er trotz Dantons hoher Stiefel seine helle Hose befleckte. Die Kinder rannten wild kreischend davon. Danton schickte ihnen so derbe Beschimpfungen hinterher, dass sogar die Bettler ihre Köpfe nach ihm umdrehten.
Von Dantons Wohnung hinter der Kirche Saint-Gervais bis zum rechten Seineufer waren es nur ein paar Hundert Schritte. Musste er sich unbedingt auf diesem Weg das Beinkleid versauen an einem Tag, da er nicht nur Akten hin und her tragen sollte, sondern von seinem Dienstherrn vor Gericht erwartet wurde?