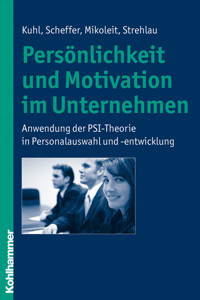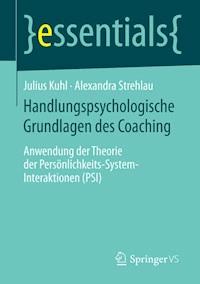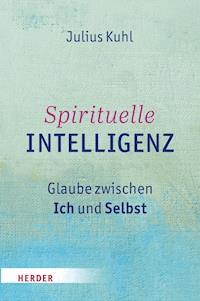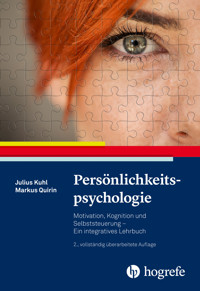
47,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Bei diesem Lehrbuch handelt es sich um die 2., vollständig überarbeitete Auflage des "Lehrbuchs der Persönlichkeitspsychologie" von Julius Kuhl. Es beschreibt verschiedene traditionelle Sichtweisen und Ansätze aus der Persönlichkeits- und Motivationspsychologie sowie ihre wichtigsten Forschungsbefunde. Dies geschieht in einer Weise, dass ein integratives Verständnis der menschlichen Persönlichkeit und somit vernetztes Denken erleichtert wird. Die Kapitel sind nicht nach vorherrschenden theoretischen Ansätzen (Schulen) oder Forschungsthemen geordnet, sondern systematisch nach sieben psychischen Prozessebenen: Gewohnheiten, Temperament, Affekt, Stressbewältigung, Motive, komplexe Kognition und Selbststeuerung. Persönlichkeit lässt sich demnach als die für das Individuum typische Art und Weise beschreiben, wie das Zusammenwirken der verschiedenen Prozessebenen das Erleben und Handeln steuert. Nach einem einleitenden Kapitel widmet sich jedes Kapitel des Lehrbuchs einer Prozessebene, behandelt theoretisch-historische Ansätze und stellt aktuelle Befunde vor. Das Lehrbuch schließt mit theoretischen und empirischen Entwicklungen, die das Zusammenwirken verschiedener Prozessebenen beleuchten, und einer Darstellung der Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen. Zahlreiche Kästen mit Zusammenfassungen, Definitionen und Beispielen gliedern den Text und erleichtern das Lernen. Reflexions- und Übungsaufgaben dienen der Prüfungsvorbereitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Julius Kuhl
Markus Quirin
Persönlichkeitspsychologie
Motivation, Kognition und Selbststeuerung – Ein integratives Lehrbuch
2., vollständig überarbeitete Auflage
Prof. Dr. Julius Kuhl, geb. 1947. Studium der Psychologie in Bochum und Philadelphia, USA. 1976 Promotion. 1976–1978 Postdoc an der University of Michigan, Ann Arbor, USA. 1978–1982 Wissenschaftlicher Assistent von Heinz Heckhausen in Bochum. 1982 Habilitation. 1982–1986 Leitender Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für psychologische Forschung in München. 1986–2015 Lehrstuhlinhaber für Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung an der Universität Osnabrück. 2008–2016 Leiter der Forschungsstelle Begabungsförderung im Niedersächsischen Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung (nifbe). Seit 2008 Mitglied des Kuratoriums der Andrea Kuhl-Stiftung für die wissenschaftliche Begleitung von Projekten zur Motivations- und Begabungsentwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Prof. Dr. Markus Quirin, geb. 1974. Studium der Psychologie an der Universität des Saarlandes. 2005 Promotion. 2005–2008 Postdoc im DFG-Graduiertenkolleg „Integrative Kompetenzen und Wohlbefinden“ des Fachbereichs Humanwissenschaften der Universität Osnabrück. 2008–2015 Akademischer Rat auf Zeit an der Universität Osnabrück, Institut für Psychologie, Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung. 2013 Habilitation. 2015–2016 Lehrstuhlvertretung Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung an der Universität Osnabrück. 2017–2018 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Paris-Lodron Universität, Salzburg, Österreich. Seit Juni 2018 Forscher an der TU München und seit 2019 Professor für Persönlichkeitspsychologie und Motivation an der PFH Göttingen.
Die erste Auflage dieses Buches ist 2010 unter dem Titel „Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie“ unter der Autorenschaft von Julius Kuhl erschienen.
Wichtiger Hinweis: Der Verlag hat gemeinsam mit den Autor:innen bzw. den Herausgeber:innen große Mühe darauf verwandt, dass alle in diesem Buch enthaltenen Informationen (Programme, Verfahren, Mengen, Dosierungen, Applikationen, Internetlinks etc.) entsprechend dem Wissensstand bei Fertigstellung des Werkes abgedruckt oder in digitaler Form wiedergegeben wurden. Trotz sorgfältiger Manuskriptherstellung und Korrektur des Satzes und der digitalen Produkte können Fehler nicht ganz ausgeschlossen werden. Autor:innen bzw. Herausgeber:innen und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und keine daraus folgende oder sonstige Haftung, die auf irgendeine Art aus der Benutzung der in dem Werk enthaltenen Informationen oder Teilen davon entsteht. Geschützte Warennamen (Warenzeichen) werden nicht besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen eines solchen Hinweises kann also nicht geschlossen werden, dass es sich um einen freien Warennamen handelt.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
Fax +49 551 999 50 111
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / boggy22
Satz: ARThür Grafik-Design & Kunst, Weimar
Format: EPUB
2., vollständig überarbeitete Auflage 2025
© 2010 und 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3258-8; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3258-9)
ISBN 978-3-8017-3258-5
https://doi.org/10.1026/03258-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet Seitenzahlen zwischen senkrechten Strichen (Beispiel: |1|), die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort: Inhalt, Aufbau und Lernziele
Kapitel 1 Einführung: Wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen
1.1 Sieben Quellen von Motivation und Emotion
1.1.1 Behaviorismus: Was man nicht messen kann, gibt es nicht?
1.1.2 Brauchen Motivation und Emotion eine Persönlichkeit?
1.1.3 Sieben Gründe „faul“ zu sein
1.2 Eigenschaft und Situation
1.2.1 Individuelle Unterschiede und Persönlichkeit
1.2.2 Gibt es stabile Persönlichkeitseigenschaften?
1.2.2.1 Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Person und Situation
1.2.2.2 Inter- versus intraindividuelle Ebene
1.2.2.3 Persönlichkeitsdynamik: Komplexität und Nichtlinearität in Kausalnetzwerken
1.3 Neurowissenschaftliche Untersuchung von Persönlichkeit
1.3.1 Neurowissenschaften und prozessorientierte Persönlichkeitspsychologie
1.3.2 Neurobiologische Grundlagen
1.3.3 Grundbegriffe der funktionellen Hirnanatomie
1.3.4 Spontan-EEG und ereigniskorrelierte Potenziale
1.4 Priming: Eine wichtige kognitionspsychologische Methode
Reflexionsaufgaben
Kapitel 2 Elementare Kognition: Gewohnheiten, Assoziationslernen, Objektwahrnehmung und Verhaltenspriming
2.1 Theoriegeschichte: Pawlow, Hull, Skinner
2.1.1 Pawlow und das Klassische Konditionieren
2.1.2 Gewohnheitslernen: Hulls Principles of Behavior
2.1.3 Operantes Konditionieren: Skinners radikaler Behaviorismus
2.2 Verhaltensroutinen
2.2.1 Intuitive Verhaltenssteuerung: Flexibel, spontan und oftmals vage
2.2.1.1 Sensumotorische Parallelverarbeitung
2.2.1.2 Sensumotorische Fusion
2.2.1.3 Sensumotorik: Bahnung und Emotionsansteckung
2.2.2 Objekterkennung: Genau, gründlich und manchmal zwanghaft
2.2.2.1 Gestaltgesetze: Woher wissen die Teile, dass sie zum Ganzen gehören?
2.2.2.2 Feldunabhängigkeit: Objekterkennung beeinflusst die Persönlichkeit
2.2.2.3 Aufmerksamkeit ist der „Leim“ der Merkmalsintegration
2.2.2.4 Wie objektiv ist die Objektwahrnehmung?
2.2.3 Ab- und Ankopplung von Objektwahrnehmung und Verhaltenssteuerung
2.2.4 Neurobiologische Grundlagen von intuitiver Verhaltenssteuerung und Objekterkennung
2.3 Konditionierung primärer Emotionen
Reflexionsaufgaben
Kapitel 3 Temperament: Aktivierung und Erregung
3.1 Theoriegeschichte: Pawlow, Eysenck, Berlyne
3.1.1 Pawlows Erregungskonzept: Jeder Hund hat eine Persönlichkeit?
3.1.2 Persönlichkeitsdimensionen: Von den Großen Drei zu den Big Five
3.1.2.1 Eysencks Beitrag zur Persönlichkeitspsychologie
3.1.2.2 Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit
3.1.3 Berlyne: Neugier und Erregungsregulation
3.2 Globale Energie: Aktivierung und Erregung
3.2.1 Motorische Aktivierung: Wenn Personen impulsiv, opportunistisch oder launisch sind
3.2.2 Sensorische Erregung: Wenn Personen sensibel, genau oder nervös sind
Reflexionsaufgaben
Kapitel 4 Affekt und Anreizmotivation: Aufsuchung, Vermeidung und Objektbindung
4.1 Theoriegeschichte: Freud, Lewin, Gray
4.1.1 Freuds Triebtheorie
4.1.2 Lewins Topologie des Lebensraums
4.1.3 Belohnungs- und Bestrafungsaffekte: Gray
4.2 Anreizmotivation: Bahnung und Hemmung des Verhaltens
4.2.1 Aufsuchen
4.2.1.1 Sucht und dopaminerge Substanzen
4.2.1.2 Anreizmotivation
4.2.1.3 Individuelle Unterschiede in der Anreizsensibilität
4.2.1.4 Basisbedürfnisse und Homöostase: Hunger, Durst und Thermoregulation
4.2.2 Vermeiden
4.2.2.1 Funktionsmerkmale des Bestrafungssystems
4.2.2.2 Bestrafungswirkungen: Intelligente Bewältigung
4.3 Affektive Vermittlung von Belohnung und Bestrafung
4.3.1 Emotionen als motivationale Regelgrößen
4.3.2 Positive und negative Affekte: Gegenpole einer Dimension oder zwei separate Dimensionen?
4.3.3 Zusammenhang zwischen Affekt und elementarer Kognition
Reflexionsaufgaben
Kapitel 5 Stressbewältigung und Regression: Top-down- versus Bottom-up-Steuerung
5.1 Theoriegeschichte: Triebunterdrückung und Regression in Freuds Theorie
5.1.1 Regression und psychosexuelle Entwicklungsphasen
5.1.2 Angst und Verdrängung: Von der Traumatheorie zur Triebunterdrückungstheorie (und zurück)
5.2 Stressbewältigung: Progression und Regression
5.2.1 Progression: Rationale Modulation von Emotion und Verhalten
5.2.2 Regression: Dysfunktionale Stressfolgen
5.2.2.1 Emotionale und psychosomatische Störungen
5.2.2.2 Affektregulationsfähigkeit
5.2.2.3 Adaptivität von Affektregulationsstrategien
5.2.3 Zur Entwicklung integrativer Kompetenz: Die Dialektik von Progression und Regression
Reflexionsaufgaben
Kapitel 6 Motive: Erfahrungsnetzwerke um Bedürfniskerne
6.1 Theoriegeschichte: McDougall, Murray, McClelland, Atkinson
6.1.1 Zielgerichtete Motivation durch Instinkte: McDougall
6.1.2 Projektion und Motivmessung: Murray
6.1.3 Von den sozialen Folgen der Motive bis zu ihren biologischen Grundlagen: McClelland
6.1.4 Von der Modellierung der Leistungsmotivation bis zur Mathematik der Handlungsdynamik: Atkinson
6.2 Motive: Haben oder Sein
6.2.1 Wirkungsorientierte Motive: Leistung und Macht
6.2.1.1 Das Leistungsmotiv
6.2.1.2 Das Machtmotiv
6.2.2 Sein und Erleben: Beziehungs- und Selbstentwicklungsmotive
6.2.2.1 Das Beziehungsmotiv: Von der Abhängigkeit zur persönlichen Begegnung
6.2.2.2 Das Freiheitsmotiv: Von der Unabhängigkeit zur sozial-integrativen Selbstentwicklung
6.3 Testtheoretische Überlegungen und der Operante Motivtest
Reflexionsaufgaben
Kapitel 7 Sinn und Ziele: Kognitive Quellen der Handlungssteuerung
7.1 Theoriegeschichte: Jung, Kelly, Frankl
7.1.1 Kognitive Verarbeitungsstile: Jung
7.1.2 Kognitive Konstrukte: Kelly
7.1.3 Sinnerleben: Frankl
7.1.4 Intelligenz: Die Messung kognitiver Fähigkeiten
7.1.4.1 Methoden der Intelligenzdiagnostik
7.1.4.2 Einige Ergebnisse der Intelligenzforschung
7.2 Kognition: Analytisch versus holistisch
7.2.1 Analytische Verarbeitung: Konkrete Ziele, Planen, Monosemantik
7.2.1.1 Begriffsbestimmung: Motive, Ziele, Absichten
7.2.1.2 Von der Zielbildung zur Umsetzung: Selektions- und Realisationsmotivation
7.2.1.3 Aufsuchungs- und Vermeidungsziele
7.2.1.4 Kausalattribution und Heckhausens rationales Handlungsmodell
7.2.2 Holistische Verarbeitung: Allgemeine Ziele, Sinn, Kreativität
7.2.2.1 Lebensziele
7.2.2.2 Aufsuchen und Vermeiden: Wohlbefinden und Gesundheit
7.3 Integrativer und reduktiver Bewusstseinsbegriff
7.3.1 Bewusstsein durch Mehrebenen-Verarbeitung
7.3.2 Reduktives (Ich-zentriertes) versus integratives Bewusstsein
7.3.3 Zum Anpassungswert des Bewusstseins
Reflexionsaufgaben
Kapitel 8 Selbststeuerung: Ich und Selbst
8.1 Theoriegeschichte: Erikson, Kohut, Rogers
8.1.1 Erikson: Epigenetische Stufen der Selbstentwicklung
8.1.2 Kohut: Selbstentwicklung durch Widerspiegeln
8.1.3 Rogers: Wie funktioniert die „voll funktionstüchtige Persönlichkeit“?
8.2 Volition: Zentrale Steuerung von Gedanken, Gefühlen und Verhalten
8.2.1 Selbstkontrolle: Wille als Selbstdisziplin
8.2.1.1 Analytische Verarbeitung und Selbstkontrolle
8.2.1.2 Automatische Verarbeitung und Handlungsabschirmung
8.2.2 Selbstregulation: Wille als freies Selbstsein
8.2.2.1 Von der Selbstkontrolle zur Selbstregulation: Zielinternalisierung und Selbstbestimmung
8.2.2.2 Diskrepanzen zwischen impliziten und expliziten Motiven als Indikatoren geringer Selbstregulation
8.3 Selbststeuerung von Emotionen
8.3.1 Selbstkontrollierte Bewältigung von Affekten und Stress: Bewusst und oft anstrengend
8.3.2 Selbstregulierte Bewältigung von negativem Affekt und Stress: Intuitiv und „von selbst“
Reflexionsaufgaben
Kapitel 9 Integration und Ausblick
9.1 Verhaltens- und erfahrungsorientierte Verarbeitung auf sieben Systemebenen
9.1.1 Ebene 1: Intuitive Verhaltenssteuerung und Objekterkennung
9.1.2 Ebene 2: Aktivierung und Erregung
9.1.3 Ebene 3: Positiver und negativer Affekt
9.1.4 Ebene 4: Progression und Regression
9.1.5 Ebene 5: Wirkungsorientierte und erlebnisorientierte Motive
9.1.6 Ebene 6: Logisch-sequenzielles Denken und ganzheitlich-paralleles Auffassen
9.1.7 Ebene 7: Selbstkontrolle und Selbstregulation
9.2 Interaktionen zwischen den Systemebenen
9.2.1 Absichten, Ziele und Ideale: Warum sind sie präsenter bei Menschen, die sie nicht realisieren?
9.2.2 Ganzheitliches Erleben: Komplexe Leistungen und die Dämpfung negativen Affekts
9.2.3 Die Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen
9.2.3.1 Willensbahnung durch positiven Affekt und Absichtsaktivierung
9.2.3.2 Selbstentwicklung durch konfrontative Bewältigung negativen Affekts
9.2.4 Persönlichkeitsstörungen: Eine psychofunktionale Interpretation
9.3 Anwendung: Funktionale Systemdiagnostik
Reflexionsaufgaben
Anhang
Literatur
Glossar
Lösungshinweise zu den Reflexionsaufgaben
Ergänzende Übungsaufgaben
Lösungshinweise zu den ergänzenden Übungsaufgaben
Sachregister
|11|Vorwort: Inhalt, Aufbau und Lernziele
Die Lektüre des Vorworts erleichtert sowohl das Verständnis des Inhalts, das Arbeiten mit dem Buch und somit nicht zuletzt das Lernen. Daher legen wir den Leser:innen (insbesondere den sich mit diesem Lehrbuch auf eine Prüfung vorbereitenden Studierenden) ans Herz, das Vorwort nicht auszulassen. Am Ende des Vorworts werden zudem Lerntipps für die Prüfungsvorbereitung an die Hand gegeben. Der hier vorgelegte Lehrbuchtext basiert auf einer gekürzten und aktualisierten Version des im Hogrefe Verlag erschienenen „Lehrbuch der Persönlichkeitspsychologie“ von Julius Kuhl (2010). Der Inhalt wurde umfassend überarbeitet, neue Forschungslinien (u. a. „Personality Dynamics“) wurden beschrieben und entsprechende Studien exemplarisch dargestellt. Das Lehrbuch ist als Grundlage oder Zusatzlektüre für Bachelor- und Masterveranstaltungen im Psychologiestudium gedacht. Aufgrund der ausführlichen Darstellung psychologischer Perspektiven, Forschungsrichtungen und entsprechender Studienbeispiele lässt es sich einerseits sowohl als zentrales Lehrbuch für Vorlesungen der Persönlichkeitspsychologie als auch der Motivationspsychologie einsetzen, aber auch als Lektüre in Vertiefungsveranstaltungen des Bachelor- und Masterstudiengangs – je nach thematischer Schwerpunktsetzung.
Die Einsetzbarkeit in mehr als einer Fachdisziplin mag ungewöhnlich erscheinen, stellt aber eine unmittelbare Konsequenz der Auffassung der Autoren dar, dass Persönlichkeitspsychologie nicht ohne Kenntnisse der Motivations-/Emotions-, aber auch der Kognitiven Psychologie gelehrt werden kann, weil Persönlichkeit als individuelles Muster affektiver, motivationaler, kognitiver und volitionaler Prozesse und Eigenschaften verstanden werden kann (u. a. Allport, 1937; Kuhl, 2000a, 2000b; Quirin et al., 2020; Wilt & Revelle, 2015). Insbesondere hilft diese interdisziplinär-integrative Sichtweise Studierenden, ein Gesamtverständnis von der menschlichen Psyche und Persönlichkeit zu entwickeln, welches ihnen sowohl persönlich als auch im späteren Beruf zugutekommen wird.
Inhaltlicher Fokus
Es werden unterschiedliche Sichtweisen und Ansätze aus der Persönlichkeits- und Motivationspsychologie beschrieben. Die Vielfalt der Theorien (einschließlich des Eigenschaftsansatzes) wird in diesem Buch aus einer funktionalen, prozessorientierten, „persönlichkeitsdynamischen“ Perspektive betrachtet. Dieser Sichtweise ist zentral, dass Persönlichkeitsunterschiede in individuellen Differenzen einzelner Prozesse zu sehen sind („Personality Processes“), die von Augenblick zu Augen|12|blick variieren und durch situative Gegebenheiten differentiell aktiviert werden können (Persönlichkeits-Situations-Ansatz). Der persönlichkeitsdynamische Ansatz berücksichtigt somit, dass sich Personen in manchen Situationen anders erleben oder verhalten als in anderen (z. B. gesellig oder „extravertiert“ statt verschlossen oder „introvertiert“). Dadurch fokussiert sich die entsprechende Forschung auf die Frage, wie diese Prozesse innerhalb von Personen zustande kommen und wie dennoch entsprechende Persönlichkeitsunterschiede zwischen Personen erklärt und beschrieben werden können. Zum anderen analysiert die persönlichkeitsdynamische Sichtweise mit unterschiedlichen empirischen Methoden die Unterschiede zwischen funktional unterschiedlichen Persönlichkeitsvariablen (z. B. Geselligkeit und Aktivitätsniveau), statt sich darauf zu beschränken, Selbstkonzepte von Persönlichkeit mithilfe der Faktorenanalyse zu einigen wenigen Persönlichkeitsdimensionen zu aggregieren. Die persönlichkeitsdynamische Perspektive sucht stattdessen nach Erklärungen dafür, dass bestimmte Persönlichkeitsvariablen so hoch miteinander korrelieren, dass sie gerne zusammengefasst werden. Persönlichkeitsdynamik berücksichtigt zudem die komplexen Zusammenhänge von Prozessen innerhalb einer Person (Denissen, van Aken, Penke & Wood, 2013; Kuhl, 2001; Quirin et al., 2020; Rauthmann, 2020). Dabei werden unter anderem kognitive, affektiv-motivationale und volitionale („willensbezogene“) Prozesse sowie deren Wechselwirkungen untereinander und mit der Umwelt hinsichtlich ihrer Auswirkung auf Erleben und Verhalten analysierbar. Alles in allem wird durch diese Betrachtungsweise auch die Individualität einer Person berücksichtigt und – durch das Denken in komplexen, dynamischen Systemen – eine hohe interdisziplinäre Anbindungsfähigkeit ermöglicht.
Der persönlichkeitsdynamische Ansatz basiert u. a. auf dem handlungspsychologischen Grundgedanken, dass innerpsychologische Vorgänge letztlich den Zweck haben, Handlungen und deren Ergebnisse zu optimieren. Auch Nichthandeln zum Zwecke genauen Nachdenkens, Abwartens oder Einsortierens neuer Erlebnisse in bestehende Schemata dient letztlich der Verbesserung künftiger Handlungen. Das ist auch evolutionsbiologisch sinnvoll, da Selbst- und Arterhaltung letztlich über erfolgreiches Handeln ermöglicht wird. Nach diesem handlungspsychologischen Grundgedanken lässt sich Persönlichkeit als die Vielzahl individueller Besonderheiten in den innerpsychischen Prozessen auffassen, die das Individuum im Rahmen seiner (beschränkten) Möglichkeiten optimal an seine Umwelt anpassen sollen.
Die durch den persönlichkeitsdynamischen Ansatz forcierte Hinwendung zu den Mechanismen, die der Persönlichkeit zugrunde liegen, ist im Einklang mit dem eigentlichen Selbstverständnis der Psychologie als Naturwissenschaft: Naturwissenschaften möchten Phänomene erklären, statt sie lediglich zu beschreiben (Windelband, 1904). Im Fokus der Persönlichkeitspsychologie steht dabei auch die Frage, wie die hohe Verhaltensvariabilität über Situationen und/oder Zeit hinweg |13|mit der Idee relativ stabiler Persönlichkeitseigenschaften in Einklang gebracht werden kann und welche messtheoretischen Implikationen dies hat. So ist z. B. der durch die klassische Testtheorie postulierte Messfehler, die angeblich zufällige Streuung der Messwerte um den wahren Wert für die zu messende stabile Eigenschaft, vielleicht doch systematisch, also erklärbarer Natur?
Wenn man so möchte, kann man den persönlichkeitsdynamischen Ansatz auch Allgemeine Persönlichkeitspsychologie nennen (Kuhl, 2010), weil er persönlichkeitsrelevante Erkenntnisse aus Forschungsbereichen verbindet, die z. T. noch auf verschiedene Fächer der Psychologie verteilt sind, besonders aber, weil er ein altes Missverständnis zu überwinden sucht, das einen Gegensatz zwischen Persönlichkeitspsychologie und Allgemeiner Psychologie konstruiert. Auf den ersten Blick ist dieser Gegensatz nachvollziehbar: Wenn der Zusammenhang zwischen bestimmten Umweltbedingungen und dem Verhalten für verschiedene Personen unterschiedlich ist, scheint es keine allgemeine Gesetzmäßigkeit zu geben. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich: Die Berücksichtigung individueller Besonderheiten schmälert die Allgemeingültigkeit psychologischer Gesetzmäßigkeiten ebenso wenig wie die Allgemeingültigkeit der Relativitätstheorie durch die Berücksichtigung der Masse der Körper verloren geht, auf die sie angewendet werden soll (Lewin, 1935; Kuhl, 2018). Indem wir die Erforschung von individuellen Unterschieden als Gegenstand der Differentiellen Psychologie auf die Untersuchung aller Ebenen der Persönlichkeit anwenden, die das Erleben und Verhalten beeinflussen, lassen sich die Ergebnisse der Persönlichkeitsforschung und ihrer Nachbardisziplinen (Emotions-, Motivations-, Kognitions- und Neuropsychologie) zu einer einheitlichen bzw. allgemeinen Persönlichkeitspsychologie integrieren. Hierin unterscheidet sich der persönlichkeitsdynamische Ansatz von den Inhalten der Nachbardisziplinen: Er betrachtet das komplexe Wirkungsgefüge kognitiver, affektiv-motivationaler und volitionaler Prozesse (und entsprechender individueller Unterschiede), statt ihre Wirkung auf Verhalten und Erleben isoliert zu untersuchen.
Gliederung und Aufbau des Buches
Durch die persönlichkeitsdynamische Perspektive weicht dieses Lehrbuch hinsichtlich der Gliederung von den meisten Lehrbüchern der Persönlichkeitspsychologie, aber auch benachbarter Fachdisziplinen ab: Die Kapitel 2 bis 8 sind nicht nach vorherrschenden theoretischen Ansätzen (Schulen) oder Forschungsthemen geordnet, sondern systematisch nach Merkmals- bzw. Prozessebenen, denen sich die aktuellen Forschungsthemen zuordnen lassen. Diese Ebenen entsprechen den allseits akzeptierten persönlichkeitspsychologischen Grundbegriffen: Gewohnheiten, Aktivierung und Temperament, Anreize und Affekte, Stressbewältigung und Affektregulation, Bedürfnisse und Motive, Ziele und Selbststeuerung. Diese |14|Aufteilung spiegelt zugleich ein sich derzeit verstärkt etablierendes Selbstverständnis der Persönlichkeitspsychologie wider, nach welchem sich Persönlichkeit als die für das Individuum typische Art und Weise beschreiben lässt, wie das Zusammenwirken der verschiedenen Prozessebenen das Erleben und Handeln steuert (Kuhl, 2001; Quirin et al., 2020; ähnlich Wilt & Revelle, 2015; s. bereits Allport, 1961).
Eine solche systematische Gliederung ist heute möglich, weil die Persönlichkeits-, ebenso wie die Motivations- und Emotionsforschung und ihre Nachbardisziplinen einen Stand erreicht haben, der die Einordnung der verschiedenen Theorien und Denkschulen in ein umfassendes taxonomisches System unterstützt. Zwar ist keiner der behandelten theoretischen oder empirischen Ansätze exklusiv nur einer Prozessebene (bzw. „Systemebene“) zuzuordnen. Es lassen sich aber deutliche Unterschiede darin feststellen, welche Prozessebenen in den verschiedenen Ansätzen besonders akzentuiert und ausgearbeitet werden. Das abschließende Kapitel (Kapitel 9) behandelt dann theoretische und empirische Entwicklungen, die das Zusammenwirken verschiedener Prozessebenen beleuchten, das in den anderen Kapiteln nicht behandelt wird.
Der erste Teil jedes der Kapitel zu den sieben Ebenen behandelt theoretische Ansätze aus der Geschichte der Persönlichkeits- wie auch der Motivations- und Emotionstheorien, die für das Verständnis des heutigen Forschungsstandes wichtig sind. So haben u. a. die behavioristischen Theorien und Forschungsarbeiten manche Funktionsweisen elementarer kognitiver Systeme vorweggenommen, die erst später eingehend (z. B. mit kognitiven und neurowissenschaftlichen Methoden) untersucht werden konnten und aufgrund ihrer individuell unterschiedlichen Reaktivität und Vernetzung eine große Rolle für die Persönlichkeitspsychologie spielen. Ähnlich haben frühe, bereits mathematisch formalisierte Modelle des Verhaltens (Atkinson & Birch, 1970; Hull, 1943; Lewin, 1935) den Grundstein für aktuelle persönlichkeitsdynamische Modelle gelegt (z. B. Kuhl, 2000a; Kuhl et al., 2021; Rauthmann, 2020; Read, Droutman & Miller, 2017; Revelle & Condon, 2015).
Im zweiten Teil jedes Kapitels wird der empirische Forschungsstand dargestellt. Dabei geht es nicht um eine detaillierte Auflistung aller relevanten Untersuchungen, sondern um eine Auswahl einiger Untersuchungen, die besonders wichtige Erkenntnisse veranschaulichen. Mitunter wurden auch ältere Untersuchungen ausgewählt, die eine theoretisch wichtige Frage behandeln, ohne dass sie einen Bezug zu einem aktuellen Modethema aufweisen müssen. Als Auswahlkriterium galt somit nicht die Jahreszahl der Veröffentlichung, sondern die inhaltliche, methodische und historische Bedeutung eines Befundes (nicht zuletzt, weil gerade die Beschreibung von Pionierarbeiten didaktisch oft hilfreich ist und viele neuere Arbeiten sich ohnehin durch Replikationen erst bewähren müssen). Wir sehen gerade heutzutage die Vernetzung neuerer Forschung mit historisch gewachse|15|nen Theorien und ihren Forschungsergebnissen als Voraussetzung wissenschaftlichen Fortschritts an.
Eingehender wurden vor allem solche empirischen Arbeiten dargestellt, die theoretisch bedeutsame Annahmen oder wichtige experimentelle Methoden veranschaulichen und auf ihre Brauchbarkeit prüfen. Neuere Arbeiten, deren Aussagekraft noch nicht den für ein Lehrbuch relevanten Status erreicht haben, werden ohne ausführliche Darstellung zitiert, um Anregungen für die Vertiefung des betreffenden Themas zu geben (z. B. für die Vorbereitung von Referaten).
Didaktisches Konzept, Lernziele und Lerntipps
Auch wenn es für Leser:innen etwas ungewohnt sein mag, die die klassische Lehrbucheinteilung nach Forschungsthemen, Perspektiven oder Schulen gewohnt sind, so hat die hier vorgenommene Systematik für den Lernenden den Vorteil, dass die Lerninhalte in eine begriffliche Struktur eingeordnet und dadurch besser behalten, vor allem aber stärker miteinander vernetzt werden können. Der Lernvorteil einer solchen Einordnung bleibt auch dann erhalten (oder nimmt sogar noch zu), wenn man sich später kritisch mit der Frage auseinandersetzt, ob denn im einzelnen Fall nicht auch andere funktionale Orte innerhalb der Ebenentaxonomie relevant sind. Psychologische Perspektiven („Paradigmen“) und klassische Theorien werden den jeweils passenden Prozessebenen zugeordnet, was Studierende dabei unterstützen soll, aktuelle Forschungsthemen und -ergebnisse mit klassischen Theorien zu verknüpfen und das für den späteren Berufsalltag wichtige Verständnis von Persönlichkeit und ihren Prozessen zu erlangen. Zugleich hat diese Systematik den Vorteil, dass historische Ansätze mit neueren Befunden verknüpft werden können. So werden Studierende immer wieder eingeladen, Beziehungen zwischen den theoretischen Ansätzen und den Forschungsbefunden eines Kapitels zu reflektieren und sich eine zunehmend vernetzte Wissensstruktur als Grundlage für Beruf und Leben zu erarbeiten. Aus verschiedenen Anwendungskontexten wissen wir, dass sich die dynamische Persönlichkeitspsychologie besonders gut für die individualisierte Optimierung psychologischer Interventionen in Beratung, Coaching und Therapie eignet (vgl. Kuhl, Quirin & Koole, 2021).
Dieses Buch unterstützt die folgenden Lernziele: Studierende sollten sowohl wesentliche historische und aktuelle Ansätze als auch Methoden und Forschungsergebnisse prozessorientierter Persönlichkeitsmodelle wiedergeben können und ihre Anwendbarkeit in Beruf und Alltag erkennen. Sie sollten in der Lage sein, Gemeinsamkeiten und Unterschiede verschiedener Theorien und Methoden zu erläutern. Wissenschaftliche Konzepte aus Persönlichkeits- und Motivationspsycho|16|logie werden nach erfolgreichem Durcharbeiten der Lektüre angemessen auf alltagsrelevante Phänomene bezogen. Des Weiteren lernen sie Persönlichkeits- und Motivationstheorien hinsichtlich ihrer Elemente, Prozesse und Funktionen zu analysieren. Von dem Angebot an Studien profitieren Studierende umso mehr, je aktiver sie sich mit den Befunden auseinandersetzen: Wer selbstständig Übersichtstabellen der besonders wichtigen Befunde anlegt, lernt, die zeitgleich in den Methodenveranstaltungen vermittelten Vorgehensweisen im Rahmen der Persönlichkeitsforschung zu analysieren und die jeweiligen Studien hinsichtlich ihrer Methodik besser zu verstehen. Eine solche Befundtabelle könnte z. B. fünf Spalten enthalten, je eine für Autorennamen, für unabhängige, abhängige Variablen, für Befunde und für die Interpretation. Hier dürfen durchaus auch subjektive Kriterien bei der Akzentuierung oder beim Weglassen angewendet werden.
Darüber hinaus ermutigen wir immer wieder zu üben, schwierige Stellen „auszuhalten“ und Unverstandenes zu markieren, sodass es bei der späteren Bearbeitung in einer Vertiefungsveranstaltung rasch aufgefunden werden kann. Die Konfrontation mit nicht sofort verstehbarem Stoff und das Sammeln von „Fragezeichen“ (d. h. Fragen, die aufgrund des eigenen Wissensstandes oder aufgrund des aktuellen Forschungsstands noch gar nicht beantwortet werden können) erscheint uns für ein akademisches Studium mindestens so wichtig wie das Auswendiglernen einfacher Begriffe und Befunde: Erschwernisse beim Verstehen und Erklären persönlichkeitspsychologischer Phänomene und die zeitlich oft durchaus verzögerte Überwindung dieser Schwierigkeiten bilden letztlich die Grundlage für die „persönliche“ Auseinandersetzung mit dem Stoff. Diese Auseinandersetzung ist für die spätere Anwendung des Wissens in der psychologischen Praxis wichtiger, als es für Berufe gilt, die weniger direkt in die persönliche Entwicklung von Menschen eingreifen.
Um den Transfer in die Praxis anzuregen, werden in jedem Kapitel und am Ende des Lehrbuchs Reflexions- und Übungsaufgaben vorgeschlagen, die dazu dienen, den Lerninhalt des Kapitels mit dem anderer Kapitel und mit relevanten Themen im Alltag zu verknüpfen (z. B. die in dem jeweiligen Kapitel behandelten Persönlichkeitsmerkmale mithilfe einfacher Fragen bei sich und anderen Personen zu beurteilen). Sie sollen vor allem den höheren Lernzielen der Bloom’schen (1972) Taxonomie gerecht werden, die sich auf das Analysieren, kreative Synthetisieren und Beurteilen des Lerninhalts beziehen. Im letzten Kapitel werden wesentliche Lerninhalte mit einer Fallbesprechung verbunden, in der veranschaulicht wird, wie eine ebenenübergreifende Diagnostik von Persönlichkeitsfunktionen heute in Beratung, Coaching oder Psychotherapie eingesetzt werden kann.
Zu allen Kapiteln wurden Foliensammlungen für Lehrveranstaltungen erstellt, die nach persönlicher Kontaktaufnahme mit den Autoren ([email protected] oder [email protected]) gerne zur Verfügung gestellt werden können. Über Anregungen (z. B. Vorschläge für Korrekturen, Ergänzungen, Streichungen etc.) freuen wir uns.
|17|Sechs goldene Regeln – Tipps zum Arbeiten mit dem Lehrbuch
Beispiele merken: In diesem Lehrbuch werden einige Studien ausführlicher behandelt. Dadurch soll das Lernen und Behalten erleichtert werden (und auch die spätere Anwendung auf andere Zusammenhänge), wenn man sich konkrete Beispiele für Instruktionen, Materialien (z. B. verwendete Reize) und vor allem Items der verwendeten Fragebögen merkt: Später (z. B. in Prüfungen) ist das Allgemeine für viele leichter aus dem Konkreten ableitbar als umgekehrt (wer sich nur einprägt, dass ein Experiment eine Wechselwirkung zwischen Tageszeit, Extraversion und Aktivierung zeigte, wird später nicht mehr sagen können, wie diese Wechselwirkung aussah).
Unabhängige und abhängige Variablen identifizieren: In psychologischen Lehrbüchern müssen empirische Ergebnisse aus Platzgründen oft sehr knapp dargestellt werden; deshalb ist es wichtig, sich bei jedem Hinweis auf einen Befund klarzumachen, was die unabhängige und die abhängige Variable waren.
Theoretische und praktische Bedeutung der Befunde: In der Prüfung passiert es oft, dass man auf einen Befund, nach dem gefragt wird, nicht kommt. Man kann das Behalten und Wiederauffinden erheblich verbessern, wenn man sich beim Lernen „vernetzende“ Fragen stellt, z. B.: Welche theoretische Annahme oder Hypothese wird durch diesen Befund bestätigt (oder auch nicht)? Wo könnte man den Befund im Alltag anwenden: Welche Alltagsphänomene lassen sich mit dem Befund in Verbindung bringen? Wenn man das Wichtigste aus einem Kapitel aufschreibt (oder im Text anstreicht), ist es nützlich, Stichwörter hervorzuheben (oder zu ergänzen), die später beim Wiederholen als Abfragehilfen genutzt werden können: Wenn man z. B. „motorische Aktivierung“ unterstreicht, kann man es später als Abfrage nutzen (kann ich noch, ohne schon in den Text zu schauen, sagen, was motorische Aktivierung ist, und welches Experiment zeigt, wie sie sich auswirkt?).
Vernetzung mit anderen Befunden oder Theorien: Besonders schwierig, aber für das Behalten und Anwenden des Gelernten sehr nützlich, ist die Frage: Mit welchen anderen Theorien oder Befunden lässt sich das Gelernte verbinden? Hier lohnt es sich, wenn man sich ab und zu mal Zeit nimmt, innehält und sich bereits gelernte Befunde oder Theorien anschaut. Wenn in der Lehrveranstaltung Querverweise auf andere Befunde oder Theorien genannt werden, sollte man sie sich unbedingt notieren, um sie in Ruhe noch einmal überdenken zu können. Immer wenn in diesem Lehrbuch solche Querverweise auf frühere Kapitel gegeben werden, lohnt es sich, dort noch einmal nachzusehen: An diesen Stellen gibt es jedes Mal eine konkrete Chance, etwas früher Gelerntes zu rekapitulieren und mit etwas Neuem zu vernetzen (Vorwärtsverweise braucht man – zumindest beim ersten Lesen des Lehrbuchs – nicht überprüfen: Sie sollen zunächst nur darauf hinweisen, dass ein Thema später noch ausführlicher behandelt wird).
Befundlisten: Wenn es Ihnen schwerfällt, die vielen Befunde eines Forschungsbereichs zu behalten, machen Sie sich eine Liste, in der Sie die wichtigsten Befunde stichwortartig aufführen (am besten mit den Autoren und der Jahreszahl dahinter: als Gedächtnisstütze und Verknüpfungshilfe, falls dieselben Autoren |18|später noch einmal mit anderen Arbeiten zitiert werden). Beispiele für solche Listen finden Sie in Abschnitt 3.2.2 und Abschnitt 4.3.2. Je besser Sie die Befunde Ihrer Liste nach inhaltlichen Gesichtspunkten ordnen, desto besser können Sie sie behalten und nachher in unterschiedlichen Zusammenhängen abrufen.
Lerngruppen können sehr hilfreich sein, wenn man sie richtig organisiert: Man profitiert umso mehr von der Gruppenarbeit, je mehr man sich vor jedem Treffen erst einmal selbstständig mit dem Stoff auseinandersetzt und sich notiert, welche Dinge man nicht verstanden hat. Wer anderen in der Gruppe bestimmte Zusammenhänge erklärt, profitiert auch: Der Stoff wird vertieft und oft erschließen sich dann auch zusätzliche Beispiele oder Verknüpfungen zwischen verschiedenen Lerninhalten.
Danksagung
Für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Lehrbuches, das auf Extraktionen, Restrukturierungen und Aktualisierungen der Inhalte des Lehrbuchs von Kuhl (2010) basiert, möchten wir vor allem Elias Arens und Victoria Stobe, aber auch Nadine Andres und Mara-Louise Vogt ganz herzlich danken, sowie allen, die bereits die Erstellung des Lehrbuchs von Kuhl (2010) unterstützten und dort bereits erwähnt wurden.
Osnabrück und München, im März 2024
Julius Kuhl
Markus Quirin
|19|Kapitel 1Einführung: Wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen
|20|In diesem Lehrbuch geht es um die Grundlagen des Erlebens und Verhaltens. Die Persönlichkeitspsychologie untersucht alle Prozesse, die das Erleben und Verhalten bestimmen, aus einer „ganzheitlichen“ Perspektive. Ganzheitlichkeit war in der Vergangenheit meist mit einer eher intuitiven Betrachtung verbunden, die sich der wissenschaftlichen Analyse weitgehend entzog. Heute kann dieser Begriff mit einer systemtheoretischen Position verknüpft werden: Die Systemtheorie analysiert alle wichtigen Prozesse ihres Gegenstandsbereichs als Ganzes. Erst durch die ganzheitliche Betrachtung ist es möglich, die Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Prozessen ins Blickfeld zu rücken. In der prozessorientierten Persönlichkeitspsychologie (Persönlichkeitsdynamik) geht es vor allem um das Zusammenspiel von Kognition, Emotion, Motivation und Volition (Kuhl, 2001; Quirin et al., 2020). In diesem Kapitel werden einige methodische Grundlagen behandelt, die für eine ganzheitliche Betrachtung der Persönlichkeit besonders relevant sind. Dazu gehören vor allem diejenigen Grundkonzepte der Statistik, der Versuchsplanung und der Neurobiologie, die für die Persönlichkeitspsychologie von Bedeutung sind. Zunächst geht es aber darum, die Begriffe für diejenigen Prozesse zu definieren, deren Zusammenspiel die „Persönlichkeit“ eines Menschen ausmacht.
Begriffsklärung: Kognition, Emotion, Motivation, Persönlichkeit
Mit dem Begriff Kognition werden alle Prozesse zusammengefasst, die dem „Erkennen“ im weiteren Sinne dienen, also der Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Wissen über die Außen- und Innenwelt (z. B. Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Denken). Emotionen sind erlebniszentrierte Antworten des Organismus, die die Relevanz eines Erkenntnisgegenstandes für die Befriedigung von Bedürfnissen widerspiegeln (z. B. nach den Kriterien „förderlich“ oder „hinderlich“) und verschiedene kognitive und motivationale Systeme im Sinne einer optimalen Bedürfnisbefriedigung aktivieren oder hemmen. Der Begriff der Motivation fasst Prozesse zusammen, welche an der Vorbereitung und Durchführung von Handlungen beteiligt sind, die Bedürfnisse befriedigen oder ihre Frustration vermeiden sollen. Der Begriff Persönlichkeit beschreibt charakteristische Formen des Zusammenspiels von kognitiven, emotionalen und motivationalen Prozessen. Die Differentielle Psychologie untersucht individuelle Unterschiede in kognitiven, emotionalen oder motivationalen Prozessen, die für die Persönlichkeit relevant sind.
Im Unterschied zu anderen psychologischen Grundlagenfächern betrachtet eine systematisch gegliederte Persönlichkeitspsychologie Kognition, Motivation und Emotion nicht separat, sondern in ihrem Zusammenwirken auf verschiedenen Prozessebenen. Wer erfahren will, was das heißt, kann z. B. damit beginnen, eine persönliche Frage „systemtheoretisch“ zu beantworten. Warum interessiert mich die Psychologie? Was interessiert mich an der Persönlichkeits- oder an der Motivations- und Emotionspsychologie? Das Besondere an der systemtheoretischen Bearbeitung solcher Fragen liegt darin, dass nicht die eine richtige Antwort gesucht wird, sondern dass von vornherein der Blick für mehrere potenzielle Einflussgrößen geweitet wird. Diese Einflüsse können von mehreren Ebenen des Sys|21|tems „Mensch“ herrühren. Haben Gewohnheiten eine Rolle bei der Wahl des Studienfaches gespielt (z. B. wenn sich jemand schon immer viel Gedanken über sich selbst oder andere gemacht hat)? Oder hat sich jemand für das Studium aus einer momentanen Laune heraus entschieden (z. B. weil andere es auch machten oder einem gerade nichts anderes einfiel)? Sieht man in der Beschäftigung mit dem Innenleben der Menschen einen besonderen Anreiz? Verspricht man sich von diesem Studium Fortschritte bei der Bewältigung eigener leidvoller Erfahrungen? Spielen persönliche Motive eine Rolle (z. B. Beziehungsmotive oder das Motiv, Macht über andere Menschen ausüben zu können)? Auch persönliche Ziele können die Grundlage der Studienwahl sein (z. B. das Ziel, die Praxis der Mutter übernehmen zu können, oder ein ganzes Netzwerk von persönlichen Zielen, das insgesamt ein Gefühl von Sinn vermittelt). Schließlich kann die Wahl eines Studienfachs auch als umfassender Akt der „Selbstbestimmung“ erlebt werden, was meist bedeutet, dass mehrere (oder sogar alle) der genannten Motivationsquellen eine Rolle spielen.
1.1 Sieben Quellen von Motivation und Emotion
Motivation und Emotion bestimmen unser Leben. Wir brauchen im Alltag nicht zu erklären, was diese Begriffe bedeuten. Wenn man sich Alltagsbegriffen wissenschaftlich nähert, beginnt man jedoch wieder ganz neu zu fragen: Was genau ist mit Motivation und Emotion gemeint? Aus der Alltagsperspektive ist es gar nicht leicht, sich vorzustellen, wie schwer es Psychologen gefallen ist, Motivation und Emotion überhaupt als wissenschaftlich relevante Begriffe zu akzeptieren. Als man vor fast hundert Jahren begann, die naturwissenschaftlich orientierte Psychologie auch in den USA zu etablieren, meinte man den Übergang von der Alltagspsychologie zu einer experimentellen Wissenschaft von der Psyche nur erreichen zu können, indem man die Selbstwahrnehmung aus der Wissenschaft ausschloss. Naturwissenschaftlich kann die Psychologie nur werden – so glaubte man –, wenn sie sich auf das Messen des objektiv beobachtbaren Verhaltens beschränkt und die subjektive Erfahrung außen vor lässt. Nach dem englischen Wort für Verhalten wurde diese Bewegung Behaviorismus genannt. Der Behaviorismus prägt auch heute noch die naturwissenschaftlich orientierte Psychologie, wenn auch in der abgeschwächten Form des methodologischenBehaviorismus.
Begriffsklärung: Methodologischer Behaviorismus
Der methodologische Behaviorismus lässt im Unterschied zum radikalen Behaviorismus theoretische Begriffe (z. B. hypothetische Konstrukte wie Kognition und Emotion) zu, aber eigentlich nur, wenn sie möglichst direkt operationalisierbar sind, d. h. an Messoperationen verankert werden können.
|22|1.1.1 Behaviorismus: Was man nicht messen kann, gibt es nicht?
Die behavioristische Vergangenheit der Psychologie hat die Entwicklung der Persönlichkeitspsychologie stark beeinflusst. Anfangs wollten Behavioristen gar keine inneren Zustände als wissenschaftlich brauchbare Begriffe zulassen, also auch keine Gefühle und schon gar nicht Motivation. Kognitive Prozesse wurden als erste wieder zugelassen: Das Ergebnis von Wahrnehmungs-, Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozessen kann man direkt an entsprechenden Leistungen beobachten, z. B. ob eine Versuchsperson ein Wort nennen kann, das für einige Millisekunden gezeigt wurde, oder einige Wörter erinnern kann, die vorher vorgesprochen wurden oder auswendig zu lernen waren. Aber wie kann man Motivation und Emotion beobachten? Auf den ersten Blick mag das leicht erscheinen: Ich sehe doch schon am Mienenspiel und vielen anderen Ausdrucksformen, ob jemand sich freut oder traurig ist. Und ob ein Schüler motiviert ist, kann man doch schon daran erkennen, ob er Ausdauer zeigt und sich anstrengt. Aber sind das eigenständige Prozesse? Oder handelt es sich eigentlich auch nur um kognitive Prozesse, die wir in unserer naiven Alltagspsychologie anders benennen? Um solche Fragen zu beantworten, ist es notwendig, den Begriff der Kognition etwas näher zu bestimmen, um ihn von den Begriffen Motivation und Emotion noch genauer abgrenzen zu können.
Begriffsklärung: Repräsentation und Kognition
Eine Repräsentation ist eine Abbildung, die eine eindeutige Beziehung zum Abgebildeten aufweist. Alle Prozesse der Repräsentation (des „sich Vergegenwärtigens“) von Information (Wahrnehmung, Gedächtnis, Aufmerksamkeit) lassen sich unter Kognition fassen.
Zwar sind auch Affekte und Emotionen ähnlich wie Kognitionen Informationen (z. B. über einen Bedürfniszustand oder über Bedürfnisrelevantes in der Außenwelt), aber es gibt keinen Konsens darüber, dass die Relation zwischen Affekten und ihren Auslösezuständen so eindeutig sind, dass sie „wahr“ oder „falsch“ sein können, wie es das Eindeutigkeitskriterium von Repräsentationen verlangt. Auch der Begriff Motivation setzt nicht immer eine Repräsentation voraus, sondern fasst eine Vielzahl von Prozessen zusammen, die an der Energetisierung und Richtungsgebung von Verhalten beteiligt sind. Heute ist, nicht zuletzt durch die Fortschritte der vergleichenden Tierforschung und der Neurobiologie, eine alte These bestätigt worden: Affektive und motivationale Prozesse können Verhalten auch unabhängig von Kognitionen (z. B. Gedanken, Überzeugungen, Zielen) energetisieren oder blockieren (Panksepp, 1998).
|23|Als mit der Gründung einer angesehenen kognitionspsychologischen Fachzeitschrift vor über 40 Jahren darüber nachgedacht wurde, was denn die zentralen Begriffe dieser Wissenschaft seien, drückte ein weltbekannter Kognitionspsychologe das aus, was viele seiner Kolleginnen und Kollegen dachten: Der Begriff der Motivation bezeichnet ein wichtiges Phänomen, aber er ist ein abgeleiteter Begriff. Wenn ich wissen will, ob jemand motiviert ist, dann reicht es vollkommen aus, nur kognitive Zustände zu untersuchen. Ich brauche dann lediglich zu wissen, welche Ziele diese Person hat und wie viel Aufmerksamkeit sie diesen Zielen widmet (Norman, 1980).
Begriffsklärung: Ziele, Aufmerksamkeit
Ziele sind kognitive Repräsentationen angestrebter Handlungsergebnisse, während der Begriff Aufmerksamkeit eine besondere Form der Intensivierung (Aktivierung) kognitiver Repräsentationen bezeichnet.
Der Nachweis von verhaltensbahnenden Prozessen, die nicht mit kognitiven (erkenntnisrepräsentierenden) Vorgängen identisch sind, wird heute durch die Neurobiologie erheblich erleichtert: Im Gehirn gibt es z. T. lokalisierbare Fühler für Motivationszustände („Bedürfnisse“), die definiert werden können als Diskrepanzen zwischen eingespeicherten Sollwerten und registrierten Istwerten (z. B. Blutzuckerspiegel oder ein neurochemisches Korrelat erfahrener zwischenmenschlicher Nähe). Auch an den Emotionen sind neurochemische Prozesse beteiligt, die keine Erkenntnisse („Repräsentationen“) im kognitionspsychologischen Sinn vermitteln, die aber die für bestimmte Situationen notwendigen psychischen Systeme zusammenschalten können.
Begriffsklärung: Emotion und Motivation
Die Begriffe Emotion und Motivation sind mit kognitiven Prozessen wechselseitig verflochten (Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis). Emotion und Motivation bezeichnen dennoch von Kognition abgrenzbare Prozesse der Registrierung (subkognitiver) Bedürfnisse (Motivation), der bedürfnisorientierten Bewertung von Ereignissen (Emotionen) und der Vorbereitung und Durchführung des Handelns auf unterschiedlichen Ebenen der Verhaltensbahnung (Motivation). Die Eigenständigkeit dieser Prozesse wird heute besonders durch die Neurobiologie aufzeigbar: Transmitter und Neuromodulatoren aktivieren und verschalten handlungsvorbereitende Systeme. Dies ist eher ein affektiver als ein kognitiver Prozess.
Man kann heute durchaus auch über Nachteile des methodologischen Behaviorismus nachdenken (z. B. den Verlust der theoretischen Kultur in der Psychologie oder die Aversion gegenüber komplexen Zusammenhängen, die natürlich gerade bei einem so komplexen System wie dem Menschen fatale Folgen haben kann). Man kann andererseits aber auch die methodologischen Forderungen als eine spannende Herausforderung betrachten, Methoden zu entwickeln, die zwischen kognitiven und |24|nichtkognitiven Quellen der Motivation zu unterscheiden gestatten. Übertreibt man den methodologischen Behaviorismus, dann sind diese Forderungen allerdings problematisch, weil er die Suche nach solchen Methoden dadurch behindert, dass er das noch nicht Messbare auch als theoretisches Konstrukt diskreditiert und so tut, als gäbe es etwas gar nicht, nur weil es noch nicht messbar ist.
1.1.2 Brauchen Motivation und Emotion eine Persönlichkeit?
Ein erster Schritt, der die Suche nach Unterscheidungsmöglichkeiten kognitiver und nicht kognitiver Quellen von Motivation und Emotion erleichtern kann, ist die Alltagspsychologie. Im Alltag betrachten wir oft alle psychologischen Begriffe, die wir verwenden, aus einer ganzheitlichen Perspektive. Wie bereits erwähnt heißt ganzheitlich, dass wir die ganze Person im Blick haben: Die Begriffe Motivation und Emotion können je nach Situation immer wieder etwas anderes bedeuten. Hier liegt der Grund, warum es sinnvoll erscheint, Motivation und Emotion mit dem Begriff der Persönlichkeit zu verbinden: Mit diesem Begriff kann man die Gesamtheit psychischer Prozesse bezeichnen, die das Erleben und Handeln einer „Person“ bestimmen. Damit ist mehr gemeint als die persönlichkeitspsychologische Tradition, Persönlichkeit durch Eigenschaften (traits) zu beschreiben (s. Kap. 3.1.2): Motivation und Emotion können aus ganz unterschiedlichen Quellen der Person gespeist werden. Deshalb hatte Kurt Lewin (1935), der als Begründer der experimentellen Motivationspsychologie angesehen werden kann, diese Begriffe auch ganz eng mit dem Begriff der Persönlichkeit verknüpft.
Wenn wir im Alltag die ganze Person im Blick haben, dann unterscheiden wir intuitiv aus dem Kontext heraus, welche Bedeutung von Motivation bzw. Emotion gerade gemeint ist. In der wissenschaftlichen Analyse von Motivation und Emotion lassen sich sieben Bereiche oder auch Ebenen erkennen, die unterschiedlichen Auffassungen und Konzeptionen von Motivation und Emotion folgen. Diese verschiedenen Auffassungen haben unterschiedliche Forschungsprogramme angeregt, die relativ unverbunden nebeneinanderstehen. Im folgenden Kasten sind anhand eines Beispiels in Klammern immer die Bereiche der Persönlichkeit genannt, aus denen Motivation und Emotion jeweils gespeist werden.
Übersicht Persönlichkeitsebenen: Quellen des Erlebens und Verhaltens
Die Gefühle und die Motivation einer engagierten Schülerin können aus ganz verschiedenen Quellen gespeist werden. Wie stark sie motiviert ist und welche Gefühle sie in Bezug auf das Lernen hat, kann davon abhängen, dass sie …
stets gewissenhaft ihre Pflicht tut (Gewohnheitsbildung),
einfach ein Energiebündel voller Tatendrang ist (Temperament),
bestimmte Fächer besonders spannend findet (Anreizmotivation),
den Schulstress gut bewältigt (stärkende statt schwächende Stressreaktion),
|25|stark anspricht auf Situationen, in denen man die eigene Fähigkeit verbessern kann (emotional verankertes Leistungsmotiv),
viele Ziele und Handlungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Leistungssituationen gelernt hat (kognitiv elaboriertes Leistungsmotiv),
sich mit dem Lernen identifizieren und alle ihre kognitiven, emotionalen und motivationalen Ressourcen gut steuern kann (selbstgesteuertes Leistungsmotiv).
Damit sind verschiedene Ebenen der Gesamtpersönlichkeit angesprochen, die das Handeln beeinflussen können (angeordnet von den einfacheren zu den komplexeren).
Begriffsklärung: Gewohnheiten, Temperament, Stressbewältigung
Gewohnheiten sind einfache, automatisierte Verhaltensprogramme, die man sogar dann abspulen kann, wenn es keinen besonderen Spaß macht (das Zähneputzen am Morgen macht vielen Leuten auch dann keine Probleme, wenn sie mal keine besondere Lust dazu haben).
Mit Temperament bezeichnet man eine globale Quelle der Erregbarkeit (Sensibilität der Wahrnehmung) und Aktivierbarkeit (des Verhaltens), während die Anreizmotivation durch positive oder negative Affekte bestimmt ist, die mit spezifischen Objekten verknüpft sind (z. B. einem bestimmten Schulfach oder einer Zensur).
Stressbewältigung ist wichtig, weil dann, wenn sie nicht gelingt, die ersten drei Quellen von Motivation und Emotion so stark das Geschehen bestimmen, dass die drei komplexeren Ebenen kaum ins Spiel kommen können. Das ist z. B. der Fall, wenn man vor lauter Stress nur noch automatisierte Verhaltensprogramme abspulen kann, aber gar nicht mehr aus dem Überblick der Selbststeuerung heraus zu handeln vermag (z. B. wenn ein gestresster Manager sonntags automatisch den Weg zum Büro fährt, obwohl er doch eigentlich seine Freundin für eine Fahrt ins Blaue abholen wollte).
Die besondere Lernmotivation der oben erwähnten Schülerin kann auch aus komplexeren Motivationsquellen gespeist sein, die in der Persönlichkeits- und in der Motivationspsychologie mit dem Begriff der Motive beschrieben werden: Sie kann lernmotiviert sein und leistungsrelevante Emotionen wie Stolz über Erfolge bzw. Scham über Misserfolge erleben, weil sie schon früh in der Kindheit (vor dem Spracherwerb) den Reiz der selbstständigen Bewältigung (mittel-)schwerer Aufgaben erfahren hat (Ebene 5), oder weil sie später viele verbalisierbare Erfahrungen gemacht hat, die Mut machen, auch schwierige Situationen anzugehen (z. B. viele Handlungsmöglichkeiten aus dem Gedächtnis abrufen zu können: Ebene 6) oder auch weil sie in späteren Entwicklungsphasen Selbststeuerungskompetenzen gelernt hat (z. B. sich selbst Mut zu machen, wenn die Motivation für eine Aufgabe einmal nicht ausreicht und Gefühle von Lustlosigkeit oder Angst das Handeln lähmen: Ebene 7).
|26|Begriffsklärung: Motive
Motive sind überdauernde Persönlichkeitsmerkmale, die die Motivation beeinflussen, bestimmte Anreizbereiche wie Leistung, Anschluss (Beziehungen) oder Macht (Durchsetzen) aufzusuchen. Jedes Motiv enthält einen Bedürfniskern, der meldet, wie sehr der aktuelle Istwert vom Sollwert abweicht (z. B. wie viel sozialen Kontakt man braucht). Im Unterschied zu „reinen“ Bedürfnissen sind Motive mit Erfahrungswissen verknüpft, das für eine Vielzahl von Situationen kontextangemessene Handlungsmöglichkeiten anbietet.
Motive lassen sich nicht nur nach ihrer Thematik (z. B. Anschluss, Leistung, Macht), sondern auch nach ihrem Entwicklungsniveau differenzieren: Sie können auf einer ersten (früh in der Kindheit erworbenen) Ebene emotionale Erfahrungen mit der Befriedigung verschiedener Bedürfnisse aus präverbalen oder vorbegrifflichen Entwicklungsphasen integrieren (Ebene 5: emotional verankertes Motiv). Motive können auf einer zweiten Entwicklungsebene differenzierte, verbalisierbare kognitive Erkenntnisse über Möglichkeiten der Bedürfnisbefriedigung aus verbal vermittelten Erfahrungen darstellen (Ebene 6: kognitiv elaborierte Motive). Motive können auf einer dritten Entwicklungsstufe auch Befriedigungsmöglichkeiten anzeigen, die erst durch die Fähigkeit zur Selbstregulation ermöglicht werden (z. B. wenn eine Schülerin sich in eine bessere Stimmung bringt, weil sie weiß, dass sie dann besser lernen kann).
1.1.3 Sieben Gründe „faul“ zu sein
Der Blick auf das gesamte System der Persönlichkeit macht es möglich, die motivations- und emotionspsychologische Forschung und auch viele Konzepte aus der Kognitionspsychologie anhand einer theoretisch und empirisch begründbaren Systematik darzustellen: Jedes der folgenden Kapitel behandelt eine der sieben Prozessebenen. Diese Systematik der Persönlichkeit ist natürlich nicht neu. Sie lässt sich bis auf die Schriften der griechischen Philosophen der Antike zurückverfolgen. In der gut hundertjährigen Geschichte der naturwissenschaftlichen Psychologie ist sie aber ein wenig aus dem Blickfeld geraten. Das liegt daran, dass verschiedene Theorien der Motivation, Emotion und der Persönlichkeit nicht alle diese Ebenen gleichermaßen berücksichtigt haben, oft sogar auf nur eine Ebene zentriert sind. Die zunehmende Spezialisierung, die es in allen Naturwissenschaften gibt, hat die Aufteilung der Person auf unterschiedliche Forschungsbereiche weiter vorangetrieben. Die in diesem Lehrbuch verwendete Systematik soll dazu einladen, die (sieben) verschiedenen Ursachen für das Zustandekommen der jeweiligen kognitions-, motivations- und emotionspsychologischen Phänomene zu |27|beachten, statt sich voreilig auf eine Erklärungsmöglichkeit zu reduzieren. Im letzten Kapitel kann dann auch das versucht werden, was bei Aufteilung des Gesamtsystems der Persönlichkeit auf verschiedene Fächer, Schulen oder Forschungsbereiche immer zu kurz kommt: das Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Ebenen zu erkunden.
Dass die Zusammenschau verschiedener Einflussquellen nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch bedeutsam ist, soll das folgende Beispiel erläutern. Wenn es im Berufsalltag von Psychologinnen und Psychologen um die Beratung, das Coaching oder die Therapie von Klienten geht, ist es nützlich, sich nicht voreilig auf eine Verursachungsquelle festzulegen, etwa auf die, die in der Therapie- oder Denkschule, in der man ausgebildet ist, im Vordergrund steht. Der Klient kann die Ursachen seiner Symptome nicht so aussuchen, dass sie zu der von der Psychologin oder dem Psychologen bevorzugten Schule passt.
Übersicht: Konkreter Beratungsfall
Lehrer oder Eltern bezeichnen einen Schüler der 8. Klasse einer Gesamtschule als unmotiviert und „faul“. Woran kann es liegen? Worauf sollte die Beratung bzw. Therapie abzielen?
Gewohnheiten. Der Schüler hat zu wenig Gewohnheiten ausgebildet, die das Lernen unterstützen.
Temperament. Es fehlt ihm an allgemeiner Handlungsenergie.
Affekt. Bestimmte Anreizbedingungen (z. B. einzelne Lehrer oder Fächer) sind negativ oder nicht hinreichend positiv besetzt.
Stressbewältigung. Er ist chronisch gestresst (z. B. aufgrund frühkindlicher Traumatisierungen, einer schwierigen familiären Situation oder Konflikten in seiner Persönlichkeit), sodass er seine durchaus vorhandene Motivation und letztlich sein mögliches Talent nicht umsetzen kann.
Motive. Der Schüler hat klare Leistungsziele, sie sind aber nicht emotional unterfüttert, d. h. sein Leistungsmotiv ist schwach entwickelt (z. B. weil er in der frühen Kindheit wenig positive Erfahrungen mit dem selbstständigen Meistern von Schwierigkeiten gemacht hat).
Ziele. Der Schüler hat nicht gelernt, sich klare Ziele zu setzen, mit denen er sich identifizieren kann oder verfügt nicht über relevante Überzeugungen (z. B. über die eigenen Kompetenzen).
Selbststeuerung. Ihm fehlen Selbststeuerungskompetenzen (z. B. Misserfolge als Lernhilfe zu nutzen, statt sich von ihnen lähmen zu lassen).
Auch ohne in die Einzelheiten der sieben Ebenen der Persönlichkeit zu gehen, die erst in den folgenden sieben Kapiteln behandelt werden, ist es leicht einsehbar, dass alle Maßnahmen zur Diagnostik, Beratung und Therapie ganz unterschiedlich aussehen müssen, je nachdem welche Verursachungsebene im individuellen |28|Fall vorliegt. So sieht z. B. das Trainieren neuer Lerngewohnheiten (Ebene 1) ganz anders aus als ein Training, in dem Leistungsziele emotional (und sogar körperlich) verankert werden. Die Methoden zur Änderung von kognitiven Überzeugungen, die die Leistungsmotivation beeinträchtigen, sehen wiederum ganz anders aus als Methoden zur Verbesserung selbstregulatorischer Kompetenzen. Lerngewohnheiten (wie Ablenkungsquellen ausschalten, immer nur am Arbeitsplatz arbeiten, wenn möglich immer zur selben Tageszeit lernen) übt man z. B. durch eigene Verhaltensbeobachtung (Protokollschreiben) und Selbstbelohnung nach kleinen Fortschritten (z. B. verbal oder durch kleine Annehmlichkeiten). Bei der emotionalen und somatischen Verankerung von Leistungszielen geht man zuerst in eine Vorstellung, die positive Gefühle auslöst (z. B. die Freude an einer bestandenen Prüfung), und stellt sich dann ein Ziel vor. Oder man wählt die umgekehrte Reihenfolge: Man ruft zuerst ein Ziel in Erinnerung und geht dann in die Körperwahrnehmung, was bei einseitig rationalen Klienten unter Umständen erst gelernt werden muss.
1.2 Eigenschaft und Situation
In der Persönlichkeitspsychologie werden sowohl dispositionelle (d. h. personseitige) als auch situative Einflüsse und deren Wechselwirkung auf das Verhalten und Erleben untersucht. Ob eine Person beispielsweise den/die Ehepartner:in betrügt, hängt demnach nicht nur von situativen Einflüssen wie die Konfrontation mit verführerischen Angeboten, sondern auch von Persönlichkeitsmerkmalen der Person ab, etwa ob sie sich wohl fühlt in der Partnerschaft, was sie unter Beziehung versteht und auch davon, ob sie über gute Selbststeuerungskompetenzen verfügt. Ob eine Person gute Gefühle in ihrer Partnerschaft entwickelt, hängt nicht nur von situativen Einflüssen wie konkreten Tagesereignissen ab, sondern auch davon, ob sie mit sich selbst im Reinen ist, ob sie Bedürfnisse und Werte hat, die mit denen des Partners in Einklang zu bringen sind, ob sie eine starke oder eine schwache Bereitschaft hat, sich auf etwas zu freuen (z. B. Optimismus) u. v. m.
Die klassische Einteilung in eine Allgemeine und eine Differentielle Psychologie legt nahe, die Untersuchung situativer und dispositioneller Einflüsse zu trennen: Die Allgemeine Psychologie (wie auch die Sozialpsychologie) würde dann eher situative Einflüsse untersuchen, während die Erforschung dispositioneller Faktoren Gegenstand der Differentiellen Psychologie wäre. In persönlichkeits- und motivationspsychologischen Experimenten werden jedoch zunehmend situative und personbezogene Determinanten gleichzeitig untersucht, was oftmals die tatsächlichen Zusammenhänge angemessener abbildet. In den folgenden beiden Abschnitten geht es um einige wissenschaftstheoretische Erwägungen zum Umgang mit situativen und dispositionellen Einflussfaktoren.
|29|1.2.1 Individuelle Unterschiede und Persönlichkeit
In der experimentellen Psychologie ist die Bedeutung individueller Unterschiede umstritten. Deshalb erscheinen an dieser Stelle einige methodologische Überlegungen zu dem Umgang mit individuellen Unterschieden in der Psychologie angebracht. Individuelle Unterschiede werden in der Kognitionspsychologie und auch in weiten Teilen der Sozialpsychologie wenig berücksichtigt. Eine verbreitete sozialpsychologische Vorstellung ist, dass situative Einflüsse grundsätzlich leichter zu ändern seien als persönliche. Dem steht allerdings die Alltagserfahrung entgegen, dass viele Menschen täglich situativen Einflüssen ausgesetzt sind, die sich nicht immer leicht ändern lassen (z. B. eine kranke Mutter in der Familie, ein geringes Einkommen, eine marode Staatswirtschaft u. v. m.). Auch müssen Persönlichkeitsmerkmale (Dispositionen) nicht notwendig stabil und unveränderlich sein (Wrzus & Roberts, 2017).
Die in der Persönlichkeits- und Motivationspsychologie übliche kategoriale Einteilung bestimmter Tests in Trait- oder State-Maße (d. h. Tests, die Zustände oder Eigenschaften messen sollen) ist eigentlich fragwürdig: Jeder Test kann ebenso stabile und veränderliche Einflüsse messen (so wie ein Arzt bei der Messung eines erhöhten Blutdrucks damit rechnen muss, dass der Patient ein chronischer Hypertoniker ist oder dass er vielleicht gerade sportlich aktiv war). Manche Tests können zwar im Durchschnitt mehr durch variable, andere mehr durch stabile Faktoren beeinflusst werden. Das Ausmaß, in dem stabile oder variable, personseitige oder situationsabhängige Faktoren eine Rolle spielen, muss immer wieder neu bestimmt werden und kann weder für bestimmte Phänomene oder Personen noch für bestimmte Tests endgültig festgelegt werden.
Neben dem sozialpolitisch motivierten Unbehagen an Persönlichkeitskonzepten gibt es einen, noch tiefer verwurzelten, Grund für die Vernachlässigung dispositioneller Determinanten des Verhaltens. Dieser Grund betrifft das Missverständnis, die Suche nach allgemeinen Gesetzen, die natürlich für die Selbstdarstellung einer jungen experimentellen Wissenschaft wie der Psychologie von großer Bedeutung ist, würde behindert, wenn man von vorneherein zuließe, dass für verschiedene Personen verschiedene Gesetze gelten würden. Im Extremfall, d. h. wenn für jede Person idiosynkratische Gesetzmäßigkeiten zu ermitteln wären, würde eine allgemeine Psychologie nicht realisierbar sein. Die Aversion gegenüber diesem Risiko scheint immer noch durch die Thematik geprägt zu sein, die in den ersten Jahrzehnten der experimentellen Psychologie zu Beginn des vorigen Jahrhunderts die „Frühentwicklung“ unserer Wissenschaft behinderte: Die Anfänge der experimentellen Psychologie waren durch die enormen Schwierigkeiten geprägt, sich von der introspektiven „Seelenschau“ (Selbstbeobachtung) zu trennen, die man mit einer „Wissenschaft aus dem Lehnstuhl“ verband und die mit dem neuen Programm |30|einer experimentellen Psychologie unvereinbar erschien. Der bereits erwähnte Behaviorismus, der nur direkt und von außen Beobachtbares als Grundlage für die Entwicklung der wissenschaftlichen Psychologie zulassen wollte, war darauf aus, endlich allgemeine psychologische Gesetze zu entdecken, die von den Besonderheiten der individuellen Selbstbeobachtung befreit waren.
Der erwähnte Motivationspsychologe Kurt Lewin (1935) hatte bereits sehr ausführlich begründet, warum eine nach allgemeinen Gesetzen suchende (nomothetische) Psychologie nur bei Berücksichtigung individueller Besonderheiten eine Chance auf Erfolg hat. „Unliebsame“ potenzielle Einflussgrößen – wie Persönlichkeitsdispositionen, von denen man eine Beeinträchtigung der Allgemeingültigkeit von Gesetzen befürchtet – von vorneherein gar nicht erst zu messen, wäre demnach eigentlich keine wissenschaftliche Strategie, sondern ein parawissenschaftlicher Verleugnungsstil.
1.2.2 Gibt es stabile Persönlichkeitseigenschaften?
„Ich finde das zwar ganz spannend, dass du jetzt Psychologie studierst, aber der Test, den du mit meinem neuen Mitbewohner gemacht hast, kann wohl nicht viel taugen: Du sagst, er sei sehr leistungsmotiviert, aber auf der Party gestern war er der Einzige, der nur tanzen und nichts von seinem Studium erzählen wollte.“ Es kann sein, dass hier ein Psychologiestudent zu Recht kritisiert wird, weil er einen nicht validen Test angewendet hat.
Begriffsklärung: Valide
Valide wird ein Test genannt, wenn er wirklich das misst, was er messen soll.
Oft begegnet man jedoch der erwähnten Art von Kritik auch dann, wenn die Validität eines Tests gar nicht bezweifelt wird, sondern wenn man sich dagegen wehren will, dass Psychologen mit ihren Tests andere Menschen in Schubladen stecken. Jemandem eine starke Ausprägung irgendeines Persönlichkeitsmerkmals zuzuschreiben, bedeutet allerdings noch nicht, dass man ihn „in eine Schublade steckt“. Hier liegt häufig ein Missverständnis vor, das nicht nur bei psychologischen Laien vorkommt: Jemand kann sehr machtmotiviert sein, sehr gern essen oder sehr viel Freundlichkeit haben und trotzdem in vielen Situationen keine Machtmotivation, keine Lust zu essen bzw. keine besondere Freundlichkeit zeigen. Wenn es um Persönlichkeitsdispositionen geht, passiert uns im Alltag oft ein Denkfehler, den wir im Umgang mit der unbelebten Natur seit früher Kindheit schon überwunden haben: Wir vergessen, dass das Verhalten sowohl von (Persönlichkeits-)Dispositionen als auch von situativen Kräften abhängen kann, und |31|nicht selten erst eine situative Kraft die Disposition in Form eines bestimmten Verhaltens zum Ausdruck kommen lässt (z. B. dann leistungsmotiviert zu sein, wenn der Kontext dies anregt).
Wenn ein hoch machtmotivierter Mensch einmal sehr nachgiebig ist, dann hat er ebenso wenig seine Machtmotivation verloren, wie ein Stein sein Gewicht einbüßt, wenn ihn eine Studentin weiter wirft als ihr Mitbewohner (der z. B. weniger Kraft aufgewendet hat oder nicht so kräftig ist wie sie).
Wenn wir im Alltag z. B. von einem Menschen sehr unfreundlich behandelt werden, urteilen wir oft vorschnell: „Er ist ein unfreundlicher Mensch.“ Das muss natürlich nicht stimmen. Vielleicht ist seine Unfreundlichkeit auf die Situation zurückzuführen (er hat evtl. gerade etwas Unangenehmes erlebt). Dieser Effekt ist von Sozialpsychologen tatsächlich nachgewiesen worden: In der Fremdbeobachtung erklären wir das Verhalten anderer überwiegend mit Personmerkmalen, selbst dann, wenn es in Wirklichkeit durch die Situation verursacht wurde (z. B. wenn jemand unfreundlich ist, weil er gerade vorher durch den Versuchsleiter geärgert wurde). In der Selbstwahrnehmung ist es gerade umgekehrt: Hier sehen wir eher die situativen Ursachen des eigenen Verhaltens als den Einfluss unserer eigenen Persönlichkeitsmerkmale (Jones & Nisbett, 1971).
Der Persönlichkeitspsychologe Walter Mischel (1968) hatte diese Argumentation sogar noch verschärft, woraufhin die Existenz stabiler Persönlichkeitsmerkmale von manchen generell infrage gestellt wurde: Wenn es stimmt, dass Menschen im Alltag situative Einflüsse auf das Verhalten anderer übersehen, kann es dann nicht sein, dass Wissenschaftler (die auch nur Menschen sind) denselben Fehler machen, wenn sie Eigenschaften, Motive und andere stabile Persönlichkeitsdispositionen postulieren? Mischel hatte nach entsprechenden Daten gesucht und wurde fündig: Viele empirische Untersuchungen zeigen, dass sich Menschen je nach Situation sehr unterschiedlich verhalten. Vergleicht man (über unterschiedliche Situationen hinweg) Kennwerte für Verhalten, das durch eine stabile Persönlichkeitseigenschaft bestimmt sein soll (z. B. durch die Eigenschaft Ehrlichkeit, indem man prüft, wie stark Schüler, die in einem Schulfach abschreiben, das auch in einem anderen Fach tun), dann sind die Zusammenhänge oft sehr niedrig. Man findet Korrelationen unter 0,30.
Bereits Hartshorne und May (1928) hatten in einer klassischen Untersuchung festgestellt, dass eigenschaftsrelevantes Verhalten (wie z. B. Ehrlichkeit), das in unterschiedlichen Situationen (z. B. verschiedenen Klassenräumen) oder mit unterschiedlichen Verhaltensmerkmalen (z. B. beim Nachbarn abschreiben vs. Lügen) beobachtet wurde, sehr niedrige Korrelationen aufwies. Aus Tabelle 1 ist ersichtlich, dass Schüler, die bei einem Lehrer Anzeichen von Unehrlichkeit zeigten (z. B. vom Nachbarn abschrieben), nicht besonders häufig auch bei anderen Lehrern |32|unehrliches Verhalten oder andere Anzeichen für Unehrlichkeit (z. B. Geld stehlen) zeigten.
Tabelle 1: Korrelationen (bzw. Wiederholungsreliabilitäten in der Diagonalen) zwischen verschiedenen Kennwerten für die Eigenschaft Ehrlichkeit, die in unterschiedlichen Situationen bzw. Verhaltensmerkmalen erhoben wurden (nach Hartshorne & May, 1928)
Situation/Merkmal
1
2
3
4
5
6
7
8
Klassenzimmer 1
0,70
0,29
0,29
0,29
0,15
0,20
0,13
0,31
Klassenzimmer 2
0,44
0,22
0,26
0,14
0,19
0,13
0,25
Klassenzimmer 3
0,46
0,20
0,19
0,06
0,16
0,16
Klassenzimmer 4
0,50
–
0,18
0,22
0,21
Hausaufgaben
0,24
0,09
–0,01
0,40
Sport
0,46
0,16
0,00
Geld stehlen
–
0,13
Lügenskalen
0,84
Mischel (1968) zitiert viele Untersuchungen, die von niedrigen Korrelationen eigenschaftsrelevanten Verhaltens über verschiedene Situationen hinweg berichten. Aus dieser niedrigen transsituationalen Konsistenz eigenschaftsrelevanten Verhaltens zog er den Schluss, dass der Einfluss von Persönlichkeit auf Verhalten sehr gering ist. Manche haben aus solchen Befunden sogar abgeleitet, dass es keinen Sinn habe, situationsübergreifende Eigenschaften (oder Motive) in der Persönlichkeits- und Motivationspsychologie zu postulieren.
Die von Mischel über fast drei Jahrzehnte in Gang gehaltene Situationismusdebatte enthält einige Missverständnisse. Ihre Klärung ist für die Interpretation empirischer Untersuchungen in der Motivations-, Emotions- und Persönlichkeitspsychologie von allgemeiner Bedeutung. So ließe sich fragen, ob die Konzeptionalisierung von Persönlichkeitseigenschaften als situationsübergreifende Verhaltensmuster sinnvoll ist, oder besser: wie situationsübergreifend eine Persönlichkeitseigenschaft wirkt, also in welchen Situationen sich eine Eigenschaft ausdrückt und in welchen nicht. Wenn dem so ist, dann ist die Untersuchung des Einflusses von Persönlichkeit mittels bivariater Korrelationen methodisch nicht ausreichend. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns daher eine andere statistische Methode zur Untersuchung des Zusammenhangs von Persönlichkeit und Situation an, die Wechselwirkungen berücksichtigt.
|33|1.2.2.1 Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Person und Situation
Ob das beobachtbare Verhalten der Menschen von situativen Einflüssen oder von ihrer Persönlichkeit abhängt, lässt sich mithilfe multivariater Verfahren wie der mehrfaktoriellen Varianzanalyse untersuchen, wobei die Person einen Faktor und die Situation einen zweiten Faktor darstellt. Dies ermöglicht, dass neben den beiden Haupteffekten der Faktoren auch Wechselwirkungen zwischen ihnen analysiert werden können. Genaugenommen würden Personengruppen (z. B. Extravertierte) einen Faktor darstellen oder eine Persönlichkeitsdimension (z. B. Extraversion) als kontinuierliche Variable („General Linear Models“) in die Berechnung aufgenommen werden. Zur einfacheren Illustration betrachten wir jedoch nachfolgend einzelne Personen.
Auf die Frage, wovon das Verhalten abhängt, gäbe es dann prinzipiell vier mögliche Antworten:
nur von der Person (Haupteffekt 1)
nur von der Situation (Haupteffekt 2)
sowohl von der Person als auch von der Situation (z. B. additiver Effekt)
von der Wechselwirkung zwischen Person und Situation (z. B. multiplikativer Effekt).
Bei den ersten drei Antworten handelt es sich um sogenannte statistische Haupteffekte: Wenn es nur einen Haupteffekt der Personen gäbe, dann könnten die vier Geraden in Abbildung 1a dieselben Abstände haben, wären aber wegen des fehlenden Situationseinflusses parallel zur waagrechten Achse. Gäbe es dagegen nur einen Einfluss der Situation, dann würden alle vier Geraden in Abbildung 1a zusammenfallen. Die dritte Variante ist in Abbildung 1a dargestellt. Hier addieren sich die beiden Haupteffekte: Die freundlichste Person (s. Person 1 in Abbildung 1a) ist am allerfreundlichsten in Situation 1 (Kneipe), die bei allen Personen die größte Freundlichkeit auslöst (Abbildung 1a).
Die vierte Möglichkeit des Einflusses von Person und Situation auf das Verhalten besteht darin, dass sich der Situationseinfluss bei verschiedenen Personen unterschiedlich auswirkt. Dann spricht man von einer Wechselwirkung (Abbildung 1b): Während bei den Personen 1 und 4 dieselbe Rangfolge der Situationen bezüglich des Ausmaßes besteht, in dem sie Freundlichkeit hervorrufen, ist bei den Personen 2 und 3 die Rangfolge der Situationen anders: Grafisch kann man die Wechselwirkung schon daran erkennen, dass die Geraden für Personen 2 und 3 nicht parallel zu den anderen verlaufen. Das kann z. B. daran liegen, dass Person 3 in Abbildung 1b in der Bibliothek angestellt ist und deshalb zu allen Besuchern sehr freundlich ist und dass Person 2 sich so freut, endlich studieren zu dürfen, dass sie ihre Freundlichkeit am liebsten da zum Ausdruck bringt, wo sie mit anderen Studierenden zusammenkommt.
|34|
Abbildung 1: Darstellung der Situationsabhängigkeit (a, linkes Diagramm) und der Situationsspezifität (b, rechtes Diagramm) eigenschafts- oder motivrelevanten Verhaltens
Begriffsklärung: Wechselwirkung
Eine Wechselwirkung zwischen zwei Variablen A und B liegt vor, wenn die Wirkung einer Variablen vom Zustand der anderen Variablen abhängt, d. h. wenn die Wirkung einer Variablen nicht bei allen Ausprägungen der anderen Variablen dieselbe ist (Abbildung 1b). Grafisch drückt sich eine Wechselwirkung in einer Liniendarstellung darin aus, dass die Linien nicht parallel verlaufen (wenn sie sich, wie hier, sogar kreuzen, liegt eine disordinale Wechselwirkung vor).
Die Eigenschaft „Freundlichkeit“ ist im vierten Fall nicht nur situations- und personabhängig, sondern auch situationsspezifisch: Die Personen können auch im situationsspezifischen Fall durchaus stabile Ausprägungen dieser Eigenschaft haben, sie bringen sie nur in unterschiedlichen Situationen zum Ausdruck. Für die Situationismusdebatte ist dieses Phänomen der Situationsspezifität wichtig: Solche Wechselwirkungen zwischen Personen und Situationen (Abbildung 1b) führen nämlich zu geringen Korrelationen zwischen je zwei Situationen, wenn die individuellen Persönlichkeitsmerkmale nicht in die Berechnung miteinbezogen werden.
Begriffsklärung: Situationsspezifität
Situationsspezifität von Eigenschaften (oder Motiven) ist nicht nur ein Beispiel für eine Wechselwirkung (zwischen Person und Situation), sondern auch ein Beispiel dafür, dass man aus niedrigen Korrelationen nicht auf das Nichtvorhandensein stabiler Dispositionen schließen kann: Die Freundlichkeit der Person 3 (in Abbildung 1b) braucht nicht weniger stabil zu sein, nur weil sie sich bei ihr in einer im Vergleich zu anderen Person ungewöhnlichen („spezifischen“) Situation (Bibliothek) am meisten äußert.
|35|In den meisten Untersuchungen, die nach obigem Beispiel gestrickt sind, werden Personen in diesen Alltagssituationen spontan untersucht oder nach ihrem Verhalten in diesen Situationen gefragt. Seltener werden sie randomisiert solchen Situationen zugewiesen. Demnach handelt es sich um sogenannte quasi-experimentelle Studien: Die Individuen unterscheiden sich möglicherweise darin, wie oft oder ob sie überhaupt die entsprechenden Situationen von sich aus aufsuchen. Entsprechend lässt sich, anders als im Experiment, nicht ausschließen, dass der scheinbare Effekt der Situation letztlich auf den Einfluss der Person (bzw. ihrer Persönlichkeit) zurückzuführen ist. Einschränkend muss hinsichtlich dieser Forschung demnach angemerkt werden, dass der scheinbare Effekt der Situation eventuell doch auf die Personvariable zurückzuführen ist. Dies wäre bei randomisierter Zuweisung zu Situationen (z. B. einer experimentellen Stressinduktion versus Kontrollbedingung im Labor) nicht der Fall.
Studie:Kontingenz von Situationsmerkmalen und Persönlichkeitszuständen (Fleeson, 2007)
Im Fokus der Untersuchungen von Fleeson (2007) standen nicht Persönlichkeitseigenschaften (die üblicherweise mithilfe eines einzelnen Fragebogens erfasst werden und mit der Instruktion, sich im Allgemeinen oder über einen langen Zeitraum zu beschreiben), sondern sogenannte „Persönlichkeitszustände“. Doch was sind Persönlichkeitszustände? Dieser Begriff stellt eigentlich ein Oxymoron dar, weil Persönlichkeit schließlich etwas Überdauerndes meint. Dennoch verwendet Fleeson den Begriff, um (etwas provokativ) darauf hinzuweisen, dass Personen, die eine bestimmte Ausprägung einer Persönlichkeitseigenschaft im Fragebogen zeigen, über die Zeit in eigenschaftstypischem Erleben und Verhalten nichtsdestotrotz variieren, was ja bereits durch die besprochenen Begriffe der Situationsabhängigkeit und Situationsspezifität zum Ausdruck kommt. Nach Fleeson nehmen Personen trotz einer bestimmten Ausprägung in einer Persönlichkeitseigenschaft unterschiedliche „Persönlichkeitszustände“ an (z. B. mal introvertiert, mal extravertiert, oder mal neurotisch, mal emotional stabil). Persönlichkeit wäre dann, zumindest theoretisch, durch das mittlere Verhalten und Erleben einer Person über alle möglichen Momente hinweg beschreibbar. Selbst die Variabilität (Varianz) des Verhaltens um diesen Mittelwert herum ließe sich eventuell als Persönlichkeit auffassen – in anderen Worten: die Verteilung des gezeigten Verhaltens. In Kapitel 9 wird eine Theorie vorgestellt, die hinter persönlichkeitsrelevanten Zuständen eine Aktivierung entsprechender Persönlichkeitssysteme postuliert, die sich auch in bestimmter Weise auf der neuronalen Ebene ausdrückt (Theorie der Persönlichkeits-System-Interaktionen; Kuhl, 2000a, 2001; s. auch Quirin & Kuhl, 2022).
|36|Fleeson (2007) untersuchte nun, wie sehr bestimmte Persönlichkeitszustände von jeweils relevanten Situationsmerkmalen abhängen (z. B. Aufgabenorientierung, Freundlichkeit, Anonymität) und wie sehr diese Situationsabhängigkeit zwischen Personen variiert. Zeigen sich also gewissenhafte „Zustände“ (z. B. sorgfältiges Verhalten) vor allem in Situationen, in denen sie besonders benötigt werden (z. B. solche mit hoher Aufgabenorientierung)? Zeigt sich ein sozial verträglicher „Zustand“ insbesondere dann, wenn die Situation selbst (bzw. eine soziale Interaktion) als freundlich betitelt wird? Und wie sehr unterscheidet sich eine solche Situationsabhängigkeit zwischen Individuen? Es wurden also nicht Situationen nach Anlässen oder Orten klassifiziert (wie Party, Kneipe, Demo), sondern nach psychologisch relevanten Merkmalen, die das Potenzial haben, eine bestimmte psychische Reaktion oder ein Verhalten auszulösen (Aufforderungscharakter oder Affordanz). Das Ausmaß, in dem ein bestimmtes Situationsmerkmal einen Persönlichkeitszustand auslöst (oder vorsichtiger: mit ihm zusammenhängt), nennt Fleeson Kontingenz.
Die Teilnehmer:innen schätzten sich auf Zustandsskalen für Extraversion, soziale Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Neurotizismus ein (z. B. wie energetisch, höflich, verantwortungsvoll sie im Moment seien). Zudem bewerteten sie ihre aktuelle Situation hinsichtlich verschiedener Merkmale (z. B. task orientation, d. h. wie sehr eine Verpflichtung, Deadline und/oder eigenes Interesse vorlag). In Abbildung 2 sind die Ergebnisse für den Zustand der Gewissenhaftigkeit dargestellt (d. h. für gewissenhaftes Verhalten). Wie man erkennen kann, variiert das Ausmaß der Situationsabhängigkeit erheblich zwischen Personen (vgl. die unterschiedliche Steigungen der beiden Geraden in Abbildung 2): Während die Gewissenhaftigkeit von Personen mit hoher Situationsabhängigkeit (eine Standardabweichung oberhalb des Mittelwerts) fast ausschließlich von der Höhe der Aufgabenorientierung abhängt, so steigt für Personen mit niedriger Situationsabhängigkeit die Gewissenhaftigkeit (Zustand [State]) in dieser Situation mit zunehmender situativer „Anregung“ gewissenhaften Verhaltens kaum an. Der Autor leitet aus diesen und zusätzlichen Befunden ab, dass (a) Situationen bestimmte Aspekte beinhalten, die mit bestimmten eigenschaftstypischem Verhalten und Erleben einhergehen (oder diese gar auslösen), dass (b) diese Situationsabhängigkeit die hohe Verhaltensvariabilität innerhalb von Personen teilweise erklären kann, dass (c) die Situationsabhängigkeit hohen individuellen Unterschieden unterliegt, und (d) die relevanten Situationsaspekte für unterschiedliche Eigenschaften (wie Extraversion oder Gewissenhaftigkeit) unterschiedlich sind.