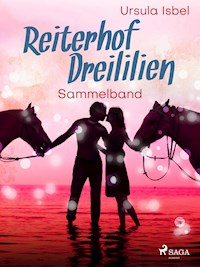Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pferdeheimat im Hochland
- Sprache: Deutsch
Auch wenn es sehr viel Arbeit ist, liebt Laura ihre Arbeit auf dem Gnadenhof "The Laurels" über alles. Im schottischen Hochland hat sie ihr Zuhause gefunden. Doch leider sind nicht alle begeistert von der Arbeit ihres Onkels. Ein Schuss mitten in der Nacht und zwei düstere Gestalten, verändern Lauras Leben nachhaltig. Sind die Pferde auf "The Laurels" wirklich in Sicherheit?Die 16-jährige Laura konnte ihre Eltern endlich davon überzeugen ein Jahr auf dem Gnadenhof ihres Onkels zu verbringen. Sie liebt die Arbeit dort mit den Tieren und als ihr Onkel Laura in Aussicht stellt den Hof an sie zu vererben, ist die junge Pferdenärrin im absoluten Glück. Lauras Eltern stimmen zu, dass sie auf dem Hof bleiben darf und die Teenagerin beginnt eine Freundschaft mit Danny vom Nachbarhof. Doch die Familien leben seit langer Zeit im Streit. Kann Lauras und Dannys Freundschaft dagegen bestehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 174
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel
Pferdeheimat im Hochland - Blühende Heide
Saga
Pferdeheimat im Hochland - Blühende Heide
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1995, 2021 Ursula Isbel und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726877397
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1
Rascal, der Terrier, weckte mich mitten in der Nacht. Er war aus dem Bett gesprungen und kratzte an der Tür, und ich dachte, es wäre schon früh am Morgen, und ich hätte verschlafen. Ich knipste die Nachttischlampe an und sah, daß es hinter den Fenstern noch dunkel war, denn ich hatte die Vorhänge nicht zugezogen. Schlaftrunken raffte ich mich auf und murmelte: „Was ist los? Mußt du mal runter?“
Rascal wedelte heftig mit dem Schwanz und wartete voller Ungeduld an der Tür, während ich aus dem Bett stieg und mir einen Pullover über den Kopf zog. Einer meiner Hausschuhe war unters Bett gerutscht, doch Rascals Blick bettelte um Eile. So tappte ich barfuß über den Teppich und öffnete die Tür.
Der Terrier zwängte sich durch den Türspalt und verschwand blitzartig im dunklen Flur. Und noch während ich da auf der Schwelle stand, hörte ich es – ein Stöhnen, das aus der Finsternis kam, kurz nur; dann das klickende Geräusch von Rascals Krallen auf den Dielenbrettern.
Meine erste Regung war, kehrtzumachen, die Zimmertür hinter mir zuzuschlagen, den Schlüssel umzudrehen und mich unter der Bettdecke zu verkriechen. Doch ich verharrte stumm und starr, hielt den Atem an und lauschte. Nur meine Knie schlotterten, ja, ich spürte richtig, wie sie sich bewegten. Dann stieß Rascal einen leisen, japsenden Laut aus, der anders war als alle Geräusche, die ich je von ihm gehört hatte.
Mit zitternder Hand tastete ich nach dem Lichtschalter. Wieder ein Stöhnen, lauter als vorher, und Rascals Fiepen. Jetzt brannte die Deckenlampe in meinem Zimmer, und ein schräger Lichtkegel erhellte ein Stück des Flurs, einen Teil des Teppichs, den dunklen Holzboden, zwei Türen, ein Bild an der Wand ...
Alles schien regungslos, unverändert; doch was war jenseits des Lichtstrahls, in den schwarzen Winkeln, auf der Treppe, hinter den geschlossenen Türen?
Ich raunte: „Rascal?“, doch es war mehr ein Krächzen als ein Wispern.
Da löste sich etwas aus der Dunkelheit. Eine kleine, vierbeinige Gestalt kam auf mich zugerannt, sprang an mir hoch, jaulte und winselte leise, zerrte mit den Zähnen am Ärmel meines Pullovers.
Mein Herz klopfte bis in den Hals hinauf. „Was ist?“ flüsterte ich. „Was ist los?“
Aber Rascal hatte sich schon wieder umgedreht und rannte aus dem Lichtstreifen in die Finsternis zurück, dorthin, wo der Treppenabsatz war.
Noch immer konnte ich mich nicht bewegen. Ich war unfähig, auch nur einen Schritt über die Schwelle zu tun, um den Lichtschalter des Flurs zu erreichen, der zwischen meiner Tür und der des Nebenzimmers war. Aus der Küche kam Darts Geheul, so langgezogen und klagend, daß es mir einen Schauer über den Rücken jagte. Fast überhörte ich dabei die Stimme, die meinen Namen flüsterte. „Laurie!“
Sekundenlang dachte ich, ich hätte mich getäuscht; meine Ohren, empfindlich wie die Lauscher eines Wildkaninchens in höchster Gefahr, hätten mir etwas vorgegaukelt und den Nachtwind, der klagend ums Haus strich, für eine Stimme gehalten. Aber da war es wieder, ein flehendes, atemloses Wispern: „Laurie!“
Endlich rannte ich los, vergaß, das Flurlicht anzuschalten, stolperte über die Teppichkante, fiel hin, raffte mich wieder auf, taumelte aus der Helligkeit des Lichtkegels ins Dunkel hinein – und da war Rascal, der mir entgegenkam. Ich spürte, wie er seinen warmen, vor Aufregung zitternden Körper gegen meine Beine preßte.
Onkel Scott lag auf dem Treppenabsatz, ein schwarzer Schatten im nächtlichen Dunkel des Hauses.
Ich plumpste neben ihm zu Boden, vor Angst schwerfällig wie ein nasser Hafersack. Mein einziger Gedanke war, daß etwas Schreckliches mit ihm geschehen war, und daß er sterben mußte.
Es gibt Augenblicke im Leben, in denen die Furcht einen kraftlos macht. Man sinkt in sich zusammen, schlaff an allen Gliedern, total leer im Kopf; und inmitten dieses hilflosen Bündels ist das Herz wie ein frisch gefangener Vogel, der voller Panik gegen die Gitterstäbe seines Käfigs flattert, ein pochendes, zuckendes Stück Leben, das nicht mehr aus noch ein weiß.
Schließlich hob ich die rechte Hand und berührte den Stoff von Onkel Scotts Schlafanzug. Ich schaffte es nicht, aufzustehen und Licht zu machen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, daß dann alles noch schlimmer sein würde, daß die Dunkelheit mich davor bewahrte, etwas Unerträgliches sehen zu müssen.
„Onkel Scott?“ fragte ich. Mein Mund war trocken, und ich sagte es wieder und wieder, weil Rascal so laut winselte, und weil ich solche Angst hatte, er könnte mich nicht hören – er könnte mich nie wieder hören.
Doch dann spürte ich eine Bewegung unter meinen Fingern und hörte ihn murmeln: „Du mußt den Doktor rufen. Es ist ...“ Das klang so matt und schwach, daß ich mein Ohr näher an sein Gesicht brachte.
Erst nach einer Atempause, wie nach großer Anstrengung, sprach er weiter: „Es ist wohl wieder mein Herz, hol’s der Teufel...“
Daß er noch schimpfen konnte, tat mir gut. Ich merkte, wie mir die Tränen kamen, aber ich drängte sie gewaltsam zurück, richtete mich mit wackeligen Beinen auf und erwiderte möglichst ruhig: „Bleib ganz still liegen, ich kümmere mich um alles. Es wird schon wieder gut. Nur beweg dich nicht, und versuch auf keinen Fall, aufzustehen!“
Schon wollte ich in der Finsternis die Treppe hinunterstürmen, doch eine innere Stimme warnte mich. Ich wußte, jetzt hing alles von mir ab, davon, daß mir nichts passierte und daß ich schnell war. Ich tastete nach Onkel Scotts Schlafzimmertür und fand nach einer kleinen Ewigkeit den Lichtschalter.
Die plötzliche Helligkeit war ein Schock. Onkel Scott lag zusammengekrümmt neben dem Treppengeländer; ein Schritt nur, und er wäre hinuntergestürzt. Er war aschgrau im Gesicht und hatte die Augen geschlossen. Die linke Hand hielt er gegen die rechte Schulter gepreßt.
„Doktor O’Toole“, sagte er. „Die Nummer steht in meinem Adreßbuch...“
Ich schickte ein Stoßgebet zum Himmel, daß das Adreßbuch beim Telefon lag, nicht in Onkel Scotts undurchdringlichem Durcheinander auf dem Schreibtisch oder sonst irgendwo unter den Sachen in seinem Zimmer. Doch zum Glück gab es ja noch das Telefonbuch.
Ich blieb nicht mehr stehen, um ihn zu fragen, ob er Schmerzen hatte. Mein Gefühl sagte mir, daß ich keine Zeit verschwenden durfte, daß es vielleicht um Minuten ging. Und so rannte ich die Treppe hinunter, während Rascal weiter bei meinem Onkel Wache hielt und Dart wie verrückt an der Küchentür kratzte.
Natürlich war das Adreßbuch nicht da, wo es hätte sein sollen. Fieberhaft begann ich im Telefonverzeichnis zu blättern. Zugleich lauschte ich nach Geräuschen von oben, und vor Angst und Aufregung kamen mir wieder die Tränen.
Es gab mehrere O’Tooles in unserer Gegend, und ich hatte keine Ahnung, wie Onkel Scotts Arzt mit Vornamen hieß, aber da stand es endlich: Dr. Richard O’Toole in Strathpeffer.
Mit zitterndem Zeigefinger wählte ich die Nummer. Was tu ich bloß, wenn er nicht zu Hause ist? dachte ich verzweifelt, während ich das Telefon wieder und wieder anläuten hörte. Meine Nase lief, und ich wischte mit dem Handrücken darüber, hörte Dart kratzen und Rascal winseln und die alte Uhr im Wohnzimmer ächzend ticken. Da, endlich, sagte eine verschlafene Stimme: „Ja, hallo?“
Ich war so erleichtert, daß ich sekundenlang kein Wort hervorbrachte. Erst als die Stimme ein zweitesmal „hallo“ sagte, konnte ich antworten. „Bitte kommen Sie sofort“ rief ich. „Es ist schrecklich dringend! Mein Onkel – Mr. Montrose – er sagt, es ist sein Herz ... Er liegt auf dem Treppenabsatz. Ich glaube, er hat Schmerzen...“
Jetzt verlor ich endgültig die Fassung und begann zu weinen. Ich konnte einfach nichts dagegen tun. Die Tränen ließen sich nicht zurückhalten. Doch die Stimme am Telefon war freundlich und sanft.
„Was ist passiert? Beruhige dich erst mal, ich komme ja. Aber ich muß wissen, worum es sich handelt!“
„Es ist sein Herz“, wiederholte ich schluchzend. „Er ist so grau im Gesicht! Vielleicht ist es ein...“ Natürlich wußte ich nicht, was Infarkt auf Englisch heißt, doch der Arzt wartete nicht ab, sondern fragte rasch: „Ist er bei Bewußtsein?“
„Ja“, sagte ich. „Und er hat die Hand an die linke Schulter gepreßt...“
Dr. O’Toole erwiderte: „Ich komme, so schnell ich kann. Und ich werde auch die Ambulanz vorbeischicken. Sorge dafür, daß er ruhig liegenbleibt. Und versuch das Herzmittel zu finden, das ich ihm verschrieben habe. Es sind Kapseln in einer Glasflasche mit grünem Etikett. Gib ihm zwei von den Kapseln mit reichlich Wasser. Ich komme!“ Und schon wurde der Hörer aufgelegt.
Ich zog mich am Treppengeländer hoch wie eine alte Frau, so schlapp und kraftlos waren meine Beine. Onkel Scott lag noch auf der gleichen Stelle wie vorher; zum Glück hatte er sich nicht bewegt. Oder hatte er das Bewußtsein verloren?
Der Gedanke ließ eine neue Welle von Panik in mir aufkommen – denn wie sollte ich ihm seine Medizin geben, wenn er ohnmächtig war? Außerdem wußte ich nicht mehr genau, wie man mit Bewußtlosen umgeht. Der Erste-Hilfe-Kurs in der Schule lag so lange zurück. Ich erinnerte mich schwach an die Warnung, daß Bewußtlose an ihrer eigenen Zunge ersticken können. Verdammt, warum hatte ich nur nicht besser aufgepaßt?
„Onkel Scott?“ flüsterte ich und war unendlich froh, als ich merkte, daß seine geschlossenen Lider leicht zuckten. Ich beugte mich über ihn und sagte: „Der Doktor kommt gleich! Er schickt auch die Ambulanz vorbei.“
Er stieß einen leichten Seufzer aus, und ich fügte hinzu: „Du darfst dich nicht bewegen! Und ich soll dir zwei von den Kapseln geben, die er dir für dein Herz verschrieben hat. Wo finde ich sie?“
„Irgendwo ... in meinem Zimmer“, erwiderte er stockend.
Rascal kauerte dicht neben seinem Herrn. Er winselte jetzt nicht mehr, lag nur da und zitterte. Erst jetzt bemerkte ich, wie blau Onkel Scotts Lippen waren. Er fror sicher in dem kalten Flur. Ich mußte ihn in Decken packen, warum hatte ich nur nicht früher daran gedacht?
Ich rannte in mein Zimmer, zerrte Tante Annes Patchworkdecke vom Bett, dazu mein Kopfkissen, lief zurück zum Treppenabsatz und schob meinem Onkel vorsichtig das Kissen unter den Kopf. Dann deckte ich ihn zu, so gut ich konnte, wobei Rascal völlig unter den bunten Vierecken aus Samt verschwand, und stürzte anschließend in Onkel Scotts Zimmer.
Es war in wilder Unordnung, wie immer. Überall lagen Zeitschriften und Klamotten, Pfeifen, Socken, Dosen mit Sattelseife und schmutzige Reitstiefel herum; dazwischen Bücher und Rechnungen und Aktenordner und irgendwelches Werkzeug.
Ich sah mich verzweifelt um und dachte: Hilfe! Das kann Tage dauern, bis ich dieses Fläschchen finde ... Doch wie durch ein Wunder fand ich es sofort, als hätte eine gütige Fee oder ein helfender Engel mich an der Hand genommen und geführt. Es lag auf dem Bambustischchen neben dem Bett, halb verdeckt von einem ledernen Tabaksbeutel.
Ich griff nach dem Fläschchen und preßte es an mich wie einen kostbaren Schatz, stolperte über einen Berg Akten, stieß mir das Schienbein an einer alten Truhe mit gewölbtem Deckel und kehrte zu Onkel Scott zurück, der mir mit angstvoll geweiteten, seltsam trüben Augen entgegensah.
Während ich mich über ihn beugte, sagte ich: „Hier ist deine Medizin. Sie hilft dir bestimmt. Ich hole noch rasch ein Glas Wasser. Hast du Schmerzen?“
Er gab keine Antwort, doch die Angst in seinem Blick übertrug sich auf mich.
Ich rannte ins Bad, füllte einen Zahnbecher mit Wasser und schüttelte mit bebenden Fingern zwei der braunen Kapseln aus dem Fläschchen. Dann kniete ich neben meinem Onkel, hob mit dem linken Arm sacht seinen Kopf ein wenig an, steckte eine der Kapseln zwischen seine Lippen, führte das Glas an seinen Mund und wartete, während er schluckte.
Die zweite Kapsel fiel mir in der Aufregung aus der Hand und rollte über den Teppich. Ich hätte weinen mögen über meine Ungeschicklichkeit, doch ich fand sie rasch wieder und gab sie ihm, und er schluckte und trank und schloß dann die Augen wie nach einer großen Anstrengung.
Wie Schrecklich eingefallen und grau sein Gesicht war! Während ich da neben ihm kauerte und seine Hand hielt, spürte ich mit aller Deutlichkeit, wie lieb ich ihn hatte, daß er zu einem der wichtigsten Menschen in meinem Leben geworden war.
Der Gedanke, daß er vielleicht sterben mußte, wenn sein Herz nicht durchhielt, wenn der Arzt nicht rechtzeitig kam, gab mir ein seltsames Gefühl, das ich nie zuvor gekannt hatte. Es war, als würde ich vor einem Abgrund stehen, der schwarz und bodenlos war, und wissen, daß ich jeden Augenblick in die Tiefe stürzen konnte.
Später sollten die Ereignisse dieser Nacht zu den Bildern in meinem Leben gehören, die auf ewig in mein Gedächtnis eingebrannt waren. Am nächsten Tag sagte Mrs. Kirkish zu mir: „Solche Dinge sollte man nicht errrleben, wenn man noch so jung ist wie du. Es ist zu viel Verrrantworrrtung.“
Doch ich glaube, daß man sich mit dreißig oder fünfzig in einer derartigen Lage genauso hilflos und verzweifelt fühlen kann, daß es keinen Unterschied macht, ob man blutjung ist oder erwachsen oder steinalt. Die Angst um einen Menschen, den man liebt, das Gefühl der Machtlosigkeit einem drohenden Verhängnis gegenüber verändern sich nicht.
Ich weiß heute nur, daß Onkel Scott es wohl nicht geschafft hätte, wenn ich nicht bei ihm gewesen wäre. Allein in dem großen Haus, durch dreiundzwanzig Stufen vom Telefon getrennt, hätte er nicht überlebt. Vielleicht war das mit ein Grund, weshalb mich das Schicksal ins Hochland geführt hatte.
2
Ich kann nicht sagen, wie lange ich da im Flur neben Onkel Scott kauerte, seine Hand in der meinen, Rascal zwischen uns. Vielleicht war es nur eine Viertelstunde, vielleicht viel länger. Ich hatte keinen Zeitbegriff mehr.
Mein Onkel klagte über starke Schmerzen in der Brust und im linken Arm. Manchmal stöhnte er unterdrückt. Ich weiß noch, daß ich fast ununterbrochen dachte: Ich muß ihn festhalten! Er darf nicht Weggehen, ich will ihn nicht verlieren ...
„Du schaffst es!“ hörte ich mich selbst mit dünner Stimme sagen. Es klang beschwörend. „Wir brauchen dich doch – die Pferde brauchen dich! Halt durch, bis der Doktor kommt...“
Irgendwann sah ich, wie das letzte Fenster, das am Ende des Flurs lag und vom Lichtkegel der Lampe nicht mehr erreicht wurde, sich erhellte. Darts Gewinsel wandelte sich in Gebell, und wir hörten das Knirschen von Reifen auf dem Kies.
Rascal richtete sich auf. Er lauschte und knurrte, und ich sagte: „Sie kommen – die Ambulanz oder der Doktor – endlich!“
Ich drückte Onkel Scotts Hand und raffte mich auf, steif und starr von der Kälte und der ausgestandenen Angst. Und während ich die Treppe hinunterging, hinter Rascal her, der bellend vorausstürmte, hallte das Pochen des Türklopfers durchs Haus.
Es waren zwei Männer von der Ambulanz, gefolgt von Dr. O’Toole, den ich ja von meinem Reitunfall her kannte. Sie drängten eilig in die Halle, und ich hielt Rascal fest, der von all der Aufregung wie verrückt war, die Zähne fletschte und versuchte, einem der Sanitäter in die weißen Hosenbeine zu beißen.
Dr. O’Toole fragte kurz: „Wo ist er?“
Ich deutete nach oben. „Dort, auf dem Treppenabsatz“, sagte ich. Mir war plötzlich total flau im Magen. Ich hatte Angst, mich übergeben zu müssen oder in eine Tränenflut auszubrechen, die nie mehr zu stoppen war. Rasch nahm ich den widerstrebenden Rascal am Halsband, zog ihn mit ins Wohnzimmer und ließ mich in einen Sessel fallen. Eine Weile saß ich im dunklen Zimmer, versuchte tief durchzuatmen und zu lauschen, während mein Herz wie verrückt hämmerte und das Ticken der Standuhr in meinen Ohren dröhnte.
Ich starrte durch die offene Tür hinaus auf den erleuchteten Flur, hielt den knurrenden Rascal am Halsband fest und betete: Lieber Gott, mach, daß sie nicht zu spät gekommen sind! Mach, daß sie Onkel Scott helfen können! Laß uns nicht im Stich! Mach ihn wieder gesund, bitte, verlaß uns nicht ...
Nie zuvor hatte ich mich so elend gefühlt. Mein einziger Trost war Rascals warmes, weiches Fell unter meinen Händen, sein Kopf an meinem Knie. Ich spürte seih Herz bis in den Hals hinauf klopfen. Auch er war voller Panik über alles, was da geschah und was er nicht verstand. Sicher spürte er, daß es etwas Schlimmes, Bedrohliches war, eine Wolke des Unheils, die über dem Haus hing.
Er versuchte sich loszureißen, als wir Schritte auf der Treppe hörten. Ich stand auf und ging zur Tür; doch es waren nur die beiden Sanitäter, die durch die Halle kamen. Sie gingen aus dem Haus und ließen die Eingangstür offen. Ich spürte den kalten Luftzug von draußen, den Duft der Frühlingsnacht. Dann kamen sie mit einer Trage zurück, die sie an mir vorbeitrugen, die Treppe hinauf.
Ich schloß Rascal im Wohnzimmer ein. Er wäre jetzt nur im Weg gewesen, wenn Onkel Scott in den Krankenwagen gebracht wurde, hätte vielleicht sogar versucht, mit ins Auto zu springen oder hinterherzulaufen.
Am Fuß der Treppe wartete ich. Oben kniete Dr. O’Toole neben meinem Onkel. Ich hörte ihn etwas sagen, verstand aber die Worte nicht. Dann hoben die Sanitäter Onkel Scott auf die Trage, rasch und mit geübten Bewegungen, gurteten ihn fest und trugen ihn langsam und vorsichtig die schmalen Stufen hinunter.
Ich trat zur Seite. Als sie an mir vorüberkamen, öffnete Onkel Scott die Augen und sah mich an. Er sagte kein Wort, doch er versuchte zu lächeln, als wollte er mich trösten und mir Mut machen.
Ein Schluchzen stieg in meiner Kehle auf. Ich griff nach seiner Hand und ging neben der Trage her zur Tür, wo es zu eng für uns alle wurde. Da ließ ich seine Hand los und trat zurück.
„Ich kümmere mich schon um die Pferde!“ versprach ich. „Mach dir keine Sorgen!“
Die beiden Männer trugen die Trage die Vortreppe hinunter. Dr. O’Toole blieb neben mir stehen.
„Wie geht es ihm?“ fragte ich im Flüsterton. „Ist es ... ist es schlimm?“
„Es ist sein zweiter Infarkt“, erwiderte der Arzt ruhig. „Ein Glück, daß du da warst, und daß er sich bemerkbar machen konnte. Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute; je eher der Patient ärztliche Hilfe bekommt, desto besser sind seine Chancen. Ich habe ihm eine Spritze gegeben. Wenn er allein im Haus gewesen wäre ...“ Er schüttelte den Kopf.
„Aber es war doch nicht zu spät? Er wird doch durchkommen?“ fragte ich, und meine Kehle schmerzte von unterdrücktem Schluchzen.
„Wir wollen es hoffen“, sagte Doktor O’Toole. „Ich denke, er hat gute Chancen.“
Er wandte sich zum Gehen, und ich tappte ihm nach, barfuß auf den kalten Steinfliesen des Vorplatzes, und fragte: „Kann ich mitkommen? Kann ich mit ins Krankenhaus fahren?“
Wieder schüttelte er den Kopf. „Jetzt nicht. Du kannst morgen nach ihm sehen, Laurie.“
„Aber wohin bringen Sie ihn?“ rief ich ihm nach, während der Krankenwagen gestartet wurde und auf dem Hofplatz wendete.
„Nach Inverness; vielleicht auch nach Aberdeen. Ich rufe dich in den nächsten Stunden an und sag dir Bescheid, sobald ich mehr weiß!“
Er stieg in seinen Volvo und fuhr hinter dem Krankenwagen her. Die Schlußlichter der beiden Fahrzeuge versanken im Dunkel der Lorbeerbüsche, die die Auffahrt säumten. Der Mond kam zwischen den Wolken hervor, umgeben von einer weißen Aura. Ich spürte die eisige Kälte der Fliesen unter meinen Füßen, und es kam mir vor, als hätte ich mich nie zuvor in meinem Leben einsamer gefühlt.
Langsam ging ich in die Halle zurück und schloß die Tür. Jetzt, wo ich allein war, hätte ich weinen können, aber es ging nicht mehr. Ich holte Rascal aus dem Wohnzimmer und Dart aus der Küche. Sie rannten zur Eingangstür und scharrten am Holz, aber ich ließ sie nicht ins Freie.
„Wir müssen hierbleiben und warten“, sagte ich zu ihnen. „Wir können jetzt nichts anderes tun als warten.“
3
Ich erinnere mich, daß ich ruhelos wie ein unerlöster Geist durchs Haus streifte, unfähig, mich irgendwo länger als fünf Minuten aufzuhalten. Ins Bett mochte ich nicht mehr gehen, obwohl ich fror und mich nach Ruhe sehnte.
Im Wohnzimmer war es kalt und leer ohne Onkel Scott. Das ganze Haus kam mir ohne ihn plötzlich wie ein Ort der Verbannung vor. Die Hunde schlichen hinter mir her, ängstlich, mit eingekniffenen Schwänzen und fragenden Augen. Kater MacDuff saß auf dem Schrank in der Halle und starrte mit gesträubtem Rückenfell auf uns nieder.
Mehr als einmal stand ich vor dem Telefon und kämpfte mit der Versuchung, Danny anzurufen. Doch ich wollte ihn, seine Mutter und Sheila, seine Schwester, nicht mitten in der Nacht aufschrecken und aus den Betten jagen – falls Danny nicht sowieso gerade im Stall bei einem lammenden Mutterschaf war.
Am liebsten hätte ich mich auf eins unserer Pferde geschwungen und wäre zu ihm hinübergeritten, aber ich konnte ja nicht weg; ich mußte warten, bis Dr. O’Toole anrief und mir sagte, wie es Onkel Scott ging und wohin sie ihn gebracht hatten.