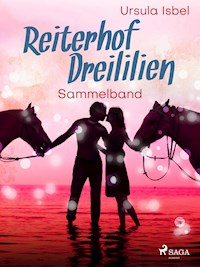Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pferdeheimat im Hochland
- Sprache: Deutsch
Das Leben auf "The Laurels" bleibt spannend, denn obwohl Laura sich gut eingelebt hat und ihre Arbeit liebt, macht sie sich Sorgen um Danny. Ein Großteil seiner Schafherde ist an einem Virus gestorben und Danny in schwere Depressionen verfallen. Kann Laura seine Lebensfreue wiedererwecken?Die 16-jährige Laura konnte ihre Eltern endlich davon überzeugen ein Jahr auf dem Gnadenhof ihres Onkels zu verbringen. Sie liebt die Arbeit dort mit den Tieren und als ihr Onkel Laura in Aussicht stellt den Hof an sie zu vererben, ist die junge Pferdenärrin im absoluten Glück. Lauras Eltern stimmen zu, dass sie auf dem Hof bleiben darf und die Teenagerin beginnt eine Freundschaft mit Danny vom Nachbarhof. Doch die Familien leben seit langer Zeit im Streit. Kann Lauras und Dannys Freundschaft dagegen bestehen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel
Pferdeheimat im Hochland - Wechselnde Pfade
Saga
Pferdeheimat im Hochland - Wechselnde Pfade
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1992, 2021 Ursula Isbel und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726877373
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1
...Und ziehen Sie den Strudelteig sodann über beide Handflächen rasch und vorsichtig so dünn aus, dass man darunter befindliche Gegenstände erkennen kann, stand in Großmutters Rezeptbuch, das alt und fleckig war und einen Einband aus kariertem Schrankpapier hatte. Vor einer Woche hatte es der Postie gebracht, in einem Päckchen, zusammen mit einem wollenen Schlüpfer. Denn – wie Großmutter so treffend schrieb – der Herbst hatte Einzug gehalten und der Winter stand vor der Tür.
Ja, die ersten Herbststürme rüttelten an den Fenstern und pfiffen durch sämtliche Ritzen in Onkel Scotts altem Haus; Stürme, die vom Meer kamen und mit wilder Gewalt über das Hochland brausten, sodass unsere Pferde sich zu Gruppen drängten, die Köpfe zusammensteckten und nur ihre Hinterteile dem Wind aussetzten.
Dart und Rascal, die Hunde, lagen unter dem Tisch und schnarchten. Sie liebten es, wenn ich in der Küche herumwerkelte, wo es warm war und nach Essen roch. Kater MacDuff hatte die zugige Fensterbank verlassen und sich zwischen Socken, Pullovern, Zeitungen und Schals auf dem Sofa ein gemütlicheres Plätzchen gesucht; und ich stand am Tisch, die Hände voller Mehl, und starrte zweifelnd auf meinen Teig nieder.
Großmutter Nanni hatte immer behauptet, die Feuerprobe für jede gute Köchin wäre eine Strudelteig; und ich war alles andere als eine gute Köchin. In den drei Monaten, die ich nun hier bei meinem Onkel in Schottland lebte, hatte ich es mit meinen Kochkünsten nicht sehr weit gebracht. Doch heute war Onkel Scotts Geburtstag und ich war wild entschlossen, ihn mit seinem Lieblingsgericht zu überraschen, auch wenn ich den ganzen Tag in der Küche stehen und schwitzen musste.
Ich legte Tante Annes Nudelholz beiseite. Es war seltsam, mir vorzustellen, dass sie es wahrscheinlich als Letzte in der Hand gehalten hatte; denn später hatte in The Laureis wohlkeinermehr einen Apfelstrudel gebacken.
Mein Teig war ausgerollt und mit viel Mehl vermischt, was sicher unvorschriftsmäßig war, aber verhinderte, dass er ständig an der Tischplatte kleben blieb. Jetzt sollte ich ihn also über beide Handflächen so dünn auseinander ziehen, dass man durchsehen konnte...
Ich startete meinen ersten Versuch. Der Teig nahm es übel und riss, sodass ein stattliches Loch entstand.
»Scheiße«, sagte ich.
Rascal, der wuschelhaarige graue Terrier, wurde wach und klopfte freundlich mit dem Schwanz auf den Boden. Ich versuchte den Teig zusammenzuziehen und das Loch zu flicken, indem ich die Ränder zusammendrückte, doch da riss er an zwei anderen Stellen. MacDuff beobachtete mich aus halb geschlossenen Augen. Ein heftiger Windstoß trieb einen Schwall Regen gegen die Fensterscheiben. Es heulte in den Kaminen. Dart knurrte im Schlaf.
Ich musterte den Teig, seufzte und formte erneut eine Kugel daraus. Dann drückte ich ihn mit beiden Handballen auseinander und rollte ihn wieder aus. Prompt klebte er an der Tischplatte fest. Mit Hilfe eines Messers versuchte ich ihn abzulösen; da klingelte das Telefon in der Halle.
Ich wischte mir die Hände an den Jeans ab, stürzte hinaus, nahm den Hörer ab und sagte: »The Laurels.«
Es war Danny. Mein Herz schlug ein paar Takte schneller, als ich seine Stimme horte. »Laurie?«, sagte er mit jenem zärtlichen Unterton, der bewirkte, dass ich meinen Namen richtig schön fand. »Ich hab MacMonster über die Felder reiten sehen. Hast du Zeit, dich mit mir zu treffen?«
MacMonster, das war mein Onkel. Danny nannte ihn häufig so; aber ich wusste, dass er es nicht mehr so abwertend meinte wie früher.
»Heute nicht«, sagte ich. »Ich meine, ich würde unheimlich gern kommen, aber ich muss einen Apfelstrudel backen.«
»Einen was?«, fragte Danny.
Ich lachte. »Einen Apfelstrudel. Das ist ein bayerisches Spezialgericht. Oder vielleicht auch ein österreichisches, ich weiß nicht so genau. Jedenfalls hat ihn meine Tante früher ab und zu für Onkel Scott gebacken und er ist ganz wild darauf. Und heute ist sein Geburtstag.«
»Kannst du diesen... dieses Ding nicht auch noch später machen?«, fragte Danny.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, es dauert so lang. Man muss einen...« Ich hatte vergessen, was Teig auf Englisch heißt. »Man macht so eine Mischung aus Mehl und Butter und Eiern wie für einen Kuchen –«
»Dough«, sagte Danny.
»Ja, dough. Und das füllt man dann mit geschnittenen Äpfeln, Nüssen, Rosinen, Zucker und Zimt. Es ist furchtbar viel Arbeit. Und ich bin erst beim Teig.«
»Allmächtiger!«, sagte Danny. »Soll ich kommen und dir helfen?«
Wir lachten, obwohl es eine Art Galgenhumor war. Denn wir wussten beide, dass Onkel Scott vor Wut im Viereck gesprungen wäre, wenn Danny MacClintock, der Sohn seines Erzfeinds, auch nur einen Fuß über die Schwelle von The Laurels gesetzt hätte.
Der Türklopfer schallte durchs Haus. Dart und Rascal kamen bellend aus der Küche gestürmt. Hastig sagte ich: »Ich versuche morgen Nachmittag gegen vier beim Efeubaum zu sein. Ist dir das recht?«
Und Danny versprach zu kommen; da legte ich den Hörer auf, ging zur Tür und öffnete. Draußen stand Mrs. Tweedie, klein und verhutzelt, den Hut vom Wind abenteuerlich schief auf dem Kopf und ein großes Paket unter dem Arm. Sie huschte an mir vorbei in die Halle. Der Wind knallte die Tür hinter ihr zu.
»Scheußliches Wetter!«, sagte sie mit der zufriedenen Miene einer Wahrsagerin, deren düstere Prophezeiungen in Erfüllung gegangen sind. »Auf der Landstraße wäre ich beinahe weggeflogen!« Und sie kicherte, woraus ich schloss, dass sie ausnahmsweise gute Laune hatte.
Ich beobachtete, wie sie ihr Paket abstellte und ihr Filzhütchen absetzte, wobei sie mehrere Hutnadeln entfernte; und ich wünschte, sie wäre wirklich weggeflogen. Denn wenn ich etwas nicht leiden konnte, dann waren es Mrs. Tweedies gute Ratschläge beim Kochen.
»Ist der Junge zu Hause?«, fragte sie und ich sagte, nein, Onkel Scott wäre vor einer Stunde losgeritten, um einen Freund zu besuchen, und würde wohl so schnell nicht zurückkommen.
»Das macht nichts«, sagte sie. »Dann warte ich. Du kannst mir ein Tässchen Tee vorsetzen, Mädchen.«
Ich erwiderte höflich, aber bestimmt, dass ich keine Zeit hätte. »Ich backe etwas für Onkel Scott zum Abendessen«, sagte ich. »Seine Lieblingsspeise. Es ist sehr viel Arbeit und ich weiß sowieso kaum, wie ich rechtzeitig fertig werden soll.«
»So, so«, murmelte sie und musterte mich mit ihren wässrigen Augen. »Vielleicht kann ich dir ja helfen.«
»Ich hab mir vorgenommen, es allein zu schaffen«, sagte ich tollkühn und bereitete mich darauf vor, dass sie entweder tödlich beleidigt sein oder ein Klagelied darüber anstimmen würde, wie frech und undankbar die heutige Jugend doch sei, so ganz anders als junge Menschen zu ihrer Zeit. Aber sie nahm es ruhig hin, nickte nur und sagte, jeder müsse seine Erfahrungen selbst sammeln und ich solle mich nicht von ihr stören lassen.
»Ich koche nur meinen Tee und setze mich dann ins Wohnzimmer«, sagte sie. »Es ist doch Feuer im Kamin?«
Ich nickte, erleichtert und verdutzt zugleich, und sie folgte mir in die Küche und setzte brummelnd Teewasser auf, während ich mich wieder mit meinem Teig abplagte. Mrs. Tweedies Gegenwart machte mich noch nervöser, als ich es schon war. Ich unterdrückte einen dankbaren Seufzer, als sie endlich mit ihrem Teetablett in die Halle trippelte.
Ich hatte geglaubt, ohne Mrs. Tweedies strenges Auge würde es leichter sein, doch das war es nicht. Der Teig klebte und riss, klebte und riss. Ich begann zu schwitzen und musste mich zusammennehmen, um den Teig nicht in den Abfalleimer oder aus dem Fenster zu werfen.
Am Ende verzichtete ich auf allen Ehrgeiz und ließ den Teig so, wie er war: eher dick als dünn und nur an den Stellen durchsichtig, an denen er zu reißen drohte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich schon zittrige Hände und wusste nicht, ob ich über meine verunglückten Versuche lachen oder weinen sollte.
Ich füllte den Teig vorschriftsmäßig und drückte ihn wurstförmig fest. Die letzte Hürde bestand darin, die beiden Strudelwürste aufs Blech zu bugsieren, ohne dass der Teig platzte und der Inhalt herausquoll.
Als ich den Backofen einschaltete, kam Mrs. Tweedie wieder in die Küche. »Fertig?«, fragte sie.
Erschöpft nickte ich. Sie öffnete die Backöfentür, um sich mein Werk anzusehen. Da sie offenbar nicht wusste, wie ein anständiger Apfelstrudel auszusehen hat, merkte sie auch nicht, dass sie eine Missgeburt vor sich hatte.
»Fein«, sagte sie. »Ich erinnere mich jetzt, dass die junge Frau auch manchmal so etwas gebacken hat.« Für sie war meine Tante Anne, die seit vier Jahren nicht mehr lebte, immer noch »die junge Frau«, während sie Onkel Scotts Mutter nur »die alte Gnädige« nannte.
Ich war plötzlich unheimlich müde und sehnte mich danach, mich wenigstens für eine Viertelstunde aufs Bett zu legen und auszuruhen, doch inzwischen war es höchste Zeit, die Pferde zu versorgen. Mrs. Tweedie versprach aufzupassen, dass der Strudel nicht anbrannte, und ihn nach einer Dreiviertelstunde aus dem Ofen zu nehmen. Ich zog einen warmen Pullover und den Regenumhang über den Kopf, schlüpfte in meine Gummistiefel und verließ mit Dart und Rascal das Haus.
Eine Windbö, vermischt mit Regen, empfing uns auf dem Vorplatz. Es war ein dunkler Spätnachmittag; aus einer undichten Stelle der Dachrinne kam eine wahre Springflut, die auf das Glasdach des Wintergartens niederprasselte. Der alte Apfelbaum hinter dem Haus ächzte qualvoll. In Tante Annes Garten blühten die letzten zerzausten Rosen und auf dem Stallhof hatte der Wind eine Schubkarre umgeworfen und gegen den Koppelzaun geschleudert.
Allan hatte bereits angefangen die Pferde zu füttern. Sie standen jetzt auf Bulls Field, der Herbstkoppel. Der blinde Nutmeg, Fiona und ihr Fohlen Finn und das Shetlandpony Bonnie hatten die Schutzhütte aufgesucht, doch die anderen Pferde standen im Regen und Wind und ihre Mähnen und Schweife flatterten wie Fahnen, schwarz und falb, weizenblond, braun und weiß.
Ich hatte die Schubkarre genommen, drei Eimer voll mit Hafer und gequetschtem Mais hineingestellt und mit einer dicken Plane zugedeckt, die ich zusätzlich beschwerte. Damit kämpfte ich mich durch den Sturm. Dandy, der graue Wallach, kam zu mir zum Mäuerchen. Er begrüßte mich mit eifrig gespitzten Ohren und bleckte die Zähne; vielleicht wieherte er auch, nur hörte ich nichts, weil der Wind alle Geräusche mit sich forttrug, schneller als das Ohr sie vernehmen konnte.
Allan war zwischen den Pferden. Er rief mir etwas zu, was ich nicht verstand, und deutete auf Ginger. Sie stand mit hängendem Kopf unter einer Baumgruppe und ich begriff, dass etwas mit ihr nicht stimmte, denn sie war sonst immer unter den Ersten, wenn es Futter gab.
Ich rollte die Schubkarre zu Allan. Er sah auf und schrie: »Bringst du Ginger in den Stall? Ich mach inzwischen hier weiter!«
Und ich nickte und schrie zurück: »Hast du eine Ahnung, was ihr fehlt?« Doch er schüttelte den Kopf und schob die Nasen von zwei Stuten auseinander, die gleichzeitig versuchte sich über den Inhalt eines Eimers herzumachen.
Ich kehrte zum Stallhof zurück, begleitet von den Hunden. Der Wind nahm mir den Atem; er war scharf und kalt, ein Vorbote des nahenden Winters.
Die Halfter hingen in der Sattelkammer; ich nahm eines vom Haken, froh darüber, für Minuten unter einem schützenden Dach zu sein. Dann lief ich zum Futterschuppen hinüber, um gleich einen Teil der Rüben und Äpfel mit zur Koppel zu bringen.
Ginger stand noch an derselben Stelle. Sie ließ die Unterlippe hängen und ihre Augen waren trüb. Plötzlich sah sie sehr alt aus und mich überkam die Furcht, sie konnte sterben. Bis jetzt war es mir erspart geblieben, eines unserer Pferde sterben zu sehen, mit Ausnahme eines Hengstes, den zwei Polizisten todkrank und geschunden zu uns gebracht hatten. Doch Onkel Scott hatte mir mehr als einmal gesagt, dass ich darauf vorbereitet sein musste, auf einem Gnadenhof auch Krankheit und Tod zu erleben. Denn viele unserer Pferde waren schon alt, wenn sie zu uns kamen, oft auch krank und verbraucht. The Laurels war für die meisten von ihnen die letzte Station in ihrem Leben – » und wohl auch die beste«, wie Onkel Scott sagte; und er meinte, das müsste über vieles hinwegtrösten.
Ich stellte mich vor Ginger, um sie ein wenig gegen den Wind abzuschirmen, und legte ihr das Halfter an. Sie ließ es mit sich geschehen, suchte nicht wie sonst in meinen Taschen nach Leckerbissen, sondern blieb teilnahmslos. Ich streichelte ihren nassen Hals und führte sie langsam von der Koppel zum Pfad, wo Dart und Rascal beim Mäuerchen Schutz vor dem Wind gesucht hatten.
Es war fast gespenstisch, über den Stallhof zu gehen, ohne das Klappern von Gingers Hufen auf dem Pflaster zu vernehmen. Alle Geräusche ertranken im Heulen des Sturms, der sich an den Hausecken brach. Eine Möwe saß auf dem Dach des Futterschuppens, schwankend wie ein betrunkener Seemann, und meine Haare hatten sich gelöst und wirbelten mir wie verrückt ums Gesicht.
Der Stall war eine Oase der Ruhe. Ich führte Ginger in die beste Box, nahm ihr das Halfter ab, holte Strohwische und begann sie behutsam trockenzureiben, während Dart und Rascal sich auf der Stallgasse niederließen und die Köpfe seufzend auf die Vorderpfoten legten.
Vorsichtig tastete ich Gingers Bauch ab. Er war nicht aufgetrieben; eine Kolik konnte es also nicht sein. Sie sah so trübselig aus, wie sie da mit hängendem Kopf in der Box stand, dass es mir ins Herz schnitt. Rasch holte ich das Thermometer aus der Sattelkammer, um ihre Temperatur zu messen, und fand meine Befürchtungen bestätigt: Sie hatte Fieber, wenn es auch nicht sehr hoch war.
Ich breitete eine Filzdecke über ihren Rücken, schlang die Arme um ihren Hals und sagte: »Es wird alles wieder gut, mein Tierchen. Onkel Scott kommt bald zurück und schaut nach dir. Und später holen wir Will oder den Tierarzt.«
Ginger seufzte ein bisschen. Ich brachte ihr etwas Hafer und einen Eimer Wasser, doch sie mochte nichts fressen und trank auch nicht. Immerhin hatte ich das Gefühl, dass sie sich in dem ruhigen, friedlichen Stall wohler fühlte als draußen im Wind und Regen, denn sie schloss die Augen und begann zu dösen.
Wieder rannte ich hinaus, karrte weitere Eimer mit Hafer und Futterrüben nach Bulls Field und überlegte, ob ich Fiona und Finn, unsere Mutterstute und ihr Fohlen, ebenfalls in den Stall bringen sollte. Die beiden waren noch nicht lange bei uns. Erst seit drei Wochen durften sie nun mit den anderen Pferden auf der Weide gehen, nachdem der kleine Finn, mein Bairnie, ziemlich krank gewesen war. Auch jetzt waren die beiden bei weitem noch nicht so widerstandsfähig wie die meisten anderen Pferde, die das ganze Jahr im Freien verbracht hatten.
Ich rollte die Schubkarre zur Schutzhütte. Finn oder Bairnie, wie ich ihn liebevoll nannte, was auf Schottisch »Kindchen« heißt, war struppig und voller Schmutz und erinnerte mich mit seinen spitzen Ohren und den lebhaften dunklen Augen immer an einen Kobold. Da er unser einziges Fohlen war, mussten Allan und ich ihm die fehlenden Spielgefährten ersetzen. Wir tobten mit ihm herum, sooft wir Zeit dazu fanden; dann stand Fiona dabei und sah mit ihren milden Augen zu. Sie war sanft und geduldig, dankbar für jeden Liebesbeweis, und wusste längst, dass sie uns vertrauen konnte, dass weder ihr noch ihrem Fohlen von Onkel Scott, Allan oder mir etwas Böses drohte. Nur wenn Fremde kamen, zog sie sich ängstlich zurück, schubste Finn hinter ihren Rücken und sorgte dafür, dass er außer Reichweite war.
Doch während der Fütterung war keine Zeit zum Spielen, das hatte auch Finn schon begriffen. Er bekam jetzt sechs Pfund Kraftfutter, abgestimmt auf sein Alter. Hungrig stürzte er sich auf den Hafer, während Fiona langsam und bedächtig zu fressen begann. Sie war rundlicher geworden und ihr Fell sah besser aus. Doch die Spuren von zu früher und zu harter Arbeit und schlechter Ernährung hatten ihren Knochenbau geprägt; daran konnte auch die beste Pflege nichts mehr ändern.
Onkel Scott kam erst gegen Ende der Fütterung, durchnässt und fröstelnd, und brachte seinen Wallach Tullamore in den Stall, um ihn trockenzureiben. Gemeinsam sahen wir nach Ginger, die jetzt in der Streu lag und kläglich zu uns aufsah.
»Es ist wohl am besten, wir rufen Dr. Drury an«, sagte mein Onkel. »Ich hoffe bloß, sie hat nichts Giftiges gefressen.«
»Wir haben doch keine Giftpflanzen auf Bulls Field«, erwiderte ich.
Onkel Scott schüttelte den Kopf. »Es gibt die seltsamsten Dinge. Einem Viehzüchter am Loch Awe ist es passiert, dass vier seiner Rinder an vier aufeinander folgenden Tagen starben. Erst später hat man herausgefunden, dass irgendein Verrückter vergiftetes Brot über den Weidezaun geworfen haben muss.«
Erschrocken sah ich ihn an. Für mich war es fast unmöglich zu glauben, dass ein Mensch so etwas tun kann. Onkel Scott erwiderte meinen Blick, seufzte und sagte: »Wir leben in einer verrückten Welt, Laurie. Unsere Gesellschaft macht die Menschen krank – und die wiederum die Tiere.«
Er streichelte Ginger und murmelte sanft: »Du schaffst es, alte Lass. Wir kriegen das schon wieder hin.«
Er ging ins Haus, um Dr. Drury anzurufen und seine nasse Kleidung zu wechseln, während ich Tullamore tränkte, fütterte und auf die Weide brachte. Schon brach die Abenddämmerung herein und warf lange Schatten über das Pflaster des Stallhofs.
Ich hätte meinen Weg zwischen den Koppelmäuerchen jetzt auch im Dunkeln gefunden, so vertraut war er mir. Allan kam uns mit der leeren Schubkarre entgegen und ich schrie: »Ich bring nur noch Tullamore auf die Weide. Bist du fertig?«
Er nickte und blieb bei uns stehen. »Was ist mit Ginger?«
»Sie will nicht fressen. Onkel Scott ruft Dr. Drury an.«
Ich überlegte, ob ich die Möglichkeit einer Vergiftung erwähnen sollte, aber Allan hatte sich schon abgewandt und Tullamore zog mich ungeduldig weiter.
Ich war froh, als ich das Gatter hinter mir schließen und zum Haus zurückkehren konnte. Von Allan war nichts mehr zu sehen und die Hunde, die Onkel Scott gefolgt waren, kamen zur Tür und begrüßten mich. Mrs. Tweedie hatte den Apfelstrudel rechtzeitig aus dem Rohr geholt. Er duftete verführerisch und mein Onkel sagte, er könne es kaum erwarten, ihn zu probieren.
»Kommt Dr. Drury?«, fragte ich und ließ mich aufs Küchensofa plumpsen, um erst einmal Atem zu holen.
»Ich hab ihn noch nicht erwischt. Seine Frau sagt, aus Wales wäre eine Schafseuche eingeschleppt worden, und er ist rund um die Uhr unterwegs. Es wäre wohl am besten, wenn wir Will holen könnten, aber wer weiß, wo der zu finden ist; und bei diesem Wetter und in der Dunkelheit irgendwo in den Bergen herumzuklettern und nach ihm zu suchen wäre Schwachsinn. Wir werden bis morgen warten müssen.«
Eine Schafseuche! Ich dachte an Danny. Seine Familie lebte von der Schafzucht – nicht gerade üppig, aber immerhin hielten sie sich damit über Wasser. Wenn ihnen jetzt die Schafe starben, konnte das ihren Ruin bedeuten. Oder waren sie gegen Seuchen versichert? Ich bezweifelte es. Danny hatte einmal erwähnt, dass derartige Versicherungen eine Menge Geld kosten.
Mrs. Tweedie holte ihre Geschenke für Onkel Scott aus dem Wohnzimmer. Es waren ein selbst gestrickter Schal aus dunkelbrauner Wolle, drei Gläser hausgemachte Marmelade und eine Flasche Beerenwein, ebenfalls selbst gebraut.
Onkel Scott lobte und bewunderte alles gebührend, schlang sich den Schal um den Hals und behauptete, der hätte ihm bei diesem Wetter schon lange gefehlt; und sie strahlte und stieß zufrieden glucksende Geräusche aus.
Ich blieb am Tisch sitzen, nass, verschwitzt und zerzaust wie ich war, denn der Apfelstrudel musste gegessen werden, ehe er kalt wurde. Mrs. Tweedie hatte Kaffee dazu gekocht.
Alle – auch die Hunde und der Kater – sahen erwartungsvoll zu, wie ich den Strudel in Stücke teilte oder es zumindest versuchte. Der missglückte Teig war nämlich durchs Backen knochentrocken und beinhart geworden. Er krachte unter dem Messer, wollte sich nicht schneiden lassen und brach schließlich knackend auseinander.
»Gut durchgebacken ist er ja«, meinte Onkel Scott schmunzelnd.
Mrs. Tweedie machte ein zweifelndes Gesicht. Wahrscheinlich dachte sie an ihre dritten Zähne.
»Mit dem Teig hat es nicht so recht geklappt«, murmelte ich verlegen.
Mein Onkel sagte, es käme nicht auf den Teig an, sondern auf die Füllung. Und die schmeckte ihm offenbar großartig, denn er aß drei Riesenstücke und nahm auch tapfer den Kampf mit dem Teig auf, der zwischen seinen Zähnen knirschte und splitterte. Mrs. Tweedie hielt sich an die Äpfel und Nüsse und fütterte die Hunde mit dem Teig.