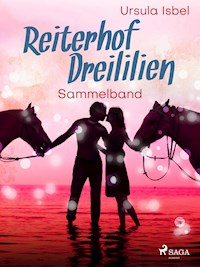Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pferdeheimat im Hochland
- Sprache: Deutsch
Laura ist glücklich, sie hat sich entschieden und liebt ihr neues Leben auf dem Pferdehof ihres Onkels. Nichts könnte ihr Glück trügen, denn Laura liebt nicht nur jedes Pferd auf dem Hof, sondern auch Danny vom Nachbarhof Braeside. Wie sicher ist die Zukunft? Danny und Laura scheinen endlich ihr Happy End gefunden zu haben, doch dann passiert etwas Dramatisches und Dannys Zukunft ist in Gefahr. Finden die beiden eine Möglichkeit?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ursula Isbel
Pferdeheimat im Hochland - Mein Herz ist in den Highlands
Saga
Pferdeheimat im Hochland - Mein Herz ist in den Highlands
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 2001, 2021 Ursula Isbel und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726877403
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1
Längst war mir die Melodie des Hochlandwinds vertraut, wenn er in den Wipfeln der Bäume sang und über die Hügel brauste, so wie in einem von Andersens Märchen, wo es heißt, dass der Wind alte Lieder singt.
In Herbstnächten oder an manchem stürmischem Frühlingsmorgen lag ich im Bett, hörte ihn ums Haus streichen und in den Efeuranken flüstern, die das Mauerwerk wie ein dunkelgrüner Pelz bedeckten.
Auch die Pferde liebten den Wind. Sie standen mit erhobenen Köpfen auf den Koppeln, die Nüstern geweitet, und atmeten die Gerüche ein, die der Wind vom Meer mitbrachte, durch die Täler und über die Hügel trug – den Duft nach Teer und Tang, nach Heidekraut und fernen Koppeln, auf denen andere Pferde weideten. Er ließ ihre Mähnen und Schweife wie Segel flattern, trocknete den Schweiß von ihren Flanken und kühlte ihre Fesseln.
Wenn ich das Brausen hörte, wusste ich, dass sein Lied nirgends so sein konnte wie hier, und dass ich in die Highlands gehörte, auch wenn ich an einem ganz anderen Ort der Welt geboren und aufgewachsen war.
Und ich durfte bleiben – nicht nur dieses eine Jahr. Endlich konnte ich sicher sein. Sie waren einverstanden, hatten ja gesagt.
Leicht war es nicht gewesen. Es hatte heftige Diskussionen gegeben, die jedes Mal haarscharf an einem handfesten Streit mit meiner Mutter vorbeigegangen waren. Sie fand, dass ich eine »ordentliche« Berufsausbildung brauchte, damit ich später gut verdiente und abgesichert war. Sicherheit bedeutete viel für sie. Vielleicht störte es sie auch, ihren Freunden und Bekannten sagen zu müssen, dass ihre Tochter Laurie »nur« Pferdewirtin werden wollte; Anwältin oder Kinderärztin, ihr Traumberuf, hätte sicher besser geklungen.
Ich versuchte ihr zu erklären, dass für mich andere Dinge zählten – die Liebe zu meiner neuen Heimat, zu Danny und den Pferden. Und dass die Arbeit auf dem Gnadenhof in meinen Augen schöner und sinnvoller war als alles andere, auch wenn sie manchmal bis an die Grenzen meiner Kräfte ging, auch wenn man damit weder reich werden konnte noch gesellschaftlich besonders geachtet war.
Mit meinem Vater war es weniger schwierig gewesen. Er verstand, dass ich in Schottland leben wollte, bei Onkel Scott und den Pferden, die hier in The Laurels ihr Gnadenbrot bekamen.
Er war immer auf meiner Seite gewesen, mein ganzes Leben lang schon. Doch schließlich, am Ende dieses Sommers, den meine Eltern mit uns im Hochland verbrachten, hatte auch meine Mutter zugestimmt.
»Wenn du meinst, dass du hier glücklich bist, muss ich es wohl akzeptieren«, sagte sie, als wir sie und meinen Vater zum Flughafen brachten – ohne meinen Bruder Tim, der seine Ferien mit Freunden in Griechenland verbrachte. »Es ist dein Leben, Laurie. Aber du hättest studieren können! Pferdewirtin ist doch ein viel zu anstrengender Beruf für eine Frau. Du bist nicht besonders kräftig; und was willst du machen, wenn du älter wirst?«
Wieder antwortete ich, dass keiner wissen kann, was später einmal sein wird, dass man nicht so weit vorausdenken sollte. Mein Vater half mir.
»Heutzutage gibt es doch jede Menge arbeitslose Akademiker«, sagte er. »Und Scott möchte Laurie eines Tages zu seiner Nachfolgerin auf dem Gnadenhof machen. Sie hat sich entschieden, jetzt hier zu leben. Und ich glaube, es war eine gute Entscheidung.«
Er umarmte mich zum Abschied und fügte hinzu: »Nur schade, dass wir so weit voneinander entfernt sind.«
»Ihr müsst wiederkommen!«, sagte ich. »Jeden Sommer. Es hat euch doch so gut gefallen und ihr habt euch wunderbar erholt.«
Wie gern hätte ich meinen Vater hier behalten! Genau wie ich passte er viel besser ins Hochland, in die freie Natur, als in das enge Münchner Reihenhaus zwischen winzigen Grasvierecken und Straßen, auf denen der Verkehr Tag und Nacht brandete und lärmte.
»Sie kommen nächstes Jahr wieder, da bin ich sicher!«
Onkel Scott versuchte mich zu trösten, denn meine Augen standen voller Tränen, als die beiden durch den Zoll des Flughafens in Aberdeen verschwanden.
»Ja, aber... warum können Menschen, die zusammengehören, nicht am gleichen Ort wohnen? Warum muss man erst so weite Strecken überwinden, um sich zu sehen?«
Er legte den Arm um meine Schulter und drückte mich an sich. »Viel schlimmer als die räumlichen Entfernungen sind die inneren, Laurie. Viele Menschen leben eng zusammen und sind innerlich doch meilenweit voneinander entfernt.«
Wir fuhren durch die Hügel zurück, auf denen die Heide wie ein tief violetter Teppich blühte. In meine Traurigkeit darüber, dass meine Eltern jetzt fort waren und dass ich sie wohl lange nicht wiedersehen würde, mischte sich Erleichterung. Ich konnte hier bleiben, durfte nach The Laurels zurückfahren. Keiner hatte mich gezwungen, ins Flugzeug zu steigen und Schottland unter den Wolken verschwinden zu sehen.
»Ein Glück, dass du hier bleiben kannst«, sagte Onkel Scott wie ein Echo auf meine Gedanken und wich einem schwarzweißen Schaf voller Dreadlocks aus, das mitten auf der Straße stand und gemütlich kaute.
»Ich glaube, ich würde eingehen wie eine Primel, wenn ich wieder in der Stadt leben müsste, ohne dich und die Pferde.«
»Und vor allem ohne Danny.«
»Ja, vor allem ohne Danny.« Das konnte ich jetzt so offen sagen, ohne dass Onkel Scott sich ärgerte oder verletzt war. Inzwischen mochte er Danny. Das war nicht immer so gewesen.
Das Abendlicht hüllte die Bergkuppen und den Gipfel des Ben Wyvis in einen rosigen Schimmer und der Duft von Heide, Moorwasser und Thymian strich durchs geöffnete Wagenfenster. Ich schloss die Augen; da sagte Onkel Scott unvermittelt: »Laurie, was würdest du davon halten, wenn Moragh – Mrs. MacClintock – zu uns ziehen würde? Wäre dir das recht?«
Moragh MacClintock war Dannys Mutter. Sie und meinen Onkel verband eine alte und schwierige Liebesgeschichte.
»Natürlich!«, erwiderte ich. »Ich fänd’s gut. Du brauchst mich doch nicht um Erlaubnis zu fragen!«
»Aber du lebst mit mir zusammen. Du bist inzwischen wie eine Tochter für mich. Ich möchte nichts über deinen Kopf hinweg tun.«
Ich legte eine Hand auf die seine. »Ich freu mich doch für dich!«, versicherte ich. »Sie ist eine wunderbare Frau. Nicht nur, weil sie Dannys Mutter ist. Wollt ihr heiraten?«
Er sah rasch zu mir herüber. Ein Lächeln stand in seinen grauen Augen. »Nein, so tollkühn sind wir nicht. Wir wollen erst mal schauen, wie wir miteinander auskommen. Man kann ja auch ohne Trauschein ganz gut zusammenleben. Und in unserem Alter heiratet man nicht mehr so leicht.«
Ich überlegte, ob Danny es schon wusste. Bisher hatten er und seine Schwester Sheila mit ihrer Mutter auf Braeside gelebt, ganz in unserer Nähe.
»Es wird schön sein, sie im Haus zu haben«, sagte ich.
»Ja, sicher. Und für dich wird dadurch auch manches einfacher. Du musst nicht mehr so viel Zeit in der Küche verbringen. Ich hoffe, dass wir’s in Zukunft ein bisschen ruhiger und gemütlicher haben werden, wenn wieder eine Frau in The Laurels ist.«
Das klang so sachlich, als hätte er eine Haushälterin eingestellt. Doch ein Unterton schwang in seiner Stimme mit, der mir verriet, wie glücklich er war.
»Ich werde den Wintergarten und das angrenzende Zimmer für Moragh herrichten lassen«, sagte er. »Der Wintergarten war früher so ein hübscher Raum, als deine Tante Anne noch lebte, mit all den Pflanzen und den hellen Korbmöbeln. Wir haben ihn viel benutzt und fast täglich da gefrühstückt.«
Tante Anne war Onkel Scotts Frau gewesen, die Schwester meiner Mutter. Ich dachte an seine Bemerkung über Ruhe und Gemütlichkeit, als wir ins Haus zurückkamen. Die Küche war voll mit schmutzigem Geschirr und ungespülten Töpfen und Pfannen. Meine Mutter hatte mittags noch für uns gekocht, doch zum Aufräumen war keine Zeit mehr gewesen.
Kater MacDuff kam uns entgegen und verlangte heftig maunzend nach seinem Futter. Die Katze Emma kauerte auf dem Fensterbrett und sah uns mit ihren großen, immer noch scheuen Augen fragend an. Sie hatte sich lange Zeit allein durchschlagen müssen, und die tägliche Fütterung bei uns war wohl immer noch eine unsichere, durchaus nicht selbstverständliche Sache für sie.
MacDuff aber maunzte so laut, bis ich die beiden Katzenschälchen gefüllt hatte. Rascal und Dart, die Hunde, stürmten ins Haus, begrüßten uns hechelnd und wollten ebenfalls gefüttert werden. Obwohl ich Durst hatte, kam ich nicht dazu, mir Saft aus dem Keller zu holen.
Onkel Scott wühlte in den Klamotten, die auf dem Sofa lagen, und brummte: »Hast du meine graue Strickjacke gesehen?«
»Die ist in der Wäsche«, sagte ich. »Rascal hat drauf gesessen.«
»Das macht doch nichts. Deshalb muss man sie nicht gleich waschen.«
»Er hatte sich vorher in Kaninchendreck gewälzt.«
Wir mussten lachen.
Ich rannte die Treppe hoch, um mich umzuziehen. Als ich den Kopf durchs Fenster streckte, sah ich, dass Allan und Annika schon damit beschäftigt waren, die Futtereimer mit Schubkarren zu den Koppeln zu fahren. Die Pferde drängten sich hinter dem Gatter. Über dem Heathery Hill zogen wieder einmal Regenwolken auf.
Die Pferde wieherten. Ich hörte Dandys dunkle Stimme heraus, untermalt von Belles Trompetengewieher, das immer einen entrüsteten Ton hatte, wenn die Futterzeiten nicht genau eingehalten wurden.
Meine Gummistiefel, die am Fuß der Vortreppe standen, waren nass vom letzten Regenschauer. Ich goss ein bisschen Wasser aus und schlüpfte barfuß hinein. Onkel Scott kam mir vom Futterschuppen her entgegen, als ich um die Ecke des Wintergartens bog.
»Der geschrotete Mais ist ausgegangen«, sagte er. »Vom Quetschhafer ist auch nicht mehr allzu viel da. Ich nehme den Transporter und fahre rasch zur Mill Farm. Brauchen wir Mehl?«
Ich nickte. »Und frische Milch. Und Eier, wenn sie noch welche haben.«
Ginger, unsere alte Stute, mit der ich manchmal ausritt, und der Jährling Bairnie kamen mir innerhalb des Koppelzauns entgegen. Ich nahm mir einen Augenblick Zeit, ihre Köpfe zu streicheln und mein Gesicht an Bairnies schmutzige Nase zu drücken. Er war mein besonderer Liebling.
Hinter dem Haus wurde der Lastwagen gestartet. Ich sah mich nach den Hunden um. Wahrscheinlich saßen sie neben Onkel Scott auf dem Beifahrersitz und fuhren mit nach Mill Farm. Die beiden liebten Autofahrten, auch wenn sie noch so kurz waren.
Annika erwartete mich am Gatter. »Kannst du Nutmeg füttern?«, fragte sie hastig. »Die anderen fressen ihm sonst wieder alles weg. Ich hol schon die nächste Fuhre.«
Ich nahm ihr den Eimer ab und wartete, den Arm um Nutmegs Hals gelegt, während er seine Nase im Hafer versenkte. Er war eines der ersten Pferde, die Onkel Scott in The Laurels aufgenommen hatte. Es gab immer wieder Menschen, die meinten, ein blindes Pferd wie Nutmeg sollte besser getötet werden, damit es von seinen »Leiden« erlöst wurde. Sie kannten Nutmeg eben nicht wie wir, seine Art, die Nase in den Wind zu heben und nach fremden Gerüchen zu schnuppern, seine Dankbarkeit für jede liebe Geste, jedes zärtliche Wort, seine Freundschaft mit der Stute Fairy Queen. Er konnte zwar nicht mehr sehen, aber er freute sich noch am Leben, er genoss die guten Jahre hier auf den Koppeln der Highlands, nachdem er es früher sehr schwer gehabt hatte. So war es mit den meisten unserer Pferde, auch wenn wir nur wenig über ihr früheres Schicksal wussten.
»Vielleicht ist es gut, dass sie nicht reden können«, sagte Onkel Scott manchmal. »Wenn man von all dem Leid und Elend wüsste, das ihnen widerfahren ist, könnte man nicht mehr ruhig schlafen.«
Während Nutmeg die letzten Haferkörnchen aus dem Eimer leckte, kam Allan. »Ist Mr. Montrose nochmal weggefahren?«, fragte er.
»Zur Mill Farm, ja, um Mais und Quetschhafer zu holen.«
»Hat er Rian mitgenommen?«
»Nein, wieso? Ich dachte, er ist hier.«
»Vor einer halben Stunde war er noch im Futterschuppen und hat die Portionen abgemessen, aber jetzt ist er verschwunden.«
Dandy schob seine taubengraue Nase über meine Schulter. Ich streichelte ihn mit der einen Hand und Nutmeg mit der anderen. »Im Haus war er nicht«, sagte ich.
Allan zog die Brauen zusammen. Eine dunkle Locke fiel ihm in die Stirn. Unvermittelt wandte er sich ab und ging mit langen Schritten davon, während ich eine der Schubkarren nahm und mich damit auf den Weg zum Futterschuppen machte.
Als ich am Stall vorüber kam, sah ich, dass die Seitentür nur angelehnt war. Dahinter glaubte ich einen Schatten zu erkennen. War es eine der Katzen? Die Pferde waren alle auf der Weide, auch nachts; um diese Jahreszeit wurde der Stall nicht benutzt. Unwillkürlich blieb ich stehen, stellte die Schubkarre ab und ging zur Tür.
Fast hätte ich ihn übersehen. Er kauerte wie ein verletztes Tier in der Streu, an eine Boxwand gedrückt, und bewegte sich nicht. Erschrocken starrten wir uns an.
»Rian!«, sagte ich. »Was machst du denn hier? Was ist passiert?«
Dann erst bemerkte ich, wie seltsam verkrümmt er dasaß. Er hielt seinen rechten Oberarm vor der Brust und stützte den Ellbogen mit der linken Hand. Seine Lippen waren fest zusammengepresst. Rasch ging ich zu ihm.
»Hast du dich verletzt?«
Wie sein Bruder Allan war auch Rian daran gewöhnt, Schmerz, Kummer oder Angst mit sich allein abzumachen. Die beiden hatten nie fürsorgliche Eltern gehabt. Ihr Vater war schon vor Jahren spurlos verschwunden, die Mutter trank. Allan, der älteste Sohn, hatte versucht, den fünf Geschwistern so gut wie möglich den Vater zu ersetzen und die Mutter davor zu bewahren, dass sie völlig dem Alkohol verfiel. Die schwierige Kindheit hatte Allan und Rian geprägt und ihre Spuren bei beiden hinterlassen.
Ich kniete neben ihm nieder. »Zeig«, sagte ich behutsam.
Dann sah ich es. Sein Flanellhemd war zerrissen, der Oberarm dick angeschwollen. Unter dem Riss war die Haut blutrot und glänzte unnatürlich. Es musste verteufelt wehtun.
»Mist! War’s eins von den Pferden?«
Rian nickte stumm. Am Ausdruck seiner scheuen braunen Augen merkte ich, wie sehr er sich zusammennehmen musste, um nicht zu weinen. Er war immerhin erst dreizehn. Doch irgendjemand – Allan vermutlich – hatte ihm beigebracht, dass ein Junge tapfer zu sein hat und die Zähne zusammenbeißen muss.
Vorsichtig fasste ich nach seinem gesunden Arm und zog ihn hoch. »Komm mit ins Haus«, sagte ich. »Wir machen Umschläge mit Essigwasser, dann wird’s gleich besser.« Meine Befürchtung, dass er sich den Arm gebrochen haben könnte, verschwieg ich.
Widerstrebend folgte er mir. »Wir dürfen Allan nichts sagen«, murmelte er. »Er wäre bestimmt total sauer auf mich, weil ich auf der kleinen Koppel war.«
Auf der kleinen Koppel, bei Rae und Owlie! Den beiden schlimmsten Rabauken unserer Herde, die nur von Onkel Scott oder Allan versorgt werden durften!
Ich wollte fragen, wer ihn auf die hirnrissige Idee gebracht hatte, zu den beiden auf die Weide zu gehen, obwohl sein Bruder es ihm ausdrücklich verboten hatte. Dann aber dachte ich, dass es sinnlos war, ihm eine Predigt zu halten. Er hatte schon genug für seinen Leichtsinn gebüßt. So sagte ich nur: »Wir können es nicht vor ihm verheimlichen, Rian. Du wirst einige Zeit nicht arbeiten können. Du wirst deinen Arm wahrscheinlich in einer Schlinge tragen müssen.«
Erst jetzt füllten sich seine Augen mit Tränen. Er stieß ein unterdrücktes Stöhnen aus. »Und Mr. Montrose?«, flüsterte er. »Er wird mich sicher rauswerfen.«
»Nein, das wird er bestimmt nicht!« Ich legte den Arm um seine schmalen Schultern. »Er mag dich, das weißt du doch. Erst kürzlich hat er gesagt, dass du das richtige Gespür für Pferde hast und der geborene Pferdepfleger bist.«
Rian ließ den Kopf hängen. »Aber jetzt... jetzt wird er denken, dass ich unzuverlässig bin und ein verdammter Idiot...« Seine Stimme zitterte vor unterdrücktem Schluchzen.
»Blödsinn! Die meisten von uns haben schon mal einen Schlag von einem Pferd abgekriegt. Ehe ich herkam, ist mein Onkel in die Hand gebissen worden. So was bleibt nicht aus, wenn man mit schwierigen Pferden zu tun hat. Keine Panik, ich lass dich nicht allein. Und Allan wird dir schon nicht den Kopf abreißen.«
»Du kennst ihn nicht!«
Ich musste lachen. »Doch«, sagte ich, »ich kenne ihn sogar sehr gut. In den ersten Monaten hätte ich ihn am liebsten auf den Mond geschossen. Er kann ein richtiges Ekelpaket sein. Aber er hat’s nicht immer leicht gehabt. Seit ich das weiß, stört es mich nicht mehr so sehr, wenn er wie ein Zombie rumläuft. Und seine Wutanfälle nehme ich längst nicht mehr so persönlich.«
Ich war bereit, Rian mit Zähnen und Klauen zu verteidigen wie eine Löwenmutter ihr Junges, denn ich hatte eine besondere Schwäche für ihn. Er war so liebenswert und verletzlich und unschuldig wie ein junges Tier. Zum Glück stellte es sich heraus, dass ich mich seinetwegen nicht mit Allan anlegen musste.
»Wehe, wenn du dir den Arm gebrochen hast!«, sagte er zu seinem Bruder, doch ich sah ihm an, dass er eher besorgt als wütend war.
Wir setzten Rian aufs Küchensofa, schnitten seinen Hemdärmel auf und sahen uns seinen Arm genauer an. Er war dick geschwollen und scheußlich blaurot verfärbt. Ein halbmondförmiger dunkler Streifen war vom Abdruck des Hufes geblieben.
»Wir müssen froh sein, dass Rae dich nicht am Kopf getroffen hat«, murmelte ich. Denn es war Rae gewesen, das wussten wir jetzt. Der dunkle Wallach schlug aus, wenn man es am wenigsten erwartete. Man durfte ihn keinen Moment aus den Augen lassen, wenn man in seiner Nähe war.
Ich machte einen Umschlag mit Essigwasser für Rian. Er schloss die Augen und sah richtig elend aus. Sicher wartete er darauf, dass ein furchtbares Strafgericht über ihn hereinbrach, wenn Onkel Scott nach Hause kam.
Als wir den Lastwagen vorfahren hörten, zuckte Rian zusammen und wurde noch blasser. Ich strich ihm übers Haar und sagte: »Keine Angst, Laddie. Ich rede gleich mit ihm.«
Draußen stand Annika mit der Sackkarre und half meinem Onkel beim Ausladen.
»Rae hat Rian getreten«, sagte ich ohne lange Einleitung. »Er hat ihn am Oberarm erwischt. Jetzt denkt der arme Lad natürlich, dass du ihn feuerst oder ihm zumindest eine riesige Strafpredigt hältst.«
Onkel Scott seufzte. »Ist der Arm gebrochen?«
»Ich glaube nicht. Er kann ihn normal bewegen, und durch die Essigwasserumschläge sind die Schmerzen schon etwas besser geworden.«
»Ich hab’s Rae heute schon an der Nasenspitze angesehen, dass er eine Stinklaune hat«, warf Annika ein.
»Wie kommt der Junge nur auf die Idee, zu den beiden auf die Koppel zu gehen?«, fragte Onkel Scott.
»Vermutlich war’s eine Art Mutprobe. Er wollte sich wohl beweisen, dass er keine Angst vor ihnen hat.«
»Das hätte übel ausgehen können. Ich sehe mir den Arm mal an; vielleicht müssen wir zu Doktor O’Toole fahren.«
»Aber sei nett zu ihm, ja? Schimpf ihn nicht. Der Arme ist total fertig.«
»Ich werd ihm schon nicht den Kopf abreißen.«
Annika und ich wanderten hinter Onkel Scott her in die Küche.
Allan sagte gerade etwas von »krassem Schwachsinn«, während er den Umschlag ins Essigwasser tauchte. Ich versuchte Rian einen aufmunternden Blick zuzuwerfen, doch er sah mich nicht an, saß nur da, die Lippen zusammengepresst, und schien vor Schreck wie gelähmt.
»Mach nicht so ein Gesicht, Laddie«, sagte Onkel Scott. »Ich hab selbst schon dümmere Sachen angestellt, als ich in deinem Alter war. Lass mich mal sehen! Ich hoffe, der Knochen ist heil geblieben.«
Rian flüsterte: »Es ist schon viel besser! Laurie und Allan haben Umschläge gemacht. Sie sind mir nicht böse?«
»Nein, absolut nicht.«
Vorsichtig tastete mein Onkel Rians Oberarm ab. Er gab keinen Mucks von sich. Wahrscheinlich hätte er nicht mal geschrien, wenn man ihn mit glühenden Eisen gezwickt hätte.
»Nach einem Bruch sieht es nicht aus. Wir warten mal bis morgen. Wenn die Schmerzen schlimmer werden, musst du sofort Bescheid sagen, dann holen wir den Arzt.«
»Nein, nein!« Rian sah ihn entsetzt an. »Ich brauch keinen Arzt! Das kostet so viel Geld. Es heilt von selbst wieder. Und ich kann auch arbeiten – mit der linken Hand geht es schon...«
Onkel Scott lächelte. »Ein paar Tage lang machst du erst mal überhaupt nichts und schonst deinen Arm. Wir tun ihn in eine Schlinge. Und dann gebe ich dir ein paar von meinen alten Jugendbüchern. Mit denen setzt du dich ins Gras und liest. Das ist die beste Medizin. Wetten, dass du bald wieder in Ordnung kommst?«
Ich hätte ihn küssen mögen.
Allan sagte: »Ich arbeite zum Ausgleich jeden Tag zwei Stunden mehr und nehme auch meinen freien Tag nicht, bis Rian wieder okay ist. Vielen Dank, Mr. Montrose.«
»Dummes Zeug! Wir helfen alle zusammen, dann geht es schon. Ich bin schließlich kein Sklaventreiber«, erwiderte Onkel Scott. »Laurie, haben wir die Calendula-Salbe noch im Arzneischrank?«
»Ich sehe mal nach.«
»Damit machst du Rian einen Salbenverband, damit der Arm nachts nicht so tobt.«
Annika hatte angefangen, Eier und Milch mit dem Schneebesen zu verquirlen. »Es gibt Pfannkuchen«, verkündete sie. Pfannkuchen mit Sirup waren Rians Lieblingsessen. »Allan, holst du mal das Mehl aus dem Laster?«
Wortlos ging er aus der Küche. Annika war die Einzige, die ihn gelegentlich herumkommandieren durfte.
Im Arzneischrank lag wie üblich alles wild durcheinander – Wurmpaste für die Pferde, Aspirin, Jodtinktur, Mullbinden, Salbe gegen Hufrollenentzündung, jede Menge Fläschchen mit homöopathischen Kügelchen, Kräutertees von Will, dem Schäfer, Onkel Scotts Herztabletten.
»Ewig dieses verdammte Chaos!«, schimpfte ich. »Wer hat wieder alles durcheinander gewühlt? Kann in diesem Haus nie etwas an der richtigen Stelle liegen?«
Gerade als mein Blick auf eine Tube fiel, in der ich die Calendula-Salbe vermutete, klingelte das Telefon. Ich griff nach der Tube und lauschte. Es läutete drei Mal, vier Mal, aber keiner ging hin. Mit der Tube in der Hand rannte ich die Treppe hinunter in die Halle und machte einen Hechtsprung zum Telefon. Vielleicht waren es meine Eltern. Sie mussten inzwischen in München gelandet sein.
Es war Danny. Ich erkannte seine Stimme kaum, so gepresst klang sie.
»Laurie«, sagte er, »irgendwas stimmt mit den Schafen nicht! Heute Morgen lagen drei total matt und teilnahmslos im Gras und haben nicht gefressen. Inzwischen sind es schon zehn Tiere. Ich fürchte, wir haben eine Seuche.«
Eine Schafseuche! Das war das Schlimmste, was Danny und seiner Familie passieren konnte; sie lebten ja von der Schafzucht. Mir wurde kalt vor Schreck.
»Hast du Doktor Drury angerufen?«, fragte ich.
»Ja, er ist schon unterwegs.«
»Und Will? Kannst du nicht Will holen?«
»Der ist irgendwo in den Bergen. Ich hab keine Ahnung, wo wir ihn suchen sollen.«
Ich zerbrach mir den Kopf nach einem Trost, aber mir fiel nichts ein. Armer Danny! Sein Leben war ein ewiger Kampf mit Geldmangel, kranken Schafen, schlechten Wollpreisen, reparaturbedürftigen Ställen, Schneestürmen und steigenden Unkosten. Mit seinen fast neunzehn Jahren hatte er schon mehr Sorgen und Probleme zu bewältigen als sehr viele Erwachsene.
»Soll ich zu dir rüberkommen?«, fragte ich.
»Später vielleicht. Jetzt weiß ich sowieso nicht, wo mir der Kopf steht. Ich wollte nur deine Stimme hören.«
Bedrückt legte ich auf. Während ich Rian den Salbenverband anlegte und Annika den Pfannkuchenteig in die Pfanne gab, kam Onkel Scott. Er setzte sich an den Küchentisch und faltete seine Zeitung auseinander.
»Die MacClintocks fürchten, dass in ihrer Herde eine Seuche ausgebrochen ist«, sagte ich mit düsterer Stimme. »Sie haben schon zehn kranke Schafe.«
Er ließ die Zeitung sinken. »Heiliger Himmel! Was sagt Doktor Drury?«
»Er war noch nicht da, soll aber heute noch nach Braeside kommen.«
Wir wechselten einen Blick und mein Onkel schüttelte den Kopf. »Die Schafzucht ist sowieso kein lohnendes Geschäft mehr. Die Wollpreise sind im Keller, die Versicherung gegen Seuchen ist so hoch, dass sie kaum ein Farmer zahlen kann. Vielleicht sollte Danny die Schafzucht aufgeben und sich umstellen.«
»Ja, vielleicht«, erwiderte ich, »aber worauf?«
Rian bekam den ersten Pfannkuchen. Er war so groß, dass er über den Tellerrand hing.
Annika bestrich ihn dick mit Sirup. »Als Seelentrösterli«, sagte sie auf Deutsch.
Ich hatte keinen Appetit, aber Annika zuliebe aß ich einen von den kleineren Pfannkuchen. Dann klingelte wieder das Telefon. Ich stürmte in die Halle, weil ich dachte, es wäre Danny, aber diesmal waren es meine Eltern. Sie sagten, dass sie gut angekommen seien und sich nochmal bei Onkel Scott für die schönen Ferien bedanken wollten.
Gegen halb zehn wählte ich die Nummer von Braeside.
Sheila, Dannys Schwester, war am Apparat. »Doktor Drury ist vor einer Viertelstunde weggefahren«, erzählte sie. »Er musste allen kranken Schafen Antibiotika spritzen. Vermutlich ist es eine neue Seuche, die aus Neuseeland eingeschleppt wurde. Ein Farmer in Stranrear hat schon seine halbe Herde verloren.« Ihre Stimme war erschöpft und mutlos. »Wir wissen nicht mal, wie wir die Tierarztrechnung bezahlen sollen, Laurie.«
»Ich rede mit Onkel Scott. Er wird euch helfen.«
»Das will Danny nicht, das weißt du doch. Er ist viel zu stolz, um auch nur einen Penny von deinem Onkel anzunehmen.«
»Dann gebe ich euch das Geld. Ich hab was gespart. Ich verdiene doch dauernd Geld und kann hier draußen nichts ausgeben.«
Shee sagte: »Du bist ein Schatz. Aber auf Dauer geht es echt nicht mehr so weiter. Wir müssen uns etwas überlegen. Wir stopfen das eine Loch und machen das andere wieder auf. So geht es schon seit Jahren.«
Traurig und ratlos ging ich ins Bett. Der Wind fegte Regenböen gegen die Fensterscheiben. Rascal, der Terrier, lag zu meinen Füßen auf der Bettdecke und schnaufte zufrieden. Ich dachte an Danny und die Schafe, an Rians Arm, an meine Eltern und dann wieder an Danny.
Warum war das Leben nur manchmal so verteufelt schwierig?
2
Die Wunde an Rians Arm schillerte in allen Regenbogenfarben, aber die Schwellung war etwas zurückgegangen. Er behauptete, es täte kein bisschen mehr weh. Zur Morgenfütterung tauchte er im Futterschuppen auf und wollte mithelfen, wurde aber von Onkel Scott ins Haus zurückgescheucht.
»Du kannst den Frühstückstisch decken«, sagte er. »Aber schön langsam und vorsichtig. Und dann bleibst du auf dem Sofa sitzen und liest Ivanhoe von Walter Scott. Ich hab das Buch schon für dich herausgesucht; es liegt auf dem Fensterbrett.«
Es war ungemütlich kühl und windig an diesem Morgen und die nächste Regenwolke tauchte schon über dem Heathery Hill auf. Während ich den geschroteten Mais an die älteren Pferde verfütterte, die schlechte Zähne hatten, und Dandy sein Spezialfutter gab, überlegte ich, wie ich es anstellen sollte, nach dem Frühstück zu Danny zu reiten. Eigentlich war ich heute an der Reihe, auf Bulls Field, einer der Koppeln, den Mist abzusammeln.
»Du kannst ruhig mal für zwei Stunden verschwinden«, sagte Annika. »Ich springe für dich ein, ist doch klar.«
Rasch umarmte ich sie. »Sag deinem Danny Boy schöne Grüße«, fügte sie noch hinzu. Das war lieb und großzügig von ihr, denn sie und Danny hatten für gewöhnlich keinen besonders guten Draht zueinander.
Ich holte Dandy von der Weide und sattelte ihn beim Stall; und als wir über den Koppelpfad ritten, kam Ginger zum Zaun und wieherte vorwurfsvoll. Sie war daran gewöhnt, dass ich mit ihr ausritt, wenn Dandy besonders starke Probleme mit der Atmung hatte; und sie liebte diese Spazierritte, das wusste ich.
»Nächstes Mal bist du wieder dran, altes Mädchen!«, rief ich ihr zu. »Dandy braucht Bewegung, er wird sonst zu dick.«
Dandy ging es gut an diesem Morgen. Er litt an Kehlkopfpfeifen und durfte sich nicht anstrengen. Manchmal bekam er ganz gut Luft, so wie heute, man hörte dann nur einen ganz leichten Pfeifton beim Einatmen.
Mit seinem schönen taubenblaugrauen Fell und seinem sanften Wesen war er von Anfang an mein besonderer Liebling gewesen. Inzwischen wusste ich, dass man zu verschiedenen Tieren unterschiedliche Beziehungen entwickeln kann. Der blinde Wallach Nutmeg löste andere, fast mütterliche Gefühle in mir aus als der bedächtige Dandy oder der übermütige, koboldhafte Jährling Bairnie, das pummelige, treuherzige Shetty Brownie oder die alte Stute Belle, die dankbar für jedes gute Wort und jede liebevolle Berührung war.
Auf dem Heathery Hill war die Heide fast schon verblüht. Die Hänge und Mulden schimmerten violett und rostfarben unter den rasch dahintreibenden Wolken. Wir ritten am Efeubaum vorbei, einer fast kahlen, uralten Eiche, die ganz von Efeu umrankt war. In ihrem Stamm gab es ein Versteck, eine Höhlung, die Danny und ich einst als eine Art Briefkasten für unsere heimlichen Botschaften benutzt hatten.
Das war im vergangenen Jahr gewesen, als Onkel Scott noch nichts davon wissen durfte, dass wir uns ineinander verliebt hatten.
Ich dachte an die alte Feindschaft zwischen den Montroses und den MacClintocks, die sich inzwischen auf so wunderbare Weise in Wohlgefallen aufgelöst hatte. Lange Zeit hatte ich nicht daran geglaubt, dass mein Onkel Danny je seine Herkunft verzeihen und ihm sogar erlauben würde, The Laurels zu betreten.
Das Wäldchen, das The Laurels von Braeside trennte, war noch feucht vom letzten Regenschauer und duftete nach Moos, Farnkraut und wildem Geißblatt. Eine ganz besondere, feierliche Stille herrschte hier, und ich dachte wieder einmal, dass dies ein magischer Ort sein musste, einer von den Grenzbereichen zwischen der diesseitigen Welt und einer jenseitigen – der »Anderwelt« der Kelten, in der die Feen lebten.