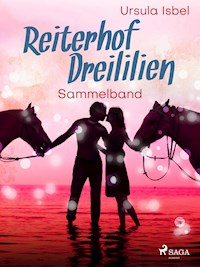Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pferdeheimat im Hochland
- Sprache: Deutsch
Lissy meets PETA: Eine ungewöhliche Geschichte über Freundschaft und die Arbeit auf einem Gnadenhof. Pferdenärrin Laura hat sich inzwischen auf dem Gnadenhof ihres Onkels eingelebt, als zwei Neuankömmlinge auf den Hof gebracht werden: eine Mutterstute und ein unterernährtes Fohlen. Und für Laura ist sofort klar, dass sie alles tun wird um Bairnie am Leben zu halten. Doch nicht nur das Fohlen macht Laura Sorgen, sondern auch die Tatsache, dass ihr Onkel nach wie vor gegen die Freundschaft mit dem Nachbarjungen Danny ist, da die beiden Familien seit Jahren im Streit liegen. Doch dann hat Laura einen schlimmen Reitunfall ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel
Pferdeheimat im Hochland - Fionas Fohlen
Saga
Pferdeheimat im Hochland - Fionas Fohlen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1990, 2021 Ursula Isbel und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726877366
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
1
Der Hochlandmorgen dämmerte mit Dunstschwaden über den Koppeln. Hinter einer wabernden weißgrauen Wand waren die Bergketten verborgen, doch noch während ich aus dem Fenster sah, kam irgendwo zwischen den Schleiern eine bleiche Sonne hervor. Auf den Koppeln lösten sich vereinzelte Baumgruppen und die Köpfe oder Beine von Pferden aus dem Dunst, seltsam wie ein Gemälde von Dalí oder eine Szene aus einer Spukgeschichte.
Die Morgenluft war rau und ich fröstelte; doch ich liebte den Hochlandwind, der den Duft von Kräutern und schottischer Heide, Harz, Moorwiesen und Meeresbuchten über die Berge und Hügel trug; ein Wind, auf dem die Möwen segelten, der nachts an den Fenstern rüttelte und in den alten Bäumen säuselte und brauste, die das Haus umstanden. Oft sang er mich abends in den Schlaf und weckte mich morgens wieder; dann kam es vor, dass ich minutenlang im Bett lag, verwundert lauschte und auf den Lärm von Autos, Flugzeugen und Nachbarn wartete, bis ich begriff, dass ich nicht mehr in München war, im Haus meiner Eltern, sondern bei Onkel Scott in den Highlands, wo man viel eher ein Pferd wiehern als ein Auto hupen hörte.
Ich sah auf die Uhr. Es war kurz nach sechs, eine Zeit, zu der ich zu Hause nur unter wütendem Protest aufgestanden wäre. Doch hier begann mein Tag früh. Ich ging ins Badezimmer, in dem Onkel Scott die übliche Unordnung hinterlassen hatte. Er konnte sich nirgends aufhalten, ohne Kleidungsstücke und sonstige Gegenstände so großzügig um sich zu verstreuen wie früher ein Sämann seine Körner. Doch immerhin war die Schmutzwäsche verschwunden, die bei meiner Ankunft das Bad überschwemmt hatte, und Mrs. Kirkish hatte Badewanne und Fliesen gescheuert und den Boden geschrubbt. Der Wasserhahn aber tropfte wie eh und je und keiner hatte sich Zeit genommen, den zerbrochenen Lampenschirm über dem Waschbecken gegen einen neuen auszutauschen.
Eine dicke schwarze Spinne war aus dem Efeu heraus durchs Fenster gekrochen und hatte sich in der Wanne breit gemacht. Onkel Scotts Kamm, der nur noch sieben Zähne hatte, lag auf dem Boden in trautem Verein mit einer löchrigen Wollsocke und einem Handtuch, das aussah, als hätte jemand ein Pferd damit trocken gerieben.
»Junggesellenwirtschaft! Saustall!«, schimpfte ich, bückte mich und sammelte alles auf. Doch ich lächelte dabei, denn ich war glücklich. Seit mehr als einer Woche könnte nichts meinen Zustand von totaler Seligkeit erschüttern. Ein böswilliger Zeitgenosse wie mein Bruder Tim hätte vielleicht behauptet, ich würde herumflattern und gackern wie ein mondsüchtiges Huhn.
Ich aber hatte das Gefühl, auf Wolken zu wandeln, und hätte am liebsten jeden umarmt, der mir in die Quere kam; ein Zustand, von dem einmal ein englischer Dichter gesagt haben soll: »Es ist, als gingen die Götter vorbei.«
An mir waren sie vorbeigegangen. Denn ich war in Danny MacClintock vom Nachbarhof verliebt und Danny in mich.
Beim Gedanken an Danny begann ich zu singen, schob die Spinne sacht in ein Mundwasserglas und kippte sie in den Efeu, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Denn in meinem Überschwang liebte ich die ganze Welt und ekelte mich nicht einmal vor einem behaarten, langbeinigen Ungeheuer wie dieser Spinne, der ich mich normalerweise nicht einmal mit Schutzhandschuhen genähert hätte.
Rascal, der graue Terrier, wartete vor der Badezimmertür auf mich. Er begrüßte mich mit Luftsprüngen und freudigem Jaulen, erleichtert darüber, dass ich mich weder heimlich aus dem Staub gemacht hatte noch durchs Abflussrohr gespült worden war.
Ich sang »Martha, Martha, du entschwandest!«, als ich in die Küche kam, wo Onkel Scott am Herd stand und Speck und Eier in der Pfanne briet.
Kater MacDuff thronte majestätisch auf dem Sofa; er kniff die Augen zusammen und begann zu schnurren, als er mich sah. Der gefleckte Jagdhund Dart kam schwanzwedelnd unter dem Tisch hervor und drückte den Kopf gegen meine Knie.
An meinem Onkel waren die Götter nicht vorbeigegangen oder jedenfalls seit langem nicht mehr.
»Morgen, Laurie«, brummte er und nieste.
»Hallo, Onkel Scott!«, sagte ich sonnig. »Ist dein Schnupfen noch nicht besser?«
Er murmelte etwas Undeutliches. Onkel Scott hatte eine tiefe Abneigung dagegen, krank zu sein. Er gehörte zu den Leuten, die erst den Kopf unter dem Arm tragen müssen, um zuzugeben, dass sie sich schlecht fühlen.
Sein Gesicht war rot, seine Augen glänzten fiebrig. Ich fragte, ob er Temperatur gemessen hätte, worauf er mir einen Vortrag hielt, wie unsinnig das sei.
»Wenn man Fieber hat, hat man Fieber; das merkt man auch ohne Thermometer«, sagte er.
»Man sollte aber feststellen, wie hoch das Fieber ist, damit man weiß, wann man sich ins Bett legen und einen Arzt holen muss«, erwiderte ich sanftmütig.
»Ich brauche keinen Arzt«, erwiderte Onkel Scott. »Vor Jahren, als ich noch Lehrer war und diese Herzgeschichte hatte, war ich so oft bei diesen Quacksalbern, dass es für mein ganzes Leben reicht.«
Aus dem Radio kam militärische Dudelsackmusik und dann die Mitteilung, dass die englische Königin Schloss Balmoral verlassen hatte, was der Sprecher mit dem Ende dieses Sommers gleichsetzte.
Onkel Scott schnaubte. »Verdammtes, hirnrissiges Geschwätz!«, brummte er. »Als ob die schottischen Jahreszeiten sich nach irgendwelchen Königen richten würden! «Die Grippe hatte ihm offensichtlich ganz und gar die Laune verdorben.
Ich beschloss, Shortbread Fingers für ihn zu backen; das war immer ein gutes Mittel, um ihn aufzuheitern. Doch jetzt blieb dazu keine Zeit. Die Pferde warteten auf ihr Morgenfutter und da Allan, der Pferdepfleger, heute seinen freien Vormittag hatte, gab es für Onkel Scott und mich mehr Arbeit als sonst.
Ich stürzte meinen Kaffee hinunter, aß ein Marmeladenbrot, griff nach einer Banane und stürmte mit Dart und Rascal aus dem Haus, während Onkel Scott hinter mir her rief, er käme gleich nach, er müsse nur noch mit der Mühlenfarm wegen der Haferlieferung telefonieren.
Als ich am Wintergarten vorbeikam, der mit seinen zerbrochenen Glasscheiben und den Spinnweben noch immer im Dornröschenschlaf vor sich hin dämmerte, dachte ich an Danny. In letzter Zeit tat ich kaum noch etwas anderes; sogar nachts träumte ich von ihm, wie er mit seinen Schafen über die Hügel zog oder auf dem Gatter zwischen Weißdornsträuchern saß und mich mit lächelnden Augen ansah. Denn Dannys Augen konnten lachen und das war etwas, was ich nie zuvor bei einem anderen Menschen festgestellt hatte.
Wenn wir uns nur öfter sehen könnten!, dachte ich sehnsüchtig. Seit jenem Fest bei Moonie, wo wir uns unsere Liebe gestanden hatten, wie es in Romanen so schön heißt, hatten wir uns erst dreimal getroffen; und jedes Mal war die Zeit davongaloppiert wie ein Pferd, das von einem Schwarm wilder Hornissen verfolgt wird. Schuld daran war Onkel Scott, wenn man die Sache genauer betrachtete.
»Wenn er sich bloß nicht so anstellen würde!«, sagte ich zu Dandy, dem grauen Wallach, der am Mäuerchen von Brooks Pasture auf mich wartete. »Ich weiß ganz genau, ich könnte sogar schwören, dass er Danny gern hätte, wenn er ihn nur einmal unvoreingenommen kennen lernen würde!«
Dandy prustete freundlich. Sein Hals wurde lang und immer länger, weil er versuchte, den Kopf über das Mäuerchen zu strecken und einen der beiden Eimer mit Hafer zu erreichen, die ich den Pfad entlangschleppte. Seine zierlichen Ohren spielten aufgeregt, denn jetzt kamen auch schon andere Pferde über die Koppel zum Gatter — englische Vollblüter, Shetlandponys, Anglo-Araber, New-Forest-Ponys, Braune, Rappen, Schimmel ...
Manche von ihnen waren alt und verbraucht, mit eingesunkenen Augen und Narben, die bis an ihr Lebensende von der Grausamkeit und Achtlosigkeit ihrer früheren Besitzer zeugen würden; mit schwachen, kranken Beinen und den Spuren von Sporen auf ihren Flanken, mit Zähnen, die von schlechter und mangelhafter Ernährung schadhaft waren; Pferde, die wild und auch schreckhaft oder handscheu sein konnten, Beißer wie Rae und Owlie, oder Ponys, die jahrelang ohne richtige Hufpflege bei Geländeritten eingesetzt worden waren und jetzt an Strahlfäule, Spat oder Hufrollenentzündung litten.
Jedes unserer Pferde hatte seine eigene Geschichte; nur selten kannten wir sie. Onkel Scott wusste meist nur, wo und in welchem Zustand er die Pferde gekauft hatte — häufig so elend und erbarmungswürdig, dass »man sich schämt, ein Mensch zu sein«, wie er zu mir gesagt hatte.
Vielleicht liebten wir sie gerade deshalb so sehr, mit all ihren Eigenarten, die den Umgang mit ihnen nicht immer leicht machten. Doch »Ein Pferd ist nicht schwierig; nur die Menschen machen es dazu« – auch das hatte Onkel Scott gesagt; und daran dachte ich, wenn Rae scheinbar grundlos versuchte auszuschlagen oder Myrddin manchmal ohne sichtbaren Anlass vor mir scheute und die Augen rollte, als wäre ich mit einer Peitsche auf sie losgegangen.
Noch immer zogen Dunstschwaden in zerfetzten Schleiern über die Koppeln. Eine Vorahnung des kommenden Herbstes lag in der Luft.
»Vielleicht«, sagte ich zu Brownie, dem schwarzen Pony, während ich seine Portion Hafer abmaß, »wär’s ja besser, wenn die englische Königin länger in Schottland bleiben würde; dann hätten wir ein paar Sommertage mehr.« Aber Brownie interessierte sich nur für sein Frühstück, und Rascal, der dicht neben mir im Heidekraut saß, kratzte sich gleichgültig hinter dem Ohr.
Als ich den vierten und fünften Eimer über den Stallhof schleppte und mich fragte, ob ich irgendwann im Laufe dieses Vormittags Zeit finden würde, heimlich zum Efeubaum zu reiten, um nachzusehen, ob Danny mir dort eine Nachricht hinterlassen hatte, kam Onkel Scott um die Hausecke, von einem gewaltigen Niesanfall geschüttelt.
»Der Lieferwagen von Mill Farm ist kaputt«, sagte er, nachdem er sich heftig geschnäuzt hatte. »Ich muss mit dem Lastauto los und die Hafersäcke selbst holen. Kommst du hier allein zurecht?«
Ich nickte. »Sicher. Übrigens, du solltest dir später mal Bells rechten Hinterfuß ansehen. Ich hab das Gefühl, sie entlastet ihn ständig.«
»Vielleicht hat sie sich was in den Huf getreten.«
»Ich hab ihn mir schon kurz angesehen, aber nichts feststellen können.«
Onkel Scott versprach, sich später darum zu kümmern. Auf seinen knochigen Wangen brannten rote Flecke. Er entfernte sich hustend, Dart auf den Fersen.
Ich ging zur Koppel, verfütterte den Hafer, kehrte zum Stallhof zurück, stellte die leeren Eimer ab und lief zum Haus. Rascal raste neben mir her, sprang kläffend an mir hoch und versuchte spielerisch, mich am Ärmel zu packen.
Nachdem ich mich vergewissert hatte, dass mein Onkel und das Lastauto verschwunden waren, ging ich in die Halle, nahm den Telefonhörer ab und wählte Dannys Nummer. Mein Herz klopfte heftig – teils vom Laufen, teils vor freudiger Erwartung; auch vor Aufregung, weil ich fürchtete, Dannys Mutter könnte das Gespräch entgegennehmen.
Es war Sheila, Dannys Schwester, die abhob. Ich holte tief Luft und sagte: »Hey, Shee, hier ist Laurie. Ist Danny zu Hause?«
»Oh, hallo, Laurie! Er ist gerade rausgegangen, glaube ich. Warte einen Augenblick, ich hole ihn!«
Ich hörte Türenklappen und ferne Stimmen; dann ein Poltern und Schritte, die rasch lauter wurden. »Laurie?«, fragte Dannys atemlose Stimme.
Mein Herz schlug einen Purzelbaum. Solche akrobatischen Leistungen vollbrachte es nur im Zusammenhang mit Danny. »Du«, sagte ich rasch, »Onkel Scott ist weggefahren. Eine Stunde ist er bestimmt unterwegs. Bist du gerade sehr beschäftigt oder hättest du ...?«
Er unterbrach mich. »Ich komme! Wo treffen wir uns?«
»Eigentlich kann ich hier jetzt nicht weg. Ich bin mitten in der Morgenfütterung. Aber vielleicht könntest du zu uns rüberkommen? Ich bin auf den Koppeln. Allan hat heute seinen freien Vormittag; ich bin ganz allein.«
»Ich schwinge mich gleich aufs Fahrrad. In zehn Minuten bin ich da!«, versprach er und ich legte den Hörer auf, bückte mich, küsste den überraschten Rascal auf die Nase, tanzte wie Rumpelstilzchen durch die Halle und sang: »Hurra, er kommt, juhu, jubilier!«
Dann umarmte ich den Mahagonipfosten des Treppengeländers, fiel fast in den Putzeimer, den Mrs. Kirkish oder Mrs. Tweedie neben dem Treppenaufgang deponiert hatte, und stürmte wieder aus dem Haus.
Rascal drehte fast durch. Er bellte und sprang wie ein Gummiball auf und nieder. Seine Ohren, die zum Glück nie jemand kupiert hatte, flatterten wie bei Snoopy im Zeichentrickfilm. Und Owlie, der gestern eine Beißerei angezettelt hatte und vorübergehend allein auf Laureis Pasture verbannt worden war, warf sich wie ein wütender Stier gegen das Gatter und wieherte voller Zorn.
Ich verschüttete allerhand Hafer, als ich Eimer Nummer fünf und sechs füllte, und Rascal lief auf dem Weg zwischen den Koppelmäuerchen voraus und begann zu bellen, als an der Pforte, die The Laurels im Westen begrenzte, eine schmale Gestalt auftauchte, Dunstschwaden wie einen Heiligenschein um den Kopf.
»Hierher, Rascal!«, schrie ich. »Komm zurück, hast du gehört. Kannst du nicht folgen?«
Rascal stellte sich taub und raste weiter; doch Danny wusste mit Tieren umzugehen. Er blieb stehen, wartete ruhig, bis der Terrier näher kam, kauerte sich dann auf die Fersen und streckte langsam eine Hand aus.
Ich ging, so rasch ich mit meinen beiden Eimern konnte, und beobachtete, wie Rascal Dannys Hand beschnupperte; zögernd zuerst, doch dann begann er leicht mit dem Schwanz zu wedeln, und ich stellte die Eimer ab und lief das letzte Stück zur Pforte, wobei ich das verrückte Gefühl hatte, als würden meine Füße kaum den Boden berühren.
Danny hob den Kopf und sah mir entgegen; sein Mund blieb ernst, aber seine Augen lächelten. Ich blieb vor ihm stehen, atemlos, streckte die Hand aus und zog ihn hoch.
Für Sekunden standen wir stumm voreinander, Hand in Hand, und sahen uns nur an; und wieder marschierte ein ganzes Heer von Göttern vorbei, griechisch-römische, altgermanische, indische ...
»Hallo, Laurie!«, sagte Danny ziemlich leise und es klang wie eine Liebeserklärung. Er hob meine Hand, drückte sie erst gegen seine Wange und dann gegen seine Lippen.
Fast erschrocken fragte ich: »Wieso küsst du mir die Hand?« Und er erwiderte: »Warum nicht? Ich küsse dir auch die Füße, wenn’s sein muss. Soll ich?«
Ich musste lachen. »Nein, danke, nicht jetzt; nicht, wenn ich Gummistiefel trage.« Und ich stellte mich auf die Zehenspitzen und küsste erst seine Nase, die schmal und ziemlich spitz war, dann die Sommersprossen auf seinem Kinn und schließlich seinen Mund, der warm und weich war und nach Heu duftete.
»Laurie!«, sagte er wieder und strich mir mit den Fingerspitzen eine Haarsträhne aus der Stirn; und ich flüsterte: »Danny«, ohne dass es mir albern vorkam. Ich hätte seinen Namen hundertmal sagen können, er passte so gut zu ihm und hatte einen so hübschen Klang; ein richtiger Highlandname, wie ich fand.
Rascal begann zu bellen und kratzte eifersüchtig mit der Pfote an meinem Hosenbein. Ich bückte mich und streichelte ihn, die Schulter gegen Danny gelehnt. Auf der Koppel machten die Pferde einen gewaltigen Lärm. Sie schnaubten und wieherten und polterten mit den Hufen gegen das Gatter.
Ich sagte: »Herrje, sie warten auf ihr Futter!«
Wir holten die Eimer. Danny nahm mir einen davon ab und ging mit mir zum Gatter, den freien Arm um mich gelegt.
»Traust du dich mit auf die Koppel?«, fragte ich.
»Klar, warum nicht?«
»Bleib aber im Hintergrund. Sie kennen dich nicht; ich weiß nicht, wie sie auf dich reagieren. Und komm Rae nicht zu nahe, dem großen schwarzen Wallach. Wenn er schlechte Laune hat, macht man besser einen Bogen um ihn.«
Ich maß die Futterportionen ab, die ich inzwischen auswendig kannte, und zeigte Danny dabei unsere Pferde.
»Das schwarze Pony mit der zottigen Mähne, das wie ein Schaf aussieht, ist Brownie. Die graue Stute ist Bell; sie hat Strahlfäule. Der Braune mit der hellen Mähne ist Tullamore, Onkel Scotts Pferd. Er ist ein englisches Halbblut und total gutmütig. Jetzt kriegt Myrddin ihr Futter; sie ist noch immer ziemlich ängstlich. Als ich herkam, durfte man nicht in ihre Nähe kommen.«
»Sie ist ein Araber, nicht?«, sagte Danny.
Ich nickte. »Neben Myrddin steht Siebenschön; ich meine die isabellfarbene Stute. Die beiden sind zusammen hergekommen und gehen auch jetzt noch meistens miteinander. Ich hab sie nach einer deutschen Märchenfigur so genannt. Ihr Fell war über und über mit kahlen, nässenden Stellen bedeckt, als ich sie kennen lernte.«
»Siebenschön«, wiederholte Danny mit komischer Betonung. »Was bedeutet das?«
Ich übersetzte es: »Seven-beauty. Aber das klingt seltsam auf Englisch. Im Märchen bedeutet es, dass das Mädchen ganz besonders schön war, siebenmal schöner als andere. Außerdem hab ich mal gelesen, dass die Sieben eine magische Zahl ist, so wie die Drei oder die Dreizehn ...«
Ich kam nicht dazu, Danny das Märchen von Siebenschön zu erzählen, denn die Pferde, die noch nicht gefüttert waren, drängelten und pufften, rempelten mich an und hätten mich umgeworfen, wenn Danny mich nicht festgehalten hätte. Gemeinsam gingen wir zum Stallhof und ich ließ Danny einen Blick in den Stall werfen. Dann holten wir den Quetschhafer aus dem Futterschuppen, der an einige Pferde verfüttert wurde, die schlechte Zähne hatten.
Dandy stand noch immer am Mäuerchen und prustete Danny freundlich an. »Den kennst du ja«, sagte ich und strich dem grauen Wallach zärtlich über die Nase. »Und Ginger auch, unser braves altes Mädchen.«
Dann zeigte ich ihm Nutmeg, den blinden, knochigen Braunen, der sanft und geduldig wie ein Lamm War und mich immer an Puck erinnerte, meine alte Pferdeliebe zu Hause in Habermanns Stall.
»Das schwarz-weiß gefleckte Schaukelpferd ist Bonnie von den Shetlandinseln und dort unter den Bäumen stehen Cassie, Dwarf und Primrose«, sagte ich.
Eine schwarze Stute kam und drängte sich an mich, während ich Primrose fütterte. Danny sah sie an und sagte: »Sie hat tiefe Sporennarben an den Flanken. Dass es noch Leute gibt, die solche Folterinstrumente verwenden, ist eine verdammte Schande! Es müsste wirklich verboten werden!«
Ich richtete mich auf und streichelte den Hals der schwarzen Stute. »Das ist Fairy Queen; sie hat ein totes Fohlen zur Welt gebracht – damals, als wir gemeinsam zum Ceilidh gegangen sind. Ihre Beine sind ziemlich kaputt; Onkel Scott meint, sie ist jahrelang zu scharf geritten worden. Aber was die Sporen betrifft, so gibt’s leider immer noch mehr als genug brutale Idioten, die damit reiten.«
Als alle Pferde ihr Futter bekommen hatten, zerstreuten sie sich. Eine kleine Gruppe strolchte zum Bach hinüber, auf dessen braungoldenem Moorwasser die Sonne zu glitzern begann. Danny und ich lehnten Hand in Hand am Mäuerchen. Ich erzählte ihm, was ich durch Onkel Scott von den Pferden wusste – von Rose of Tralee, die ein einziges Häufchen Elend war, als sie auf dem Viehmarkt in Perth versteigert wurde, von Bonnie, die bei Ponytrecks eingesetzt worden war und deren Beine noch heute mit Narben und Schrunden übersät waren, von Fairy, die, trächtig und total ausgemergelt, verkauft werden sollte, um nach Frankreich verschifft und von Pferdemetzgern geschlachtet zu werden; von Rae, der als bösartig galt und sich auf der Versteigerung so wild benommen hatte, dass keiner außer Onkel Scott sich in seine Nähe wagte, und der noch heute unberechenbar sein konnte.
Danny hörte aufmerksam zu. Ich sah, dass ihn die Geschichte unserer Pferde wirklich interessierte.
»Du liebst sie, nicht?«, sagte er sanft.
Ich nickte. »Sie sind wie Kinder; sie brauchen uns. Und wir wissen, dass viele von ihnen es bei uns zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich gut haben.«
Nun stand die Sonne strahlend über dem Ben Wyvis, hüllte die Hänge und Schafweiden und einen Teil der Koppeln in ihren Glanz. Wir achteten nicht auf die Zeit. Es war so schön, so selbstverständlich, Danny endlich unsere Pferde zu zeigen; ich hatte mir das seit langem gewünscht.
Noch während ich erzählte, das Gesicht der kleinen, bunt zusammengewürfelten Herde zugewandt, spürte ich plötzlich, wie sich der Druck von Dannys Hand verstärkte. Ich sah ihn an und merkte, dass er zum Stallhof hinüberschaute. Obwohl die Entfernung zu groß war, als dass man uns hätte hören können, flüsterte er: »Er ist zurückgekommen.«
Auf dem Stallhof, dicht beim alten Brunnen, stand Onkel Scott und beobachtete uns.
2
Sekundenlang fühlte ich mich wie ein Kind, das bei einer Missetat ertappt wird: Ich wollte Hand in Hand mit Danny weglaufen und mich irgendwo verstecken.
»Shit!«, sagte Danny halblaut.
Wir blieben wie erstarrt stehen. Ich fürchtete und hoffte zugleich, dass Onkel Scott zu uns kommen würde; fürchtete die Szene, die er unweigerlich machen würde, hoffte aber auch, es könnte ein Anfang nach einem reinigenden Gewitter sein, weil er Danny dabei endlich kennen lernte und merken musste, dass er kein Zombie war, sondern liebenswert, ehrlich und unfähig, irgendjemandem etwas Böses zuzufügen.