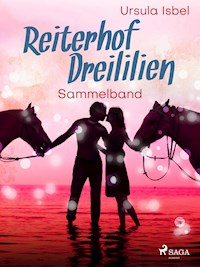Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Pferdeheimat im Hochland
- Sprache: Deutsch
Laura hat sich gut auf der Farm "The Laurels" im schottischen Hochland eingelebt, doch als ihr Onkel für einige Zeit ins Krankenhaus muss, übernimmt Laura die Verantwortung für den Gnadenhof. Ihre Freundin Annika, sowie Allen und Danny helfen ihr so gut sie können, doch haben sich die Freunde damit übernommen? Ein weiteres Problem belastet Laura zusätzlich. Sie muss sich entscheiden, ob sie ihre neues Leben in Schottland behalten will oder nach München zurückkehren wird. Kann sie wirklich ihre geliebten Pferde und Danny hinter sich lassen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 167
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ursula Isbel
Pferdeheimat im Hochland - Winterstürme, Frühlingsluft
Saga
Pferdeheimat im Hochland - Winterstürme, Frühlingsluft
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1993, 2021 Ursula Isbel und SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726877380
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Für meine Hündin Nicki,
die treue Gefährtin auf vielen Wegen,
die starb, als dieses Buch entstand.
1
Im Traum war ich wieder in München, in unserem Reihenhaus am Stadtrand, und wartete auf einen Brief von Danny, der nicht kam. Das Leben verlief in seinen alten Bahnen, als wäre ich nie fortgewesen bei Danny, Onkel Scott und den Pferden, mit den Koppeln und Wasserläufen und Bergketten im wechselnden Licht des Tages und der Jahreszeiten, dem Duft der Heide und dem Gesang des Windes. Wie in dem alten schottischen Lied war mein Herz in den Highlands geblieben, und im Traum wußte ich, es würde erst zur Ruhe kommen, wenn ich dorthin zurückkehrte.
Mitten in der Nacht wachte ich auf. Der Winterwind rüttelte an den Fensterrahmen und blies seinen eisigen Atem ins Zimmer. Ich wischte mir die Tränen mit Tante Annes Patchworkdecke ab und war froh, so froh, daß alles nur ein Traum gewesen war, daß ich hier in The Laurels lag, nicht mehr als eine kurze Wegstrecke von Danny entfernt; daß ich Rascals friedliche Schnarchtöne vom Fußende meines Bettes hörte und das Getrippel der Mäuse und Siebenschläfer im Gebälk.
Der Mond stand kalt und silbern hinter den Fenstern, umgeben vom Kranz der Sterne. Ich sah zu ihm auf und dachte: Vielleicht ist man nicht immer dort zu Hause, wo man geboren ist. Vielleicht gibt es irgendwo eine wirkliche Heimat, die man sich im Leben selbst suchen muß. Ich hatte sie gefunden. Und wenn ich eines Tages gehen mußte, würde ich doch immer wieder ins Hochland zurückkehren.
Der Winter war hart in diesem Jahr. Dicht lag der Schnee über den Weiden und Berghängen, gemustert von den Hufen und Krallen der Tiere, die auf der Suche nach Futter durch das Hochmoor streiften: Füchse, Hasen, Dachse, Rotwild, Moorschneehühner und wilde Katzen, die sich, von den Menschen enttäuscht und verjagt, in die Berge zurückgezogen hatten. Auch die Schafe wanderten einzeln und in Gruppen über die Hänge und scharrten wie unsere Pferde im Schnee, denn im Verborgenen gab es noch immer spärliche Grashalme, Moose, Flechten und Kräuter.
Die Weihnachtstage vergingen mit gemütlichen Stunden am Kaminfeuer und einem Paket mit brandneuen Reitstiefeln von Onkel Scott, die herrlich nach Leder dufteten und von einem alteingesessenen Aberdeener Schuster angefertigt waren. Sheila hatte mir einen Pullover gestrickt. Das beste von allem aber war ein herzförmiger Anhänger aus Bernstein von Danny.
Das Weihnachtsessen krönte ein Plumpudding von Mrs. Tweedie, der recht seltsam schmeckte. Doch das Glück war mir hold, denn ich biß auf einen eingebakkenen Ring.
„Das bedeutet, daß du im kommenden Jahr heiraten wirst!“ prophezeite die alte Dame und drohte mir lächelnd mit ihrem gichtgekrümmten Zeigefinger.
Seit langem hatte ich mir einen „richtigen“ Winter wie diesen gewünscht, mit Glitzerschnee, Eiszapfen und frostklaren Nächten. Doch wenn wir beim Morgengrauen und in der Abenddämmerung in Schneestürme und klirrende Kälte hinausmußten, um die Pferde zu versorgen, bis unsere Ohren brannten, die Nase fast abfiel und Hände und Füße trotz Wollsocken, Stiefeln und Fellhandschuhen schmerzten, wünschte ich Tauwetter herbei, sehnte mich nach der Sonne, nach grünem Gras und milden Temperaturen.
„Es wird Zeit, daß der Frühling kommt“, sagte auch Onkel Scott. Das war Anfang Februar, nach einem erneuten Kälteeinbruch, der aus Sibirien stammte. „ Je älter ich werde, desto mehr macht mir der Winter zu schaffen. Dann verstehe ich die Leute, die es in den Süden zieht.“
„Bald ist März. Das ist der erste Frühlingsmonat. Im März ist der Winter fast vorbei“, sagte ich, als wäre es eine Beschwörungsformel, die die Macht hatte, den Winter zu vertreiben; und mein Onkel lächelte und schüttelte den Kopf. Er meinte, im Hochland hielte sich das Wetter selten an die üblichen jahreszeitlichen Regeln.
Unsere Pferde ließen den Winter geduldig über sich ergehen, zottelig wie Schafe in ihrem Winterfell. Wenn es zu arg stürmte, drängten sie sich Kopf an Kopf in den Schutzhütten zusammen und wärmten sich gegenseitig. Fiona, die Mutterstute, und Finn, unser einziges Fohlen, verbrachten die rauhesten Tage im Stall, zusammen mit dem blinden Nutmeg, mit Ginger und Dandy, der nur schwer Luft bekam, und mit noch ein paar Pferden, die zu alt oder zu schwach waren, um Schnee und Kälte auszuhalten. Sie alle litten unter der mangelnden Bewegung, vor allem der kleine Finn. So oft es das Wetter zuließ, brachten wir ihn auf die Koppel; dann tobte er wie ein Irrwisch kreuz und quer über Laurels Pasture, den sahnefarbenen Schweif hoch erhoben, wälzte sich im Schnee und schlitterte den Abhang zum Bach hinunter, die Beine gegrätscht, so daß mir beim Zusehen die Lachtränen kamen und auf meinen Backen zu Eis erstarrten.
Er war jetzt ein gesundes und kräftiges Hengstfohlen, unser Finn, mein „Bairnie“; er bekam längere Beine, stärkere Knochen und größere Ohren. Auch die Farbe seines Fells veränderte sich; und wenn ich ihn liebte – und das tat ich, obwohl ich wußte, daß ich mich eines nicht allzu fernen Tages von ihm trennen mußte –, so liebte ihn Allan, unser Pferdepfleger, wohl noch mehr. Er war es, der in jeder freien Minute mit Bairnie spielte und herumtobte; und sein finsteres Gesicht unter dem schwarzen Haar wurde weich, wenn er unser Hengstfohlen ansah.
„Wenn Onkel Scotts Freund im Frühsommer kommt, um den Kleinen abzuholen, dreht Allan durch“, sagte ich zu Danny. „Du, ich glaube fast, Bairnie ist der einzige, den er liebt. Eine Freundin hat er wohl nicht, und zu Hause gibt’s sowieso nur Probleme mit seiner Mutter, die trinkt, und seinen jüngeren Geschwistern, um die sich keiner richtig kümmert.“
Doch Danny hatte eigene Sorgen. Die Lammzeit war gekommen, für einen Schafzüchter die anstrengendsten Monate im Jahr, wie er mir erklärt hatte; und sie dauerte für gewöhnlich vom Februar bis in den Juni hinein.
„Jetzt haben wir schon fast zwei Dutzend Mutterschafe im Stall, die jeden Augenblick lammen können“, sagte er, während wir mit „Mildred“, dem alten schwarzen Auto der MacClintocks, nach Inverness zuckelten, zu einem lange geplanten und ewig verschobenen Kinobesuch. „Das bedeutet, daß jede Stunde einer von uns in den Stall gehen und nachsehen muß, was sich tut.“
„Nachts auch?“ fragte ich.
„Ja, sicher, jedenfalls so bis zwei oder halb drei. Und morgens um sechs geht’s dann meistens wieder weiter!“
„Kriegen denn die Schafe ihre Jungen nicht von allein? Ich meine, so eine Geburt ist doch eine natürliche Sache, und früher . . .“„begann ich, stockte dann aber und begriff, daß ich Unsinn redete, denn auch Stuten kommen bei Fohlengeburten nicht immer ohne Hilfe aus.
„Oft geht’s ganz problemlos, aber so eine Geburt kann sich auch über Stunden hinziehen, und dann ist’s eine Plage. Manchmal passiert es sogar, daß eins der Mutterschafe einen Kaiserschnitt braucht. Dann müssen wir den Tierarzt holen, damit kommen wir nicht allein klar“, sagte Danny. „Man muß immer damit rechnen, daß etwas schiefläuft; wenn der Kopf zuerst kommt, muß man dabeisein und ihn zurückschieben . . . “
„Der Kopf? Ja, was muß denn zuerst kommen? Das Hinterteil?“ fragte ich verdutzt.
„Nein, die Vorderbeine. Erst die Vorderbeine, und dazwischen das Mäulchen; nur so geht’s“, erklärte Danny. „Vorgestern hat in diesem Jahr das erste Mutterschaf gelammt – es waren gleich drei kleine Knöpfe, dunkelbraun und weiß gescheckt; aber eins davon hat es nicht geschafft.“
„Was? Drei Junge kann so ein Schaf auf einmal kriegen?“
„Sicher.“ Danny runzelte die Stirn und spähte durch die Windschutzscheibe. Als ich seinem Blick folgte, merkte ich, daß wir geradewegs in eine dunkle Wolkenwand hineinfuhren, die verteufelt nach einer Riesenladung Schnee aussah.
Danny machte ein Gesicht wie ein Kapitän, der entschlossen ist, sein Schiff durch Sturm und Wellen zu steuern. Langsam sagte er: „Wenn das alles herunterkommt, bleiben wir unter Garantie stecken. Ich hab nur Sommerreifen drauf, und die sind so abgefahren und platt wie Mullahans Schädel. Es wär besser gewesen, wenn wir den Bus genommen hätten, aber wir wollten ja noch die Futtersäcke abholen.“
„Wir hätten Onkel Scott bitten können, die Säcke für euch zu holen“, sagte ich. „Er muß demnächst sowieso nach Mill Farm, um Hafer und Mais zu kaufen.“
Es war noch immer wie ein absolutes Wunder für mich, daß nach der Generationen alten Feindschaft zwischen den MacClintocks und den Montroses so eine nachbarschaftliche Hilfe überhaupt möglich war.
„Daran hab ich überhaupt nicht gedacht“, erwiderte Danny, ebenfalls erstaunt. „Ja, du hast recht; Mom hätte ihn nur darum zu bitten brauchen, er wäre wahrscheinlich losgedüst wie eine Rakete!“
Wir lächelten uns zu, und die Wolkenwand kam mir plötzlich freundlicher vor, gewissermaßen rosafarben angehaucht, obwohl sie innerhalb von zwei Minuten unmöglich die Farbe gewechselt haben konnte.
„Jedenfalls“, meinte Danny und klopfte der röhrenden Mildred besänftigend aufs Armaturenbrett, „kann es immer noch sein, daß er kommen und uns abschleppen muß, falls wir in der Schokolade festsitzen.“
„Hm“, sagte ich. „Dann kann man bloß hoffen, daß eine Telefonzelle in der Nähe ist. Die sind ja selten da, wenn man sie braucht, besonders hierzulande. Soll ich beten?“
„Schaden kann’s nicht. Ich glaube, wir müssen froh sein, wenn wir’s bis Dingwall schaffen. Von dort fahren wir mit dem Bus weiter oder warten ab, was passiert.“
Ich hatte den Kinobesuch schon mehr oder weniger abgeschrieben. „Der Bus fährt erst um sechs“, sagte ich. „Dann kommen wir nur noch in die spätere Vorstellung und erwischen womöglich den letzten Bus zurück nicht mehr.“
Danny seufzte. Jetzt erst bemerkte ich, daß er einen total blau angelaufenen Daumennagel hatte. „Dann müssen wir uns eben in Dingwall ,amüsieren‘“, sagte er, und das Wort klang derart komisch in Verbindung mit dem harmlosen kleinen Provinznest, daß wir beide losprusteten und uns kaum mehr beruhigen konnten.
„Dingwall ist der Nabel der Welt!“ sagte Danny schließlich würdevoll und steuerte entschlossen direkt in das dunkle Gebräu hinein.
Ich kam mir vor wie in einem Schlachtschiff, das mit vollen Segeln in ein Windei hineintreibt – oder vielleicht in eine Windhose und Danny verkündete mit düsterer Stimme: „Gleich geht’s los!“
Kaum hatte er das ausgesprochen, begann es wie verrückt zu schneien. Danny schaltete die Scheibenwischer ein, doch es war, als würde man versuchen, mit einem Regenschirm gegen eine Sturmflut anzugehen: Von einer Sekunde zur anderen war die Windschutzscheibe total verfinstert, so, als hätte ein außerirdischer Witzbold eine aufgeschlitzte Daunendecke auf uns herabgeschleudert.
„Phantastisch!“ sagte Danny mit Grabesstimme. „Jubel und Frohlocken!“ Er lenkte Mildred vorsichtig nach rechts, dorthin, wo vermutlich der Straßenrand war, und schaltete den Motor aus.
Ich mußte lachen. „Als ich noch in München war, hätte ich nie gedacht, daß es so schwierig sein könnte, ins Kino zu kommen.“
„Wir müssen froh sein, wenn wir heute nacht überhaupt noch irgendwohin kommen“, murmelte Danny. Er kroch zwischen den Sitzen nach hinten und zerrte eine Decke aus dem Kofferraum. „Leider hat die gute alte Mildred keine Standheizung.“
Wir rückten eng zusammen und wickelten uns in die Decke ein, was sehr angenehm war, obwohl sie durchdringend nach Schafen roch. „Es dauert bestimmt nicht lange“, sagte ich zuversichtlich, während es um uns her dunkler und dunkler wurde. „Das ist sicher bloß ein Blizzard, oder wie man so was nennt.“
„Hoffentlich“, sagte Danny. „Ich hab keine Lust, so jung schon im Auto zu erfrieren.“
Ich begriff, daß es nicht so komisch gemeint war, wie es klang. „Ist das denn schon mal passiert?“ fragte ich beeindruckt. „Daß jemand im Auto erfroren ist? Hier in den Highlands, meine ich?“
„Sicher“, sagte Danny. „Aber hab keine Angst, Laurie, das passiert höchstens mal mitten in den Bergen, und wir sind ja nur drei oder vier Meilen vom ,Nabel der Welt‘ entfernt.“
Ich nickte beruhigt und erwiderte gedämpft in den Rollkragen seines Pullovers: „Wenn’s uns hier zu ungemütlich wird, schlagen wir uns halt zu Fuß nach Dingwall durch.“ Doch noch während ich das sagte, wurde mir klar, daß wir – falls es weiter schneite – draußen in einer Schneewüste landen würden, in der sich nicht einmal mehr ein Berner Sennenhund zurechtgefunden hätte.
Wenn Danny die gleichen Überlegungen anstellte, sprach er es jedenfalls nicht aus. Er küßte mich auf die Nasenspitze und den Mund und sagte, ich solle mir keine Sorgen machen, es wäre wohl nur eine Schneewolke oder eine kleine Wolkenwand, und ich küßte ihn wieder und dachte, daß wir gar kein Kino brauchten, weil wir selbst mitten in einer Situation steckten, die reif für die Leinwand war: Klappe auf, Szene eins: junges Liebespaar im Auto vom Schneesturm in den schottischen Highlands überrascht . . .
Im Grund wäre mir eine weniger abenteuerliche, dafür aber gemütlichere Szene mit Danny am Kaminfeuer lieber gewesen. Meine Freundin Annika dagegen hätte sicher gefunden, daß ich dem Schicksal dankbar sein mußte, weil es mir so wunderbare Abenteuer bescherte, und daß ich wieder einmal nicht „krallte“, daß so etwas das pralle Leben in Person war. Ich glaubte sie förmlich sagen zu hören: „Am Kaminfeuer kannst du noch sitzen, wenn du alt bist und mit dem Kopf wackelst.“
„Das werd’ ich bestimmt einmal meinen Enkelkindern erzählen“, sagte ich zu Danny. „Daß ich mit dir in einem Schneesturm steckengeblieben bin.“
„Unseren Enkelkindern“, verbesserte er. „Ja, das wird sicher eine Sensationsstory sein, denn bis dahin gibt’s wahrscheinlich wegen der Klimakatastrophe keinen Winter mehr. Und du wirst ihnen erst mal erklären müssen, was es mit den kleinen, kalten weißen Flocken auf sich hat.“
Dabei kurbelte er vorsichtig das Seitenfenster herunter, um nachzusehen, ob die kalten weißen Flocken noch vom Himmel kamen; und das taten sie zur Genüge. Ein richtiger Schneeberg sackte durchs Fenster herein. Von der Straße war absolut nichts mehr zu erkennen; man sah weder Bäume noch Berge noch Häuser. Wenn wir nicht gewußt hätten, daß der Himmel dort sein mußte, wo die Schneeflocken herkamen, hätten wir nicht einmal mehr geahnt, wo oben oder unten war.
„Ich glaube, wir stecken schon bis über die Reifen drin“, sagte Danny und kurbelte die Scheibe rasch wieder hoch.
„Was machen wir, wenn’s nicht aufhört?“ fragte ich und wärmte meine eiskalte Nasenspitze an seinem Hals.
„Irgendwann muß es ja aufhören!“
„Wir buddeln uns durch den Schnee“, sagte ich und wußte, daß das Schwachsinn war; denn wenn wir keine Ahnung hatten, in welche Richtung wir uns bewegten und wo die nächste menschliche Behausung war, konnte es passieren, daß wir im Kreis buddelten. Da war es immer noch am sichersten, im Wagen zu bleiben und abzuwarten.
„Wenn es zu kalt wird, lasse ich den Motor an“, sagte Danny. „Wir haben bloß nicht mehr besonders viel Benzin im Tank.“ Seine Stimme klang jetzt besorgt.
Ich sah auf die Windschutzscheibe, die immer mehr an die Wand eines Iglus erinnerte, und der Schnee, der bisher immer so eine gemütliche, heimelige Sache für mich gewesen war, etwas, was mit Bratäpfeln, Nikolaus, Schlittenfahren und Weihnachtspostkarten zu tun hatte, erschien mir mit einem Mal bedrohlich.
Ich dachte: Wenn das nicht bald aufhört, sind wir hier im Wagen gefangen, und es kann Tage dauern, bis sie uns finden, oder bis der verdammte Schnee schmilzt. Und wir haben nichts zu essen dabei, aber wahrscheinlich erfrieren wir, ehe wir verhungern . . .
Vielleicht hatte Danny den gleichen Gedanken, doch keiner von uns sprach seine Befürchtungen aus.
„Zu Hause wissen sie ja, welche Strecke wir gefahren sind“, sagte er schließlich, wohl, um mich zu trösten. „Sie werden die Polizei anrufen, wenn wir nachts nicht zurückkommen, und dann schicken die einen Schneepflug oder irgend so was los.“
„Ja“, murmelte ich. „Falls die Telefonleitungen dann noch funktionieren.“
Es wurde schwärzer um uns her, was ganz natürlich war, denn die Nacht brach herein. Doch es wurde auch zunehmend kälter im Wagen; die Kälte kroch durch die Wolldecke, und meine Zehen erstarrten zu Eiszapfen. Schließlich ließ Danny den Motor an und schaltete die Heizung ein, was nicht viel brachte, denn es dauerte ewig, bis sich die kalte Luft erwärmte, und dann mußten wir den Motor wieder ausschalten, um Benzin zu sparen.
Die Minuten verstrichen, und bald saßen wir in eisiger Finsternis wie in einem Verlies oder auch in einer Gruft, aber der Vergleich gefiel mir nicht. Wir überlegten, ob wir die Innenbeleuchtung einschalten sollten.
„Lieber nicht“, sagte Danny. „Sonst gibt die Batterie womöglich den Geist auf.“
„Aber wie soll uns jemand finden, wenn das Auto total unbeleuchtet ist?“ fragte ich.
Danny kroch wieder nach hinten und begann im Dunkeln unter allerhand Werkzeug, Kartons und Kisten herumzuwühlen, bis er eine Taschenlampe und zwei leere Säcke fand. Die Säcke wickelte er im Schein der Taschenlampe um meine Füße. Dann saßen wir da, froh über den bescheidenen Lichtkegel, versuchten uns gegenseitig zu wärmen und warteten auf wunderbare Hilfe. Und ich dachte über die Macht des Schicksals nach, das mich hierhergeführt hatte. So viele Ereignisse waren notwendig gewesen, damit ich den Weg in die Highlands gefunden hatte, zu Onkel Scott und Danny – sollte er hier enden, in einem alten Auto im Schnee am Straßenrand, nur wenige Meilen von einem Nest namens Dingwall entfernt?
Danny drückte meine Hand und hauchte meine Finger an. Da ging es mir durch den Sinn, daß ich mich – wenn ich die Wahl gehabt hätte, hier zu sein oder zu Hause in München, in unserem zentralgeheizten Wohnzimmer, ohne zu wissen, daß es Danny gab – doch immer für dieses neue Leben im Hochland entschieden hätte, für diesen Winterabend im eingeschneiten Wagen, auch wenn der Ausgang dieses Abenteuers ungewiß war.
Wieder kurbelte Danny vorsichtig die Scheibe herunter und richtete den Strahl der Taschenlampe nach draußen. Die Dunkelheit war jetzt vollkommen, und keine Schneeflocken glänzten mehr im Lichtschein. Die Luft war klar und trocken. Es hatte zu schneien aufgehört.
„Ich glaub’s nicht!“ sagte Danny mit einem derartigen Ton von Verblüffung in der Stimme, daß ich fast hysterisch zu lachen begann.
Was dann folgte, war weniger erheiternd; und ich weiß nicht, wie lange wir durchgehalten hätten, wenn das Glück nicht auf unserer Seite gewesen wäre. Entschlossen, uns irgendwohin durchzuschlagen, krochen wir aus dem Wagen und landeten bis zu den Hüften im Schnee. Danny ging voraus. Er mußte sich jeden Schritt mühsam erkämpfen, bahnte uns den Weg mit seinem Körper. Es war wie in einem Alptraum, wenn man zu fliehen versucht und doch kaum vorwärts kommt.
Das Licht der Taschenlampe wurde schwächer, doch über uns riß die Wolkendecke immer mehr auf und gab den nächtlichen Himmel frei. Die Sterne, wohl nirgends heller und leuchtender als hier im Hochland, strahlten herab und schimmerten auf dem frisch gefallenen Schnee.
Eine Weile arbeiteten wir uns vorwärts, froh, nicht mehr im Wagen gefangen zu sein. Die Wälle und Schluchten der Schneewüste schienen endlos. Dann aber sahen wir die Äste von Bäumen, ein fast versunkenes Straßenschild, Telefondrähte, schwer von Schnee verhangen, und Danny hielt inne und sagte über die Schulter: „Wenn ich bloß vorher beim Fahren genau aufgepaßt hätte, wo wir sind! Aber ich glaube, langsam dämmert’s mir. Links müßte bald irgendwo mal ein Haus auftauchen. Schaffst du’s noch?“
„Klar“, sagte ich, obwohl mir schon jetzt zumute war wie nach einer stundenlangen Bergtour, obwohl ich schwitzte und zugleich fror, obwohl meine Zehen total gefühllos waren und Schnee meine Stiefel füllte. Doch die Sterne strahlten tröstlich, und die Luft roch, als wäre die Welt neugeboren.
Für Augenblicke vergaß ich alle Kälte und Anstrengung; und als Danny wieder stehenblieb, um Atem zu holen, legte ich den Arm um seinen Hals, küßte ihn und sagte: „Du, ichhab dich lieb, und ich bin dankbar dafür, daß wir leben und daß es auf der Welt so schön ist!“
Dannys Lippen waren kalt. Ich hatte das komische Gefühl, einer von zwei Schneemännern zu sein, die sich umarmten; und als wir wieder aufsahen, bemerkten wir gleichzeitig das Licht – ein kleines, goldenes Viereck, das durch die Schneewüste strahlte wie der Stern, der den Weisen aus dem Morgenland den Weg gewiesen hatte.
2
Nichts konnte angenehmer und behaglicher sein als das flackernde Feuer im schwarzen Marmorkamin. Ich streckte meine nackten Zehen gegen die Flammen aus, bis sie in Gefahr gerieten, gegrillt zu werden, und ein Strom von Wärme und Dankbarkeit ging durch meinen Körper.