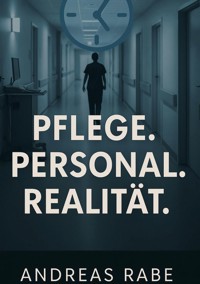
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Pflege. Personal. Realität. ist ein ehrliches, praxisnahes Fachbuch über den Personaleinsatz im modernen Krankenhaus. Es zeigt, wie Pflegende unter permanentem Spagat zwischen Leistungsdruck, Personalmangel und Verantwortung arbeiten und was das für die Organisation, Ausbildung, Führung und Zukunft der Pflege bedeutet. Autor Andreas Rabe, selbst langjähriger Pfleger, Reanimationstrainer und Führungskraft, verbindet systematische Analysen mit emotionaler Tiefe und praktischer Erfahrung. Das Buch beleuchtet Dienstpläne, Rechenmodelle, politische Versäumnisse, aber auch Lösungsansätze, Haltung und Perspektiven. Ein Buch für alle, die Pflege wirklich verstehen wollen, jenseits von Imagekampagnen und Stellenanzeigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Kapitel 1
1. Die Struktur der Station: 30 Patienten, kardiologisches Profil
2. Pflegeaufwand – Was muss geleistet werden?
3. Personalbedarf – Berechnung nach PPR 2.0
4. Dienstplanrealität – Was passiert in Schichten?
5. Reserve, Teilzeit, Realität
6. Was bedeutet „ausreichend“?
Fazit
Kapitel 2
1. Die strukturelle Ausgangslage bleibt
2. Neue Anforderungen im Tagesgeschäft
3. Personalbedarf inklusive Zusatzaufwand
4. Sind diese Aufgaben in der PPR 2.0 enthalten?
5. Weitere Berechnungsoption: Dienstplansicht
6. Lösungsansätze: Muss Pflege alles selbst tun?
7. Fazit: Personalplanung braucht mehr als Zählung
Kapitel 3
1. Die Ausgangslage: Strukturell identisch – personell komplex
2. Warum der Dienstplan nicht reicht
3. Wenn Erfahrungswissen und Einschränkung zusammenfallen
4. Wenn neue Kolleg:innen mehr brauchen als Aufgaben
5. Wenn Teilzeit, Familie und Gesundheit zusammentreffen
6. Was man tun kann – auch ohne mehr Personal
7. Beispiel: Anpassung der Dienstplanung auf 10 reale VK
Fazit
Kapitel 4
1. Pflegepool – Personalsteuerung mit Spielraum
2. Bereichspflege – Cluster statt Einzelstation
3. Neue Rollen für neue Anforderungen
4. Steuerung braucht digitale Unterstützung
5. Risiken und Gelingensbedingungen
6. Beispiel: Fachpflegepool „Innere Medizin“
Fazit
Kapitel 5
1. Warum klassische Planung an ihre Grenzen stößt
2. Was moderne Systeme leisten können
3. Dienstplanung wird zur Steuerung
4. Anforderungen an die Einführung
5. Stolpersteine und Grenzen
6. Beispiel aus der Praxis: Einführung in einem Haus mit 250 Pflegekräften
7. Fazit
Kapitel 6
1. Die neue Realität der Pflegeführung
2. Belastungsfaktoren – was zermürbt Führungskräfte?
3. Was Führungskräfte heute brauchen
4. Führungsinstrumente unter Druck
5. Führung ist auch Selbstschutz
6. Systemischer Blick: Was Organisationen tun müssen
7. Beispiel: Stationsleitung im Krisenmodus
Fazit
Kapitel 7
1. Was bedeutet Work-Life-Balance in der Pflege?
2. Das Problem mit dem Schichtsystem
3. Mitarbeitendenwünsche sind eindeutig
4. Was Kliniken realistisch anbieten können
5. Grenzen und Kompromisse – Balance bedeutet auch Teamarbeit
6. Beispiel: Teammodell mit freiwilliger Selbstorganisation
7. Work-Life-Balance als strategische Aufgabe
Fazit
Kapitel 8
1. Systematisch unterfinanziert – ein Rückblick mit Folgen
2. Gesetze, die nichts verändern – oder neue Probleme schaffen
3. Pflege als „Mitgemeinte“ – nie als Gestalterin
4. Pflege hat politische Wirkung – wenn sie sich vernetzt
5. Gesellschaftliche Wahrnehmung: Pflege als „immer da“?
6. Forderung: Pflege braucht politische Strukturverankerung
7. Beispiel: Kanada und die Niederlande
Fazit
Kapitel 9
1. Der Anspruch der generalistischen Ausbildung
2. Die Realität in vielen Häusern
3. Praxisanleitung: Rolle mit Konfliktpotenzial
4. Wenn Ausbildung zur Belastung wird
5. Ausbildungsabbrüche – ein Alarmzeichen
6. Was müsste sich verändern?
7. Beispiel: Ausbildungsfreundliche Station
Fazit
Kapitel 10
1. Der Mythos vom „Pflegemangel“
2. Warum Pflegekräfte gehen
3. Was Bindung wirklich bedeutet
4. Praxisnahe Maßnahmen zur Mitarbeiterbindung
5. Beispiel: Pflegekraftbindung mit Konzept
6. Was Leitung konkret tun kann
7. Was Organisationen tun müssen
Fazit
Kapitel 11
1. Was ist emotionale Nachhaltigkeit?
2. Warum Pflege besonders betroffen ist
3. Was passiert ohne emotionale Nachhaltigkeit?
4. Wie emotionale Nachhaltigkeit entsteht
5. Konkrete Maßnahmen im Alltag
6. Beispiel: Pilotprojekt „Emotionsanker“ auf einer IMC-Station
7. Rolle der Führung: Präsenz und Haltung
8. Emotionale Nachhaltigkeit ist auch ein Standortvorteil
Fazit
Kapitel 12
1. Was ist berufliche Identität?
2. Warum Pflegeidentität unter Druck steht
3. Pflegeidentität in der Ausbildung: Fundament oder Bruch?
4. Was stärkt berufliche Identität?
5. Beispiel: Identitätsarbeit in einem Pflegeteam
6. Führung und Identität: Sichtbarmachen statt Funktionieren
7. Pflegeidentität ist auch politisch
Fazit
Kapitel 13
1. Warum Sinn so entscheidend ist
2. Wenn Sinn verloren geht – innere Kündigung beginnt
3. Symptome eines verlorenen Sinns
4. Wie Sinn erhalten oder (wieder) aufgebaut werden kann
5. Beispiel: Sinn-Reflexion als Instrument
6. Pflege im Spannungsfeld von Sinn und System
7. Führung und Sinnarbeit
Fazit
Kapitel 14
1. Unterschiedliche Welten – unterschiedliche Logiken
2. Typische Zielkonflikte im Klinikalltag
3. Warum industrielle Steuerungsprinzipien oft scheitern
4. Was Personalabteilungen und Vorstände oft nicht sehen
5. Wie beide Seiten voneinander lernen können
6. Beispiel: Ein gemeinsames Verständnis schaffen
7. Pflege braucht Management – aber angepasst
Fazit
Kapitel 15
1. Was bedeutet „chronisch unterbesetzt“?
2. Was sich verändert, wenn man dauerhaft unterbesetzt ist
3. Was helfen kann – auch ohne neue Stellen
4. Führung in der Unterbesetzung
5. Was der Träger tun kann – auch ohne Personalplus
6. Beispiel: Eine IMC-Station mit 20 % Personallücke
Fazit
Kapitel 16
1. Warum Pflege messbar sein muss
2. Was Pflegeforschung konkret leistet
3. Relevante Instrumente in der Praxis
4. Pflegeforschung und Personalplanung
5. Wo Pflegeforschung herkommt – und wohin sie muss
6. Beispiel: Pflegeindikatoren zur Stationsentwicklung
7. Pflege braucht eine evidenzbasierte Haltung
Fazit
Kapitel 17
1. Warum interprofessionelle Arbeit unverzichtbar ist
2. Typische Reibungspunkte – strukturell, nicht persönlich
3. Unterschiedliche Denklogiken – und wie man sie überbrückt
4. Gelingensbedingungen für interprofessionelle Teams
5. Pflege als eigenständiger Kooperationspartner
6. Beispiel: Interprofessionelle Visite auf einer Herzstation
7. Auch Verwaltung gehört zum Team
Fazit
Kapitel 18
1. Wo Digitalisierung in der Pflege ansetzt
2. Chancen – was Digitalisierung besser machen kann
3. Belastung – wenn Technik nicht trägt, sondern drückt
4. Pflege braucht digitale Beteiligung – von Anfang an
5. Digitalkompetenz als Teil der Pflegebildung
6. Beispiel: Einführung digitaler Pflegedoku mit Pflegebeteiligung
7. Digitalisierung als Teil von Pflegekultur
Fazit
Kapitel 19
1. Was ist KI – und was nicht?
2. Wo KI heute schon in der Pflege unterstützt
3. Was KI nicht kann – und auch nie sollte
4. Akzeptanz bei Pflegekräften – entscheidend für Erfolg
5. Wie KI den Personalengpass abfedern kann
6. Beispiel: Pflege mit KI-Assistenzsystem
7. Voraussetzungen für erfolgreiche KI-Nutzung
Fazit
Kapitel 20
1. Was bedeutet „pflegezentriert“?
2. Kennzeichen einer pflegezentrierten Organisation
3. Woran erkennt man ein nicht-pflegezentriertes Haus?
4. Die 5 Säulen einer pflegezentrierten Organisation
5. Beispiel: Pflegezentriertes Pilotprojekt
6. Herausforderungen bei der Umsetzung
Fazit
Nachwort
Über den Autor
Vorwort
Pflege war nie einfach – aber heute ist sie existenziell herausgefordert.
Dieses Buch ist kein Fachlexikon, sondern ein ehrlicher Versuch, Pflegewirklichkeit zu beschreiben, zu analysieren und zu gestalten.
Ich schreibe aus eigener Erfahrung: als Pflegekraft, als Führungskraft, als Beobachter, als Mitgestalter. Ich kenne das Dienstzimmer, die Personalbesprechung, das Notfallmanagement – und die Fragen, die nach dem Dienst bleiben.
Dieses Buch will zeigen, wie Pflege heute aussieht – jenseits von politischen Schlagworten und Imagekampagnen. Es beleuchtet die Widersprüche zwischen Personalschlüssel und echter Versorgung, zwischen digitaler Planung und menschlicher Begegnung. Es geht um Zahlen, aber auch um Geschichten. Um Struktur – und Sinn.
Ich schreibe es für Pflegende, für Leitende, für Auszubildende – aber auch für diejenigen, die Pflege planen, steuern und verantworten. Es soll Mut machen, Dinge anzusprechen und Verantwortung zu übernehmen – nicht allein, sondern gemeinsam.
„Pflege. Personal. Realität.“ ist kein Abgesang – sondern eine Einladung, genau hinzuschauen und neu zu denken.
Andreas Rabe
Kapitel 1
„Die kardiologische Normalstation – Routinebetrieb mit Systemanforderungen“
Krankenhäuser bestehen nicht nur aus Notaufnahmen, Intensivstationen oder OPs – der Alltag wird auf den sogenannten „Normalstationen“ bewältigt. Hier geschieht das Unspektakuläre, das Kontinuierliche, das Tragende. Besonders in der Inneren Medizin übernehmen kardiologische Stationen mit 30 Betten eine Schlüsselrolle. Dieses Kapitel beleuchtet den realen Pflegealltag, quantifiziert die personellen Anforderungen – und stellt die Frage: Reicht das, was rechnerisch vorgesehen ist, wirklich aus?
1. Die Struktur der Station: 30 Patienten, kardiologisches Profil
Die betrachtete Station hat 30 Betten und behandelt überwiegend internistische Patientinnen und Patienten mit kardiologischen Diagnosen wie:
Vorhofflimmern
Angina pectoris
Nachsorge nach Herzkatheter
Hypertensive Entgleisungen
Die Patienten sind zum Großteil mobil und orientiert. Die Selbstpflegefähigkeit ist gegeben, aber oft eingeschränkt – nicht aus körperlicher, sondern aus gesundheitlicher Vorsicht.
2. Pflegeaufwand – Was muss geleistet werden?
Tägliche Aufgaben umfassen:





























