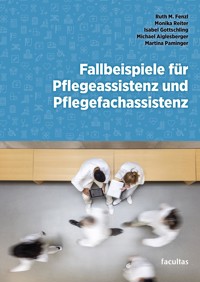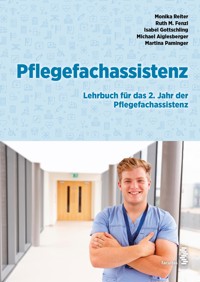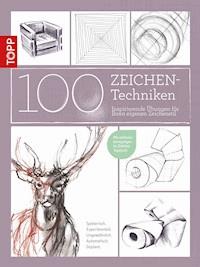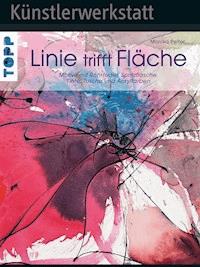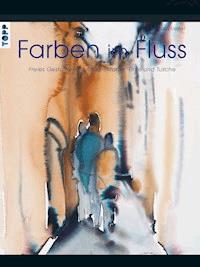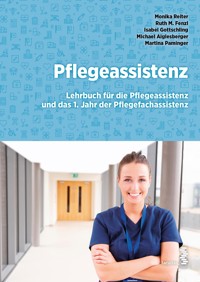
46,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In acht Lernfeldern beschreibt dieses Buch die Themenbereiche der Pflegeassistenzausbildung bzw. des 1. Ausbildungsjahres der Pflegefachassistenz. Die themenorientierte Darstellung fördert das vernetzte Denken: Zukünftige Pflegende lernen, Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit wahrzunehmen und so individuell bedürfnisorientierte Pflege und Betreuung zu gewährleisten. Lernfeld 1: Berufliche Identitätsentwicklung Lernfeld 2: Der gesunde Mensch Lernfeld 3: Der pflegebedürftige Mensch/Hygiene und Infektionslehre Lernfeld 4: Menschen im Krankenhaus pflegen Lernfeld 5: Menschen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen pflegen/Psychische Erkrankungen/Enterale Ernährung/Kinaesthetics Lernfeld 6: Menschen im Pflegewohnheim pflegen/Palliative Care und Pflege von verstorbenen Menschen Lernfeld 7: Menschen zu Hause pflegen/Diabetes mellitus Lernfeld 8: Berufstätig werden und bleiben/Erste Hilfe
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 876
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Reiter, Fenzl, Gottschling, Aiglesberger, Paminger
Pflegeassistenz
von l. nach r.: Reiter, Paminger, Fenzl, Gottschling, Aiglesberger
Monika Reiter, MBA: DGKP, Fachpflegerin für Anästhesiepflege, Lehrerin für Gesundheitsberufe, akad. Gesundheitsbildnerin, gerichtlich beeidete Pflegesachverständige, Mediatorin, Ethikberaterin im Gesundheitswesen (AEM).
Ruth M. Fenzl, MA, MBA: DGKP, Lehrerin für Gesundheitsberufe, Gerontologin, Sachverständige des BMGF, Ethikberaterin im Gesundheitswesen (AEM).
Isabel Gottschling BEd., MEd., MBA: DGKP, Lehrerin für Gesundheitsberufe, Kommunikationstrainerin, Praxisbegleiterin für Basale Stimulation® in der Pflege.
Mag. Michael Aiglesberger, BScN, MBA: Direktor der Schule für GuKP am Ordensklinikum Linz Barmherzige Schwestern, Lehrer für Gesundheitsberufe, Fachpfleger für Intensivpflege.
Martina Paminger: DGKP, Lehrerin für Gesundheitsberufe, Palliativpflegefachkraft, Lebens- und Sozialberaterin in Ausbildung unter Supervision, Leitung der Weiterbildung Palliative Care am BFI OÖ.
Trotz größter Bemühungen ist es nicht gelungen, alle Abbildungsquellen zu eruieren. Sollten Ansprüche gestellt werden, bitten wir darum, sie dem Verlag mitzuteilen.
Bibliografische Information Der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Alle Angaben in diesem Fachbuch erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr, eine Haftung der
AutorInnen oder des Verlages ist ausgeschlossen.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
3. Auflage 2024
Copyright © 2018 Facultas Verlags- und Buchhandels AG
facultas Verlag, Wien, Österreich
Umschlagbild: © monkeybusinessimages & © Designer, istockphoto.com
Lektorat: Katharina Schindl, Wien
Satz und Abbildungen: Florian Spielauer, Wien
Druck: finidr
Printed in the E. U.
ISBN 978-3-7089-2443-4
E-ISBN 978-3-99111-846-6
Inhalt
Hinweise zum Gebrauch des Buches
Vorwort
Lernfeld 1
Berufliche Identitätsentwicklung
Rechtliche Grundlagen
Die Gesetzgebung
Der Nationalrat
Der Bundesrat
Das Gesetzgebungsverfahren
Das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
Berufspflichten der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
Tätigkeitsbereiche in der Pflegeassistenz
Fort- und Weiterbildungen in der Pflegeassistenz
Das Sozialbetreuungsberufegesetz
Das Sozialbetreuungsberufegesetz am Beispiel Oberösterreich
Angehörige der Sozialbetreuungsberufe
Fort- und Weiterbildungen für Sozialbetreuungsberufe
Die Berufsbilder der Sozialbetreuung und Gesundheits- und Krankenpflege
Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege
Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz
Heimhilfe
Fach-Sozialbetreuung Altenarbeit
Fach-Sozialbetreuung Behindertenarbeit
Fach-Sozialbetreuung Behindertenbegleitung
Diplom-Sozialbetreuung Altenarbeit
Diplom-Sozialbetreuung Behindertenarbeit
Diplom-Sozialbetreuung Behindertenbegleitung
Diplom-Sozialbetreuung Familienarbeit
ArbeitnehmerInnenschutz
Brandschutz
Strahlenschutz (vgl. RIS 2023e, 2023f)
Das österreichische Gesundheitssystem ...
Finanzierung von Gesundheitsleistungen
Sozialversicherung
Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger
Ambulante/extramurale Gesundheitsversorgung
Stationäre/intramurale Gesundheitsversorgung
Arten von Krankenanstalten
Versorgungssektor von Krankenanstalten
Versorgungsbereich von Krankenanstalten
Krankenanstaltentypen
Finanzierung (Fondszugehörigkeit) von Krankenanstalten
Finanzierung intra- und extramuraler Gesundheitsversorgung
Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung
Finanzierung ambulanter medizinischer Leistungen
Organisation der sozialen Dienste
Alten- und Pflegeheime, betreutes Wohnen
Mobile Pflege und Betreuung für zu Hause
Kommunikation
Bedeutung im Rahmen der Pflege
Verschwiegenheit bei pflegerischen Tätigkeiten
Elemente der Kommunikation
Verbale Kommunikation
Nonverbale Kommunikation
Kommunikationsmodelle
„4-Ohren-Modell“ nach Schulz von Thun
Gewaltfreie Kommunikation (GFK) nach Marshall B. Rosenberg
Professionelle Sprache in Pflegeberufen
Grundlagen der Gesprächsführung
Personenzentrierte Gesprächsführung
Biografiearbeit
Störungen in der Kommunikation
Sprach- und Sprechstörungen
Störungen des Hörens
Störungen des Sehens
Deeskalationsmanagement
Animation und Motivation
Selbstbestimmung und Fremdbestimmung
Bedürfnis- und Motivationsmodelle
Maslow’sche Bedürfnispyramide
Alderfers ERG-Theorie
McClellands Motivationstheorie
16 Lebensmotive nach Steven Reiss
Team
Teamentwicklung
Selbst- und Fremdwahrnehmung
Diskussionsregeln
Feedback
Unterstützende Kommunikationsinstrumente
Coaching
Supervision
Mediation
Mentoring
Krisenintervention
Verantwortung
Verantwortung in der Pflege
Verantwortungsethik
Menschenbilder
Philosophische Anthropologie
Mechanistisches Menschenbild/Biomedizinisches Modell
Holistisches Menschenbild
Humanistisches Menschenbild
Ethik
Berufsethik/Berufsethos
Deontologie
Teleologie/Utilitarismus
Tugendethik
Care-Ethik
Prinzipienethik
Anwendung der Ethiktheorien
Berufskodizes
Das kann ich!
Lernfeld 2
Der gesunde Mensch
Gesundheit
Theorie und Geschichte des Begriffes „Gesundheit“
Definitionen von Gesundheit
Medizinische Sicht
Soziologische Sicht
Sicht der Weltgesundheitsorganisation
Sicht der Pflege
Gesundheitsdeterminanten
Gesundheitsförderung
Modell der Salutogenese
Pflegerisches Grundlagenwissen
Sich bewegen
Einflussfaktoren
Beobachtung
Dekubitusprophylaxe
Thromboseprophylaxe
Kontrakturprophylaxe
Sturzprophylaxe
Sich pflegen
Allgemeines
Beobachtung: die Haut
Unterstützung bei der Körperpflege
Intertrigoprophylaxe
Sich kleiden
Beeinflussende Faktoren
Unterstützung beim An- und Auskleiden
Hilfsmittel zum An- und Auskleiden
Techniken zum An- und Auskleiden
Das Konzept der Basalen Stimulation®
Allgemeines
Wahrnehmung
Stimulationsangebote
Wege der Kontaktaufnahme
Ganzkörperwaschung nach dem Konzept der Basalen Stimulation®
Atemstimulierende Einreibung (ASE)
Essen und Trinken
Einflussfaktoren
Energie aus Nährstoffen
Energiegehalt von Nährstoffen
Nährstoffverteilung
Die österreichische Ernährungspyramide
Die Ernährungspyramide für Kinder
Ernährungszustand
Flüssigkeitsbedarf
Flüssigkeitsbilanz
Pflegerische Interventionen zur Flüssigkeits-/Nahrungsaufnahme
Soor- und Parotitisprophylaxe
Aspirationsprophylaxe
Ausscheiden
Einflussfaktoren
Harnausscheidung
Stuhlausscheidung
Unterstützung bei Miktion und Defäkation
Obstipationsprophylaxe
Stuhltests
Uricult
Klistiere und Mikroklistiere
Vitale Funktionen aufrechterhalten
Bewusstsein
Atmung
Puls
Blutdruck
Körpertemperatur
Schweiß
Der Pflegeplanungsprozess als Kriterium professioneller Pflege
Pflegemodelle als Grundlage für die Pflegeplanung
Pflegeassessment
Der Pflegeprozess
Pflegedokumentation
Das kann ich!
Lernfeld 3
Der pflegebedürftige Mensch, Hygiene und Infektionslehre
Krankheit
Definitionen von Krankheit
Medizinische Sicht
Sozialrechtliche Sicht
Erleben und Bewältigen von Krankheit
Krankheitsprävention
Terminologie als Teil der Pflegefachsprache
Bedeutung der Terminologie im Rahmen der Pflege
Medizinische Terminologie
Grundsatzregeln der medizinischen Terminologie
Aussprache medizinischer Termini
Vorsilben
Nachsilben
Anatomische Richtungsbezeichnungen
Grundlagen der Pharmakologie
Allgemeines
Aufbewahrung und Lagerung von Arzneimitteln
Medikamentenschrank
Medikamentenkühlschrank
„Suchtgiftschrank“
Lagerungshinweise
Vorbereitung von Medikamenten
Verabreichung von Medikamenten
Orale Anwendung
Rektale bzw. vaginale Anwendung
Perkutane Anwendung
Parenterale Anwendung
Häufige Nebenwirkungen
Arzneimittelgruppen
Abführmittel (Laxanzien)
Antidiarrhoika
Antibakterielle Mittel (Antibiotika)
Virostatika
Antimykotika
Mittel gegen Läuse und Scabies
Antiwurmmittel
Blutgerinnungshemmende Medikamente (Antikoagulanzien)
Magenwirksame Mittel
Herz-Kreislauf-Medikamente
Blutdrucksenkende Medikamente (Antihypertensiva)
Blutdrucksteigernde Medikamente (Antihypotensiva)
Harntreibende Mittel (Diuretika)
Psychoaktive Mittel (Psychopharmaka)
Schmerzmittel (Analgetika)
Statine (Lipidsenker)
Medikamente bei Schilddrüsenerkrankungen
Antitussiva
Expektoranzien
Surfactant
Häufige Arzneimittelgruppen im Alter
Hygiene
Grundsätze zur hygienischen Arbeitsweise
Persönliche Hygiene
Mund- und Zahnhygiene
Haarhygiene
Nagelhygiene
Schmuck und Piercings
Berufskleidung
Bereichskleidung
Dienstschuhe
Persönliche Schutzausrüstung
Schutzkittel, Schürze
Schutzbrille
Kopfhaube
Bereichsschuhe
Mund-Nasenschutz
FFP2- und FFP3-Masken
Schutzhandschuhe
Die Haut
Händehygiene
Händewaschen
Hautpflege
Hygienische Händedesinfektion
Chirurgische Händedesinfektion
Reinigung und Desinfektion
Desinfektionsverfahren
Desinfektionsmittelwirkstoffe
Zubereitung und Anwendung der Desinfektionsmittellösung
Hygiene-, Reinigungs- und Desinfektionsplan
Sterilisation
Sterilisationsverfahren
Verpackung von Sterilisiergut
Be- und Entladen des Sterilisators
Lagerung der Sterilgüter
Entnahme von Sterilgut
Aufbereitung von Medizinprodukten
Infektionslehre
Allgemeines
Infektionsquellen
Übertragungswege
Seuchen
Seuchenbekämpfung
Nosokomiale Infektionen
Vermeidung nosokomialer Infektionen
Infektion mit Tuberkulose (TBC)
Infektion mit multiresistenten Erregern
Isolierung
Keimträger und Dauerausscheider
Umgang mit Untersuchungsmaterialien
Arbeitnehmerschutz – Infektionsschutz
Stich- und Schnittverletzungen
Vermeidung von Nadelstichverletzungen
Vorgehen bei Nadelstichverletzungen
Entsorgung medizinischer Abfälle
Pflegerische Interventionen bei Veränderungen von Körperfunktionen
Veränderungen des Körpergewichts
Übergewicht/Adipositas
Untergewicht
Mangelernährung
Veränderungen des Flüssigkeitshaushalts
Dehydratation
Hyperhydratation
Dysphagie – Schluckstörung
Maßnahmen nach einer Aspiration
Pflegerische Maßnahmen bei Diarrhö
Stomapflege
Versorgungsmöglichkeiten
Versorgungswechsel
Inkontinenz
Harninkontinenz
Extraurethrale Inkontinenz
Stuhlinkontinenz
Pflegerische Maßnahmen bei Inkontinenz
Erbrechen
Zerebrales/direktes Erbrechen
Peripheres/indirektes/reflektorisches Erbrechen
Beobachtungskriterien
Pflege bei Erbrechen
Geschlecht und Sexualität
Sexualität im Alter
Sexuelle Belästigung in der Pflege
Sexualität bei Menschen mit Beeinträchtigung/psychischen Erkrankungen
Transkulturelle Aspekte in der Pflege
Kommunikation
Glaube und Gebet
Essgewohnheiten
Umgang mit Kranken, Sterberituale
Gewalt
Formen von Gewalt
Direkte Gewalt
Strukturelle Gewalt
Kulturelle Gewalt
Ursachen und Häufigkeit von Gewalt
Risiken zur Entstehung von Gewalt
Warnzeichen
Prävention von Gewalt
Umgang mit Abhängigkeit und Substanzmissbrauch
Formen der Abhängigkeit
Ursachen für Abhängigkeitsentwicklungen
Folgen von Missbrauch und Abhängigkeit
Missbrauch und Abhängigkeit als Herausforderung für die Pflege
Das kann ich!
Lernfeld 4
Menschen im Krankenhaus pflegen
Existenzielle Erfahrungen
Krankheiten
Vier Stufen der Krisenbewältigung nach Cullberg
Akute, chronische und unheilbare Erkrankungen
Krankenhausaufenthalt und Einzug in eine Pflege-/Betreuungseinrichtung
Schmerzen
Assessmentinstrumente zur Beurteilung von Schmerzen
Qualitäten von Schmerz
Linderung von Schmerzen
Harnstreifentest
Wundversorgung
Umgang mit Wunddrainagen
Venöse Blutentnahme
Einflussfaktoren auf die Blutwerte
Venöse Blutentnahme bei Erwachsenen
Umgang mit Medizinprodukten
Produktklassen
Österreichisches Medizinproduktegesetz
Medizinproduktebetreiberverordnung
Einweisung
Einweisungsdokumentation
Das kann ich!
Lernfeld 5
Menschen in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen pflegen, Psychische Erkrankungen, Enterale Ernährung, Kinaesthetics
Grundlagen psychischer Erkrankungen
Diagnose
Risikofaktoren/Ursachen
Prävention/Therapie
Depression
Risiko und Ursachen
Symptome
Schweregrade
Diagnose
Therapie
Suizid
Enterale Ernährung
Sonden
Enterale Nahrungsverabreichung
Sondennahrung
Komplikationen
Kinaesthetics
Geschichtlicher Hintergrund
Ziele
Konzepte
Interaktion
Funktionale Anatomie
Menschliche Bewegung
Anstrengung
Menschliche Funktionen
Umgebung
Das kann ich!
Lernfeld 6
Menschen im Pflegewohnheim pflegen, Palliative Care und Pflege von verstorbenen Menschen
Der Schlaf und Schlafstörungen
Funktion des Schlafs
Beeinflussende Faktoren
Die Schlafqualität
Die Schlafquantität
Die Schlafumgebung
Der Schlafraum
Das Pflegebett
Das Betten
Die Schlafphasen
Schlafstörungen
Insomnie
Hypersomnie
Parasomnie
Schlafförderung
Aromapflege zur Schlafförderung
Alternative Einschlafhilfen
Einsatz von Medikamenten
Die Sinne und Sinneseinschränkungen
Der Geruchssinn
Der Geschmackssinn
Der Tastsinn
Das Hören
Das Sehen
Demenz (kognitive Störungen)
Ursachen
Diagnose
Symptome
Stadien
BPSD
Apathie
Agitiertheit
Pflege bei ausgewählten neurologischen Erkrankungen
Cerebraler Insult
Morbus Parkinson
Delir
Auslöser und Diagnosestellung
Delirformen und damit verbundene Gefahren
Symptome
Maßnahmen zur Prävention und Therapie
Palliative Care
Interdisziplinäre/interprofessionelle Zusammenarbeit
Hospiz
Geschichtliche Entwicklung
Entwicklung der Hospizbewegung in Österreich
Nationale und internationale Hospiz- und Palliativbetreuung
Der Sterbeprozess
Wann beginnt der Sterbeprozess?
Terminal- und Finalphase
Sterbephasen
Begleitung im Sterbeprozess
Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr
Ausscheidung
Bewegen
Körperpflege
Veränderung des Bewusstseins
Veränderung der Sinneswahrnehmungen
Veränderung der Atmung
Pflege von verstorbenen Menschen
Definition des Todes
Sichere Todeszeichen
Unsichere Todeszeichen
Erste Maßnahmen nach Eintritt des Todes
Weitere Pflegemaßnahmen
Körperpflege
Positionierung
Raumgestaltung
Begleitung der Angehörigen
Auch Pflegepersonen wollen Abschied nehmen
Abschiedsrituale
Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG)
Das kann ich!
Lernfeld 7
Menschen zu Hause pflegen, Diabetes mellitus
Pflege bei chronischen Erkrankungen
Pflege zu Hause
Der Weg in die Rolle des/der pflegenden Angehörigen
Motive für die Übernahme der Pflege und Betreuung eines/einer Angehörigen
Belastungen für pflegende Angehörige
Entlastungsangebote für pflegende Angehörige
Dienstleistungen zur Unterstützung der Pflege und Betreuung zu Hause
Hilfsmittel für die Pflege und Betreuung zu Hause
Milieugestaltung in verschiedenen Settings
Rechtliche und ethische Aspekte
Erwachsenenschutzgesetz und Vorsorgevollmacht
Patientenverfügung
Ethische Dilemmata
Verwahrlosung
Pflegegeld
Pflegebedarf
Erschwerniszuschläge
Diagnosebezogener Anspruch
Verfahren beim Entscheidungsträger
Höhe des Pflegegeldes
Familienhospizkarenz, Pflegekarenz
Diabetes mellitus
Formen
Diabetes mellitus Typ I (absoluter Insulinmangel)
Diabetes mellitus Typ II (relativer Insulinmangel)
Andere Diabetesformen
Anzeichen und Diagnose
HbA1c-Wert (Glykohämoglobin)
Blutzuckermessung aus der Kapillare
Behandlung
Diabetes mellitus Typ I
Diabetes mellitus Typ II
Pflegeschwerpunkt Haut und Füße
Körperpflege
Fußpflege
Ernährung
Insulinbedarf
Orale Antidiabetika
Biguanide
Sulfonylharnstoffe
Glinide
Alpha-Glukosidasehemmer
Inkretinverstärker
Gliflozine (SGLT-2-Inhibitoren)
Insulin
Verabreichung
Die subkutane Injektion
Die subkutane Insulinverabreichung mittels Einmalspritze
Insulininjektion mit dem Pen
Insulinverabreichung mittels Insulinpumpe
Lebensbedrohliche Situationen
Hyperglykämie
Hypoglykämie
Das kann ich!
Lernfeld 8
Berufstätig werden und bleiben, Erste Hilfe
Erste Hilfe
Rechtliche Grundlagen
Ziele
Aufgaben des Ersthelfers/der Ersthelferin
Rettungskette
Gefahrenzone
Absichern der Unfallstelle
Verhalten bei Unfällen
Verkehrsunfälle
Unfälle mit gefährlichen Gütern
Ski-/Lawinenunfälle
Einbrechen in Eis
Unfälle durch Verschütten
Brandunfälle
Gasunfälle
Elektrounfälle
Badeunfälle
Überlebenskette
ERC-Leitlinien zur Reanimation
Basismaßnahmen der Wiederbelebung
Maßnahmen zur Wiederbelebung von Kindern
Anwendung eines automatisierten externen Defibrillators
Erste Hilfe bei Verlegung der Atemwege durch einen Fremdkörper (Ersticken)
Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Verletzungen
Blutung
Schock
Wunden
Organisation von Einrichtungen im Gesundheitswesen
Aufbauorganisation
Kollegiale Führung im Krankenhaus
Führung in der stationären Langzeitpflege
Ablauforganisation (Prozessmanagement)
Stellenbildung
Stellenbeschreibung
Öffentlichkeitsarbeit
Interne Öffentlichkeitsarbeit
Externe Öffentlichkeitsarbeit
Leitbild
Nahtstellenmanagement
Führung
Führungsprozess
Führungsstile
Mitarbeitergespräch
Stress
Allgemeines Adaptationssyndrom nach Hans Selye
Eustress
Disstress
Stressmodell nach Richard S. Lazarus
Resilienz
Coping
Qualitätsmanagement
Pflegequalität
Kategorien von Qualität
Qualitätsmanagementsysteme
Risikomanagement
Fehlermanagement
Beschwerdemanagement
Gesundheitsberuferegister-Gesetz (GBRG)
Berufspolitische Vertretung der Pflegeberufe
Gesetzliche Interessenvertretung
Freiwillige Interessenvertretung
Österreichischer Gewerkschaftsbund (ÖGB)
ÖGB/ARGE-Fachgruppenvereinigung für Gesundheits- und Sozialberufe (ARGE-FGV)
Gesundheitsberufekonferenz (GBK)
Das kann ich!
Quellen- und Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Hinweise zum Gebrauch des Buches
Wichtige Worte im Text sind fett gedruckt.
Kernaussagen
sind orange hinterlegt.
Aufgaben
,
Beispiele
…
… und
Tipps
sind blau hinterlegt.
Am Ende jedes Abschnitts finden Sie eine Übersicht zur Wissensüberprüfung.
Vorwort
Dieses Buch dient als Lerngrundlage für Ausbildungen in Pflegeassistenz- bzw. Pflegefachassistenzberufen (1. Ausbildungsjahr). Die 3. Auflage wurde inhaltlich erweitert und umstrukturiert. Grundlage dafür stellt das Curriculum für die Pflegeassistenzausbildung dar. Inhaltlich sind die Themenbereiche laut GuGK 2016 (BGBl. Nr. 75/2016) abgebildet: Grundsätze der professionellen Pflege I und II, Grundzüge medizinischer Diagnostik und Therapie in der Akut- und Langzeitversorgung einschließlich medizinische Pflegetechnik Teil 1 und 2 (ausgenommen Anatomie, Physiologie sowie ausgewählte praxisrelevante Krankheitsbilder), Pflegeprozess I, Beziehungsgestaltung und Kommunikation, Kooperation, Koordination und Organisation sowie Entwicklung und Sicherung von Qualität I.
Zur Förderung der Vernetzungskompetenz, die für den Umgang mit den multiplen Herausforderungen im Pflegealltag erforderlich ist, wurden die angeführten Themenbereiche in acht Lernfeldern bearbeitet. Pflegekräfte müssen in der Praxis ganzheitlich beobachten und adäquat handeln können. Das lernfeldorientierte Konzept unterstützt dies durch den Erwerb und Ausbau von handlungsorientiertem Wissen.
Ziel des Buches ist es, den zukünftigen Pflegenden die Kompetenz zu vermitteln, Menschen in ihrer Ganzheitlichkeit wahrzunehmen, um individuelle, auf deren Bedürfnisse abgestimmte Pflege und Betreuung zu ermöglichen.
Die Autorinnen und der Autor im Frühjahr 2024
Mit dem vorliegenden Buch soll eine Grundlage für die Lehrinhalte des 1. Jahres geboten werden, es wird jedoch kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. Je nach Schwerpunkten können und sollen die dargebotenen Lehrinhalte von den jeweiligen Lehrenden erweitert und vertieft werden.
Lernfeld 1
Berufliche Identitätsentwicklung
Dieses Lernfeld bietet einen ersten Einblick in unser Gesundheitssystem und setzt sich mit gesetzlichen und ethischen Grundlagen auseinander. Es soll die Lernenden dabei unterstützen, ein konkreteres Bild der An- und Herausforderungen des Pflegeberufes zu bekommen, und aufzeigen, wie diese bewältigbar sind.
Rechtliche Grundlagen
Der rechtliche Rahmen regelt das Zusammenleben von Menschen. Egal, ob es sich um einen Einkauf, eine Zugfahrt, ein Bauvorhaben oder um die Ausübung eines Berufs handelt, Gesetze begleiten uns permanent. Deshalb ist ein grundlegendes Verständnis für die Prozesse der österreichischen Gesetzgebung erforderlich.
Die Gesetzgebung
Die Gesetzgebung bildet die Grundlage für das Handeln des Staates. Gesetze werden in den Parlamenten von Bund und Ländern beschlossen. Das sind der National- und der Bundesrat sowie die Landtage in den jeweiligen Bundesländern. In speziellen Fällen (z. B. Angelobung der/des BundespräsidentIn) treten der Nationalrat und der Bundesrat gemeinsam auf. Dann wird von einer Bundesversammlung gesprochen (vgl. Parlament 2018).
Die Parlamente nehmen eine zentrale Stellung im politischen Prozess und in der Organisation des Staates ein. Gerichte können beispielsweise nur das tun, was in den Gesetzen festgelegt ist (vgl. Parlament 2020a).
Merke: Der Begriff „Parlament“ ist umgangssprachlich weit verbreitet. Darunter wird im österreichischen Sprachgebrauch meist nur der Nationalrat verstanden.
Der Nationalrat
Der Nationalrat setzt sich aus 183 Abgeordneten zusammen und wird für eine Gesetzgebungsperiode von fünf Jahren gewählt. Neben der Gesetzgebung, die gemeinsam mit dem Bundesrat vollzogen wird, hat er sehr wichtige Kontrollfunktionen inne. Der Nationalrat prüft beispielsweise die Arbeit der Bundesregierung. Die Abgeordneten können aber auch politische Anliegen an die Regierung richten. Des Weiteren achtet der Nationalrat auf die Transparenz von politischen Prozessen und Entscheidungen. Aus diesem Grund sind seine Sitzungen in der Regel öffentlich (vgl. Parlament 2020b).
Merke: Die Bundesregierung ist neben dem/der BundespräsidentIn eines der obersten Organe der Bundesverwaltung. Da es sich hierbei um ein sogenanntes Kollegialorgan handelt, bestehen ihre Mitglieder aus dem/der BundeskanzlerIn, dem/der VizekanzlerIn und den BundesministerInnen.
Der Bundesrat
Die primäre Aufgabe des Bundesrates besteht in der Vertretung der Interessen der Länder. Die 61 Mitglieder werden von den neun Landtagen (jedes Bundesland hat einen Landtag) entsandt und spiegeln in etwa die Zusammensetzung des jeweiligen Landtages wider (vgl. Parlament 2021c). Die Anzahl der Mitglieder wird nach jeder allgemeinen Volkszählung nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen der neun Bundesländer zueinander festgelegt. Das einwohnerstärkste Bundesland erhält zwölf Sitze. Mindestens muss ein Bundesland aber drei Sitze erhalten.
Im Vergleich zum Nationalrat hat der Bundesrat in der politischen Praxis einen sehr geringen Einfluss. Gegenüber dem Nationalrat hat er ein aufschiebendes Vetorecht. Damit ergibt sich im Regelfall nur eine aufschiebende Wirkung bei der Ablehnung eines Gesetzes (vgl. Parlament 2021c).
Das Gesetzgebungsverfahren
In einem ersten Schritt wird ein sogenannter Antrag auf ein neues Gesetz gestellt. Dieser kann von der Bundesregierung, dem Bundesrat oder aber auch durch das Volk gestellt werden. In einem nächsten Schritt kann die erste Lesung im Nationalrat erfolgen. Hierbei wird ganz allgemein über den Inhalt des Gesetzestextes und über die Zuweisung an einen Ausschuss beraten. Im Ausschuss wird der Antrag konkret ausgearbeitet. ExpertInnen können zurate gezogen werden. Bei der zweiten Lesung im Nationalrat wird über den Entwurf des Ausschusses diskutiert. Optional werden noch Änderungen vorgenommen. Danach erfolgt die Abstimmung über den Gesetzesantrag. Bei der dritten Lesung im Nationalrat wird endgültig über den Gesetzesentwurf angestimmt. Danach hat der Bundesrat die Möglichkeit, dem Gesetz zuzustimmen oder ein Veto (= Einspruch) einzulegen (Hinweis: kein Einspruchsrecht z. B. beim Budget). Bei einer Zustimmung des Bundesrats erteilt der/die BundespräsidentIn mit seiner/ihrer Unterschrift das ordnungsgemäße Zustandekommen des Gesetzes. In einem letzten Schritt erfolgt die Gegenzeichnung des Bundeskanzlers bzw. der Bundeskanzlerin. Danach muss diese bzw. dieser den Beschluss im Bundesgesetzblatt veröffentlichen (vgl. Refreshpolitics 2023; vgl. Parlament 2020a).
Abb. 1: Gesetzgebungsverfahren
Das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
Am 19. August 1997 wurde mit dem Bundesgesetzblatt 108 das alte Krankenpflegegesetz von 1961 durch das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz ersetzt. Es ist bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt die Grundlage für die Gesundheits- und Krankenpflegeberufe in Österreich. Im Laufe der Jahre wurde dieses Gesetz durch weitere Bundesgesetzblätter verändert bzw. novelliert (z. B. BGBl. I Nr. 128/2022).
Hinweis: Das alte Krankenpflegegesetz von 1961 regelte mehr als nur die pflegerischen Berufe. Neben dem Krankenpflegefachdienst wurden auch die medizinisch-technischen Dienste und die Sanitätshilfsdienste geregelt. Mit dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz haben die Pflegeberufe nun ein eigenständiges Gesetz.
Merke: Eine Novelle ist ein Änderungsgesetz. Hierbei werden bestehende Gesetze in einzelnen Teilen abgeändert.
Aufgabe: Das Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS) dient der Kundmachung von Gesetzen. Versuchen Sie über das RIS (https://www.ris.bka.gv.at/) die gesamte und aktuelle Rechtsvorschrift für das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz zu finden!
Berufspflichten der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe
Das 1997 verabschiedete Gesundheits- und Krankenpflegegesetz regelte, wie bereits erwähnt, ausschließlich die pflegerischen Berufe. Zu diesen Berufen zählen der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und die Pflegehilfe. Durch die Gesetzesnovelle im Jahr 2016 kam es zu einer Veränderung. Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind demnach lt. § 1 GuKG 1997:
1. der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege,
2. die Pflegefachassistenz und
3. die Pflegeassistenz.
Die Berufspflichten der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind im 1. Hauptstück (2. Abschnitt) des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes geregelt.
Allgemeine Berufspflichten
„§ 4. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben ihren Beruf ohne Unterschied der Person gewissenhaft auszuüben. Sie haben das Wohl und die Gesundheit der Patienten, Klienten und pflegebedürftigen Menschen unter Einhaltung der hiefür [sic] geltenden Vorschriften und nach Maßgabe der fachlichen und wissenschaftlichen Erkenntnisse und Erfahrungen zu wahren. Jede eigenmächtige Heilbehandlung ist zu unterlassen.
(2) Sie haben sich über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse der Gesundheits- und Krankenpflege sowie der medizinischen und anderer berufsrelevanter Wissenschaften regelmäßig fortzubilden.
(3) Sie dürfen im Falle drohender Gefahr des Todes oder einer beträchtlichen Körperverletzung oder Gesundheitsschädigung eines Menschen ihre fachkundige Hilfe nicht verweigern.“ (§ 4 GuKG 1997)
Aufgabe: Laut dem Strafgesetzbuch (§ 110 (1) StGB) ist eine eigenmächtige Heilbehandlung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu sechs Monaten oder mit einer Geldstrafe von bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Finden Sie fünf Beispiele für eine eigenmächtige Heilbehandlung in der Gesundheits- und Krankenpflege!
Pflegedokumentation
„§ 5. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben bei Ausübung ihres Berufes die von ihnen gesetzten gesundheits- und krankenpflegerischen Maßnahmen zu dokumentieren.
(2) Die Dokumentation hat insbesondere die Pflegeanamnese, die Pflegediagnose, die Pflegeplanung und die Pflegemaßnahmen zu enthalten.
(3) Auf Verlangen ist
1. den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen,
2. deren gesetzlichen Vertretern oder
3. Personen, die von den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen bevollmächtigt wurden, Einsicht in die Pflegedokumentation zu gewähren und gegen Kostenersatz die Herstellung von Kopien zu ermöglichen. […]“ (§ 5 GuKG 1997)
Merke: Bei der Pflegedokumentation werden die im Pflegeprozess geplanten und durchgeführten Maßnahmen, weitere Beobachtungen, Besonderheiten bzw. Veränderungen systematisch (z. B. mittels EDV) dokumentiert. Dadurch werden Informationen zur Therapiesicherung in medizinischer und pflegerischer Hinsicht, zur Rechenschaftslegung sowie zur Beweissicherung gesammelt (vgl. PRO PflegeManagement 2023).
Verschwiegenheitspflicht
„§ 6. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind zur Verschwiegenheit über alle ihnen in Ausübung ihres Berufes anvertrauten oder bekannt gewordenen Geheimnisse verpflichtet.
(2) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn
1. die durch die Offenbarung des Geheimnisses betroffene Person den Angehörigen eines Gesundheits- und Krankenpflegeberufes von der Geheimhaltung entbunden hat oder
2. die Offenbarung des Geheimnisses für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist oder
3. Mitteilungen des Angehörigen eines Gesundheits- und Krankenpflegeberufes über den Versicherten an Träger der Sozialversicherung und Krankenfürsorgeanstalten zum Zweck der Honorarabrechnung, auch im automationsunterstützten Verfahren, erforderlich sind.“ (§ 6 GuKG 1997)
Aufgabe: Sie haben vor fünf Jahren ein Praktikum in einem Alten- und Pflegeheim absolviert. Im Rahmen eines Pausengespräches tauschen Sie sich mit einer Arbeitskollegin über dieses Praktikum aus. Weil es schon viele Jahre zurückliegt, erzählen Sie über die medizinischen Diagnosen einer Klientin. Besteht hier noch eine Verschwiegenheitspflicht?
Anzeigepflicht
„§ 7. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe sind zur Anzeige an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft verpflichtet, wenn sich in Ausübung der beruflichen Tätigkeit der begründete Verdacht ergibt, dass durch eine gerichtlich strafbare Handlung
1. der Tod, eine schwere Körperverletzung oder eine Vergewaltigung herbeigeführt wurde oder
2. Kinder oder Jugendliche misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden oder worden sind oder
3. nicht handlungs- oder entscheidungsfähige oder wegen Gebrechlichkeit, Krankheit oder einer geistigen Behinderung wehrlose Volljährige misshandelt, gequält, vernachlässigt oder sexuell missbraucht werden oder worden sind.
(2) Eine Pflicht zur Anzeige […] besteht nicht, wenn
1. die Anzeige dem ausdrücklichen Willen des volljährigen handlungs- oder entscheidungsfähigen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen widersprechen würde, sofern keine unmittelbare Gefahr für diese oder eine andere Person besteht, oder
2. die Anzeige im konkreten Fall die berufliche Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf, sofern nicht eine unmittelbare Gefahr für diese oder eine andere Person besteht, oder
3. der Berufsangehörige, der seine berufliche Tätigkeit im Dienstverhältnis ausübt, eine entsprechende Meldung an den Dienstgeber erstattet hat und durch diesen eine Anzeige an die Kriminalpolizei oder die Staatsanwaltschaft erfolgt ist.
(3) Weiters kann […] die Anzeige unterbleiben, wenn sich der Verdacht gegen einen Angehörigen (§ 72 Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974) richtet, sofern dies das Wohl des Kindes oder Jugendlichen erfordert und eine Mitteilung an die Kinder- und Jugendhilfeträger und gegebenenfalls eine Einbeziehung einer Kinderschutzeinrichtung an einer Krankenanstalt erfolgt.“ (§ 7 GuKG 1997)
Merke: Zu den Opferschutzeinrichtungen werden Rechtsberatungsstellen, Frauennotrufe bzw. Frauenberatungsstellen, Kinderschutzzentren, Frauenhäuser oder auch Männerberatungsstellen gezählt.
Aufgabe: Während Ihres Praktikums in der HNO-Abteilung spricht Sie die fünfjährige Anna im Rahmen Ihrer Routinetätigkeit an und erzählt, dass ihre Mama viel zu wenig Zeit für sie hat. Sie muss immer arbeiten. Oft muss Anna nach dem Kindergarten auf ihre Mutter warten. Das findet sie sehr schade. Besteht hier eine Anzeigepflicht?
Merke: Die Anzeigepflicht in § 7 und die (ehemalige) Meldepflicht in § 8 werden seit dem 30. Oktober 2019 durch eine vereinheitlichte Anzeigepflicht geregelt.
Auskunftspflicht
„§ 9. (1) Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe haben
1. den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen,
2. deren gesetzlichen Vertretern oder
3. Personen, die von den betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen als auskunftsberechtigt benannt wurden, alle Auskünfte über die von ihnen gesetzten gesundheits- und krankenpflegerischen Maßnahmen zu erteilen.
(2) Sie haben anderen Angehörigen der Gesundheitsberufe, die die betroffenen Patienten, Klienten oder pflegebedürftigen Menschen behandeln oder pflegen, die für die Behandlung und Pflege erforderlichen Auskünfte über Maßnahmen gemäß Abs. 1 zu erteilen.“ (vgl. RIS 2023)
Merke: Die Auskunftspflicht ist im Zusammenhang mit der Verschwiegenheitspflicht und der Dokumentationspflicht zu betrachten. Für das notwendige Vertrauensverhältnis zu PatientInnen sind diese drei Pflichten von großer Bedeutung.
Exkurs: Gesundheitsberuferegister-Gesetz
Mit 30. Juni 2018 wurde in den Berufspflichten der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe der § 10 (Berufsausweis) durch das BGBl. I Nr. 87/2016 aufgehoben. Seit 1. Juli 2018 regelt das Gesundheitsberuferegister-Gesetz u. a. den Berufsausweis. Für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe (Diplomierte Gesundheits- und KrankenpflegerIn, PflegefachassistentIn, PflegeassistentIn (inkl. Sozialbetreuungsberufe)) ist seitdem die Eintragung in das Gesundheitsberuferegister Voraussetzung, um im jeweiligen Gesundheitsberuf tätig zu werden.
Die Arbeiterkammer (AK) ist für einen Großteil die zuständige Registrierungsbehörde (Angestellte, freie DienstnehmerInnen, Karenzierte, Arbeitslose, Berufsangehörige der Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz sowie AbsolventInnen der Gesundheits- und Krankenpflegeschulen). Die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) registriert bspw. (überwiegend) freiberuflich Tätige, Ehrenamtliche oder auch FachhochschulabsolventInnen (Studium der Gesundheits- und Krankenpflege).
Nach erfolgreicher Registrierung erfolgt die Zustellung des Berufsausweises per Post (Dauer: etwa drei Wochen). Die Registrierung und der Berufsausweis sind für fünf Jahre gültig. Vor Ablauf erhält man von der Registrierungsbehörde ein Erinnerungsschreiben (vgl. AK Oberösterreich 2023).
Merke: BerufseinsteigerInnen der Berufe Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz müssen sich vor Berufsantritt registrieren lassen. Der Eintrag in das Register ist verpflichtend und Voraussetzung für die Berufsausübung.
Tätigkeitsbereiche in der Pflegeassistenz
Im 1. Hauptstück des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes sind die Berufspflichten der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe (gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege, Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz) festgelegt.
Das 2. Hauptstück beinhaltet den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege (z. B. Berufsbild, pflegerische Kernkompetenzen, Intensivpflege, Anästhesiepflege, Pflege bei Nierenersatztherapie).
Im 3. Hauptstück werden die Pflegeassistenzberufe beschrieben. Hier sind noch weitere Rechte und Pflichten bzw. Tätigkeitsbereiche für die Pflegeassistenzberufe festgelegt.
Pflegeassistenzberufe (die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz) unterstützen ganz allgemein die Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege sowie Ärztinnen und Ärzte (vgl. RIS 2023 § 82 GuKG).
Die Tätigkeitsbereiche der Pflegeassistenz beziehen sich auf
a) die Mitwirkung und Durchführung von übertragenen Pflegemaßnahmen,
b) das Handeln im Notfall sowie
c) die Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie.
Zu den übertragenen Pflegemaßnahmen zählen:
► die Mitwirkung beim Pflegeassessment,
► die Beobachtung des Gesundheitszustands,
► die Durchführung der übertragenen Pflegemaßnahmen,
► die Information, Kommunikation und Begleitung sowie
► die Mitwirkung an der praktischen Ausbildung in der Pflegeassistenz.
Merke: Pflegemaßnahmen dürfen nur nach Anordnung und unter Aufsicht von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege erfolgen.
Handeln im Notfall: In Notfällen bezieht sich der Tätigkeitsbereich auf die eigenverantwortliche Durchführung lebensrettender Sofortmaßnahmen, solange und soweit eine Ärztin oder ein Arzt nicht zur Verfügung steht. Zu diesen Maßnahmen zählen:
► Die Herzdruckmassage und die Beatmung mit einfachen Beatmungshilfen,
► die Durchführung der Defibrillation mit halbautomatischen Geräten oder Geräten im halbautomatischen Modus sowie
► die Verabreichung von Sauerstoff.
Merke: Die Verständigung eines Arztes/einer Ärztin ist unverzüglich zu veranlassen.
Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie: Nach einer schriftlichen ärztlichen Anordnung und unter Aufsicht von Ärztinnen/Ärzten oder Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege bezieht sich die Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie auf folgende Bereiche:
► Verabreichung von lokal, transdermal sowie über Gastrointestinal- und/oder Respirationstrakt zu verabreichenden Arzneimitteln,
► Verabreichung von subkutanen Insulininjektionen und subkutanen Injektionen von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln,
► Ab- und Anschließen laufender Infusionen ausgenommen Zytostatika und Transfusionen mit Vollblut und/oder Blutbestandteilen, bei liegendem periphervenösen Gefäßzugang, die Aufrechterhaltung dessen Durchgängigkeit sowie gegebenenfalls die Entfernung desselben,
► Entfernung von subkutanen und periphervenösen Verweilkanülen,
► standardisierte Blut-, Harn- und Stuhluntersuchungen sowie Blutentnahme aus der Kapillare,
► Blutentnahme aus der Vene (Kinder sind hierbei ausgenommen),
► Durchführung von Mikro- und Einmalklistieren,
► Durchführung einfacher Wundversorgung, einschließlich Anlegen von Verbänden, Wickeln und Bandagen,
► Durchführung von Sondenernährung bei liegenden Magensonden,
►Absaugen aus den oberen Atemwegen sowie dem Tracheostoma in stabilen Pflegesituationen,
► Erhebung und Überwachung von medizinischen Basisdaten (Puls, Blutdruck, Atmung, Temperatur, Bewusstseinslage, Gewicht, Größe, Ausscheidungen) sowie
► einfache Wärme-, Kälte- und Lichtanwendungen. (vgl. RIS 2023 § 83 GuKG)
Aufgabe: Diskutieren Sie in der Kleingruppe, was unter den aufgelisteten Bereichen jeweils zu verstehen ist. Machen Sie sich eine Liste mit bekannten und weniger bekannten Inhalten. Besprechen Sie später Ihre Ergebnisse in der Großgruppe.
Fort- und Weiterbildungen in der Pflegeassistenz
Berufliche Fort- und Weiterbildungen sind gesetzlich definiert. Im privaten Bereich werden die Begriffe oftmals synonym verwendet. Die private Weiterbildung am Computer wird dann oft auch als Fortbildung oder Ausbildung bezeichnet. Handelt es sich jedoch um Bildungsmaßnahmen, die auf beruflicher Ebene stattfinden, erfolgt eine klare Trennung zwischen einer Fortbildung und einer Weiterbildung.
Eine Fortbildung bezieht sich auf den derzeit ausgeübten Beruf. Es erfolgt der gezielte Erwerb von Fähigkeiten, die beispielsweise auf die Ausübung bevorstehender Aufgaben ausgerichtet sind. PflegeassistentInnen sind verpflichtet, innerhalb von jeweils fünf Jahren Fortbildungen in der Dauer von mindestens 40 Stunden zu besuchen. Über den Besuch einer Fortbildung muss eine Bestätigung ausgestellt werden. Bei diesen Fortbildungen werden Informationen über die neuesten Entwicklungen und Erkenntnisse der Gesundheits- und Krankenpflege sowie eine Vertiefung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten vermittelt (vgl. Ris 2023 § 104c GuKG).
Eine Weiterbildung steht oftmals nicht in direktem Bezug zum bestehenden Beruf. Bei Weiterbildungen wird das persönliche Qualifikationsprofil ausgebaut. Hierbei können auch Zusatzqualifikationen erworben werden. PflegeassistentInnen sind berechtigt, Weiterbildungen zur Erweiterung der in der Ausbildung erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten zu absolvieren. Diese haben mindestens vier Wochen zu umfassen. Weiterbildungen können im Rahmen eines Dienstverhältnisses absolviert werden. Nach Abschluss einer entsprechenden Weiterbildung ist eine Prüfung abzulegen. Über die erfolgreich abgelegte Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. Mit diesem Zeugnis ist der/die PflegefachassistentIn berechtigt, eine Zusatzbezeichnung zu tragen (vgl. RIS 2023 § 104a GuKG).
Merke: Innerhalb von jeweils fünf Jahren müssen Fortbildungen in der Dauer von mindestens 40 Stunden besucht werden. Weiterbildungen haben mindestens vier Wochen zu umfassen und schließen mit einer Prüfung ab.
Das Sozialbetreuungsberufegesetz
Am 29. Juni 2005 wurde das Bundesgesetzblatt Nr. I 55/2005 verabschiedet. In Art. 15a B-VG wurde zwischen dem Bund und den Ländern vereinbart, die Tätigkeit und die Ausbildung der Angehörigen der Sozialbetreuungsberufe nach gleichen Zielsetzungen und Grundsätzen zu regeln. Die Länder verpflichteten sich, die Berufsbilder und Tätigkeitsbereiche der Sozialbetreuungsberufe (z. B. Fach-SozialbetreuerIn Schwerpunkt Altenarbeit) in ihren Rechtsvorschriften zu regeln (vgl. BGBl. Nr. 55/2005).
Das Sozialbetreuungsberufegesetz am Beispiel Oberösterreich
Im oberösterreichischen Landtag wurde daraufhin das Oberösterreichische Sozialberufegesetz (LGBl. Nr. 63/2008) beschlossen, das am 1. August 2008 in Kraft trat. Gleichzeitig wurde das Oberösterreichische Altenfachbetreuungs- und Heimhilfegesetz, in dem die Berufsbilder für die Altenfachbetreuung und die Heimhilfe in Oberösterreich geregelt waren, außer Kraft gesetzt. Vor dem Inkrafttreten des Oberösterreichischen Sozialberufegesetzes wurden im Bereich des pflegerischen Fachpersonals (z. B. in Alten- und Pflegeheimen) im Wesentlichen Personen aus dem Bereich des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege (DGKP), PflegehelferInnen (PH) sowie AltenfachbetreuerInnen (Afb) beschäftigt (vgl. Nöstlinger 2009, S. 72).
Abb. 2: Pflegerisches Fachpersonal vor Inkrafttreten des Oberösterreichischen Sozialberufegesetzes
Die gesetzlichen Grundlagen für die in Abb. 2 dargestellten Berufsgruppen waren das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege und die Pflegehilfe) sowie das Oberösterreichische Altenfachbetreuungs- und Heimhilfegesetz (AFBHG) (Ergänzungsausbildung für die Pflegehilfe). Diese Ergänzungsausbildung im Umfang von 250 Stunden wurde landesgesetzlich geregelt, da die Ausbildung für die Pflegehilfe im gerontologisch-geriatrischen Bereich nicht besonders umfassend war.
Merke: Personen, die beispielsweise in einem oberösterreichischen Alten- und Pflegeheim als AltenfachbetreuerInnen tätig waren (vor dem 1. August 2008), wurden durch die Grundlage von zwei unterschiedlichen Gesetzen ausgebildet.
Das mit 1. August 2008 in Kraft getretene „neue“ Oberösterreichische Sozialbetreuungsberufegesetz regelt nun Ausbildungen und Tätigkeitsbereiche, die die soziale Betreuung von Menschen, welche aufgrund ihres Alters, einer Behinderung oder einer anderen schwierigen Lebenslage Unterstützung benötigen, zum Inhalt haben, sowie die Ausbildung im Bereich der Altenarbeit. AltenfachbetreuerInnen, die auf der Grundlage des Oberösterreichischen AFBHG eine Ausbildung absolviert haben, sind auch nach dem neuen Oberösterreichischen Sozialbetreuungsberufegesetz zur Berufsausübung als FachsozialbetreuerInnen im Bereich Altenarbeit berechtigt und dürfen die entsprechende Berufsbezeichnung führen (vgl. RIS 2023a Oö. SBBG; vgl. Nöstlinger 2009, S. 72–74).
Angehörige der Sozialbetreuungsberufe
Als Angehörige der Sozialbetreuungsberufe gelten Diplom-SozialbetreuerInnen, Fach-SozialbetreuerInnen und HeimhelferInnen.
►Diplom-SozialbetreuerInnen (DSB) können ihre Tätigkeiten mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (A), Familienarbeit (F), Behindertenarbeit (BA) oder Behindertenbegleitung (BB) ausüben.
► Bei Fach-SozialbetreuerInnen (FSB) liegen die Schwerpunkte in der Altenarbeit (A), Behindertenarbeit (BA) und Behindertenbegleitung (BB).
►HeimhelferInnen (HH) zählen nur dann als Angehörige von Sozialbetreuungsberufen, wenn eine derartige Ausbildung in den landesrechtlichen Vorschriften vorgesehen ist. Dies ist beispielsweise in Oberösterreich der Fall (vgl. RIS 2023a Oö. SBGB; Nöstlinger 2009, S. 77).
Abb. 3: Übersicht Sozialbetreuungsberufe
Fort- und Weiterbildungen für Sozialbetreuungsberufe
Ähnlich wie in der Pflegeassistenz (Regelung durch § 104 GuKG 1997) sind auch für die Sozialbetreuungsberufe die Fort- und Weiterbildungen gesetzlich geregelt (Regelung durch das Sozialbetreuungsberufegesetz, BGBl. Nr. 55/2005).
► HeimhelferInnen sind demnach verpflichtet, im Zeitraum von 2 Jahren mindestens 16 Stunden an Fortbildung zu absolvieren.
► Fach-SozialbetreuerInnen sind verpflichtet, im Zeitraum von 2 Jahren mindestens 32 Stunden an Fortbildung zu absolvieren.
► Diplom-SozialbetreuerInnen müssen ebenfalls im Zeitraum von 2 Jahren mindestens 32 Stunden an Fortbildung absolvieren.
Aufgabe: Vergleichen Sie nun die PflegeassistentInnen sowie die Sozialbetreuungsberufe im Hinblick auf die gesetzlich zu absolvierenden Fortbildungsstunden. Welche Unterschiede zeigen sich? Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse in der Gruppe!
Die Berufsbilder der Sozialbetreuung und Gesundheits- und Krankenpflege
In den vorhergehenden Kapiteln wurden u. a. verschiedene Berufsgruppen den jeweiligen Gesetzen zugeordnet. Dadurch konnte eine klare Zuteilung der Berufsgruppen erfolgen. Im Berufsalltag eines Alten- und Pflegeheimes ist so eine Zuteilung dann doch etwas komplexer. Es zeigt sich hierbei eine enge Verbindung zwischen dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz und dem Sozialbetreuungsberufegesetz. Beispielsweise gliedert sich der Tätigkeitsbereich von Fach-SozialbetreuerInnen in einen eigenverantwortlichen Bereich lt. Oö. Sozialbetreuungsberufegesetz (z. B. Maßnahmen der Anleitung) und einen Bereich lt. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (z. B. Verabreichung von transdermalen Arzneimitteln im Rahmen der Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie).
Merke: PflegeassistentInnen haben lt. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz keinen eigenverantwortlichen Bereich (vgl. RIS 2023 § 83 GuKG).
Bereits in der Ausbildung zu einem/einer oberösterreichischen Fach-SozialbetreuerIn zeigt sich die enge Verbindung der beiden Berufsgesetze. Die Ausbildung zum/zur Diplom-SozialbetreuerIn bzw. zum/zur Fach-SozialbetreuerIn in den Schwerpunkten „Altenarbeit“, „Familienarbeit“ (nur auf Diplomniveau möglich) und „Behindertenarbeit“ inkludiert auch die Ausbildung zum/zur PflegeassistentIn, dessen/deren Tätigkeitsbereiche im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz geregelt werden. Die nachstehende Abbildung zeigt Sozialbetreuungsberufe mit Qualifikation einer/eines PflegeassistentIn.
Abb. 4: Verbindung Sozialbetreuungsberufe und Pflegeassistenz (PA)
Die gesetzlich definierten Berufsbilder (z. B. für die Pflegeassistenz) umfassen detaillierte Beschreibungen von Tätigkeiten eines spezifischen Berufs. Ein Berufsbild zeigt die für den Beruf geltenden Rechtsnormen und Standards. Es werden Tätigkeiten und Aufgaben und oftmals auch Ausbildungen (z. B. Dauer) und Qualifikationen (z. B. Fort- und Weiterbildungspflicht) schriftlich festgelegt. Das Vorhandensein eines Berufsbildes trägt zum beruflichen Selbstbewusstsein einer Berufsgruppe bei. Es führt zur Identität einer Gruppe, die dadurch in der Öffentlichkeit leichter wahrgenommen wird.
Am Beispiel der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe bzw. Sozialbetreuungsberufe zeigt sich, dass jeder Beruf in diesen beiden Gruppen ein eigenes Berufsbild hat.
Nachfolgend werden Auszüge folgender Berufsbilder angeführt:
► gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege,
► Pflegefachassistenz,
► Pflegeassistenz sowie
► Heimhilfe,
► Fach-Sozialbetreuung Altenarbeit, Behindertenarbeit, Behindertenbegleitung und
► Diplom-Sozialbetreuung Altenarbeit, Behindertenarbeit, Behindertenbegleitung, Familienarbeit.
Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege
Laut § 12(1) GuKG 1997 trägt der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege die Verantwortung für die unmittelbare und mittelbare Pflege von Menschen in allen Altersstufen, Familien und Bevölkerungsgruppen in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen. Auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse trägt der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege durch gesundheitsfördernde, präventive, kurative, rehabilitative sowie palliative Kompetenzen zur Förderung und Aufrechterhaltung der Gesundheit, zur Unterstützung des Heilungsprozesses, zur Linderung und Bewältigung von gesundheitlicher Beeinträchtigung sowie zur Aufrechterhaltung der höchstmöglichen Lebensqualität aus pflegerischer Sicht bei (vgl. RIS 2023 § 12(2) GuKG).
Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege führt im Rahmen der medizinischen Diagnostik und Therapie die von Ärztinnen und Ärzten übertragenen Maßnahmen und Tätigkeiten durch (vgl. RIS 2023 § 12(3) GuKG).
Pflegefachassistenz und Pflegeassistenz
Die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz unterstützen Ärztinnen und Ärzte sowie Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege (vgl. RIS 2023 § 82(1) GuKG). Beide Berufe umfassen die Durchführung der ihnen nach Beurteilung durch Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege im Rahmen des Pflegeprozesses übertragenen Aufgaben und Tätigkeiten in verschiedenen Pflege- und Behandlungssituationen bei Menschen aller Altersstufen in mobilen, ambulanten, teilstationären und stationären Versorgungsformen sowie auf allen Versorgungsstufen (vgl. RIS 2023 § 82(2) GuKG).
Im Rahmen der medizinischen Diagnostik und Therapie führen die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz die ihnen von Ärztinnen und Ärzten übertragenen oder von Angehörigen des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege weiterübertragenen Maßnahmen durch (vgl. RIS 2023 § 82(3) GuKG).
Merke: Der gehobene Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege trägt die Verantwortung für die Pflege. Die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz unterstützen Angehörige des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und Krankenpflege. Im Rahmen der Diagnostik und Therapie führen alle drei Berufe die ihnen von Ärztinnen und Ärzten übertragenen Maßnahmen durch.
Heimhilfe
Das Berufsbild umfasst die Unterstützung betreuungsbedürftiger Menschen bei der Haushaltsführung und den Aktivitäten des täglichen Lebens (z. B. Essen und Trinken) im Sinn der Unterstützung von Eigenaktivitäten und der Hilfe zur Selbsthilfe.
Die Heimhilfe übernimmt eigenverantwortlich die Durchführung hauswirtschaftlicher Tätigkeiten sowie die Unterstützung bei der Basisversorgung (vgl. RIS 2023a § 12(1) LGBl. Nr. 63/2008).
Fach-Sozialbetreuung Altenarbeit
Das Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit umfasst die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmte soziale Betreuung. Das Berufsbild umfasst auch die Pflegeassistenz lt. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (siehe Abb. 4).
Die soziale Betreuung fällt in den eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich. Dieser beinhaltet die Setzung von präventiven, unterstützenden, aktivierenden, reaktivierenden, beratenden, organisatorischen und administrativen Maßnahmen zur täglichen Lebensbewältigung. Es wird auf körperliche, seelische, soziale und geistige Bedürfnisse und Ressourcen eingegangen. Auch wird im Rahmen der sozialen Betreuung die Hilfe zur Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung von Fähigkeiten und Fertigkeiten für ein möglichst selbstständiges und eigenverantwortliches Leben im Alter angeboten. Darüber hinaus unterstützt die Fach-Sozialbetreuung mit dem Schwerpunkt Altenarbeit bei der psychosozialen Bewältigung von Krisensituationen (vgl. RIS 2023a § 15(1–2) LGBl. Nr. 63/2008).
Aufgabe: Finden Sie praktische Beispiele für präventive, unterstützende, aktivierende, reaktivierende, beratende, organisatorische und administrative Maßnahmen zur täglichen Lebensbewältigung!
Fach-Sozialbetreuung Behindertenarbeit
Das Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Behindertenarbeit umfasst die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte soziale Betreuung von beeinträchtigten Menschen in deren zentralen Lebensfeldern, insbesondere Wohnen, Arbeit bzw. Beschäftigung, Freizeit und Bildung. Auch umfasst dieses Berufsbild die Pflegeassistenz lt. Gesundheits- und Krankenpflegegesetz (siehe Abb. 4).
Die Eigenverantwortlichkeit bezieht sich insbesondere auf Maßnahmen der Anleitung, der Beratung, der Assistenz oder aber auch der Förderung (vgl. RIS 2023a § 21(1–2) LGBl. Nr. 63/2008).
Fach-Sozialbetreuung Behindertenbegleitung
Das Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Behindertenbegleitung umfasst ebenfalls die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte soziale Betreuung von beeinträchtigten Menschen in deren zentralen Lebensfeldern, insbesondere Wohnen, Arbeit bzw. Beschäftigung, Freizeit und Bildung. Gleich wie im Berufsbild der Heimhilfe beinhaltet es die Unterstützung bei der Basisversorgung.
Die Eigenverantwortlichkeit bezieht sich auch bei diesem Berufsbild auf Maßnahmen der Anleitung, der Beratung, der Assistenz und der Förderung. Diese Kompetenzen sind im Vergleich zur Behindertenarbeit etwas vertieft und verstärkt (vgl. RIS 2023a § 27(1–2) LGBl. Nr. 63/2008).
Aufgabe: Wie unterscheiden sich betreuungsbedürftige von alten bzw. von beeinträchtigten Menschen?
Diplom-Sozialbetreuung Altenarbeit
Dieses Berufsbild entspricht dem Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit. Es umfasst die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmte soziale Betreuung sowie konzeptuelle wie auch planerische Aufgaben betreffend die Gestaltung der sozialen Betreuungsarbeit. Diese Berufsgruppe verfügt auch über Kompetenzen der Koordination und der fachlichen Anleitung der Fach-Sozialbetreuung und der Heimhilfe in Fragen der Altenarbeit.
Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich umfasst schwerpunktmäßig die Entwicklung, die Durchführung und die Evaluierung von Konzepten und Projekten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Qualitätsentwicklung sowie zur Weiterentwicklung des sozialen Betreuungsangebots der eigenen Organisation oder Einrichtung (vgl. RIS 2023a § 18(1–2) LGBl. Nr. 63/2008).
Diplom-Sozialbetreuung Behindertenarbeit
Dieses Berufsbild entspricht ebenfalls dem Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Behindertenarbeit. Darüber hinaus umfasst es die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte soziale Betreuung von beeinträchtigten Menschen in deren zentralen Lebensfeldern, insbesondere Wohnen, Arbeit bzw. Beschäftigung, Freizeit und Bildung. Diese Berufsgruppe verfügt über Kompetenzen der Koordination und der fachlichen Anleitung der Fach-Sozialbetreuung und der Heimhilfe in Fragen der Behindertenarbeit.
Die Eigenverantwortlichkeit bezieht sich wie bei der Fach-Sozialbetreuung Behindertenarbeit auf Maßnahmen der Anleitung, Beratung, Assistenz und Förderung. Gleich wie bei der Diplom-Sozialbetreuung Altenarbeit umfasst der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich die Entwicklung, Durchführung und Evaluierung von Konzepten und Projekten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Qualitätsentwicklung sowie zur Weiterentwicklung des sozialen Betreuungsangebots der eigenen Organisation oder Einrichtung (vgl. RIS 2023a § 24(1–2) LGBl. Nr. 63/2008).
Diplom-Sozialbetreuung Behindertenbegleitung
Auch dieses Berufsbild entspricht dem Berufsbild der Fach-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Behindertenbegleitung. Darüber hinaus umfasst es die ganzheitliche und auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmte soziale Betreuung von beeinträchtigten Menschen in deren zentralen Lebensfeldern, insbesondere Wohnen, Arbeit bzw. Beschäftigung, Freizeit und Bildung. Diese Berufsgruppe verfügt über Kompetenzen der Koordination und der fachlichen Anleitung der Fach-Sozialbetreuung und der Heimhilfe in Fragen der Behindertenbegleitung.
Die Eigenverantwortlichkeit bezieht sich wie bei der Fach-Sozialbetreuung Behindertenbegleitung auf Maßnahmen der Anleitung, Beratung, Assistenz und Förderung. Gleich wie bei der Diplom-Sozialbetreuung Altenarbeit oder Behindertenarbeit umfasst der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich die Entwicklung, Durchführung und Evaluierung von Konzepten und Projekten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Qualitätsentwicklung sowie zur Weiterentwicklung des sozialen Betreuungsangebots der eigenen Organisation oder Einrichtung (vgl. RIS 2023a § 30(1–2) LGBl. Nr. 63/2008).
Aufgabe: Versuchen Sie nun herauszufinden, wo die genauen Unterschiede zwischen der Fach-Sozialbetreuung Behindertenarbeit, der Fach-Sozialbetreuung Behindertenbegleitung, der Diplom-Sozialbetreuung Behindertenarbeit und der Diplom-Sozialbetreuung Behindertenbegleitung liegen. Gerne können Sie das Rechtsinformationssystem (RIS, https://www.ris.bka.gv.at/) zur Unterstützung heranziehen.
Diplom-Sozialbetreuung Familienarbeit
Das Berufsbild der Diplom-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Familienarbeit umfasst neben der Pflegeassistenz (siehe Abb. 4) die soziale Betreuung von Familien und familienähnlichen Gemeinschaften und unterstützt diese bei der Überwindung schwieriger Lebenssituationen mit dem Ziel, den gewohnten Lebensrhythmus aufrechtzuerhalten. Diese Berufsgruppe verfügt ebenfalls über Kompetenzen der Koordination und der fachlichen Anleitung der Fach-Sozialbetreuung und der Heimhilfe in Fragen der Familienarbeit.
Merke: Schwierige Lebenssituationen sind insbesondere die Erkrankung eines Elternteils, eines Kindes oder eines/einer anderen in der Familie bzw. im familienähnlichen Verband lebenden Angehörigen, aber auch psychische Krisensituationen wie Trennung, Scheidung, Tod von Angehörigen, Überforderung, Überlastung oder Ausfall der Betreuungsperson.
Der eigenverantwortliche Tätigkeitsbereich der Diplom-Sozialbetreuung mit dem Ausbildungsschwerpunkt Familienarbeit umfasst beispielsweise die Planung und die Organisation des Alltags, die Haushaltsorganisation und -führung, die altersspezifische Betreuung der Kinder und Jugendlichen, Spiel- und Lernanimation sowie Hausaufgabenbegleitung, die Mitbetreuung von älteren, kranken oder behinderten Familienmitgliedern, die Begleitung und die Unterstützung bei der Bewältigung von Krisensituationen sowie die Beratung, Begleitung und Unterstützung bei der Inanspruchnahme von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen sowie öffentlichen Stellen, Ämtern oder Behörden (vgl. RIS 2023a § 33(1–3) LGBl. Nr. 63/2008).
ArbeitnehmerInnenschutz
Das angestrebte Ziel des ArbeitnehmerInnenschutzes ist der Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren und daraus resultierenden arbeitsbedingten Erkrankungen oder Berufskrankheiten sowie die Unfallverhütung und die Vermeidung von Arbeitsunfällen. Dies wird erreicht durch die Beseitigung von Gefahrenquellen, den Einbau von Schutzmaßnahmen, die Auswahl der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), den richtigen Umgang mit Gefahrstoffen sowie Evaluierungen psychischer und physischer Arbeitsbelastungen.
Der ArbeitnehmerInnenschutz ist im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz gesetzlich geregelt. Im Betrieb sind die Sicherheitsfachkraft (SFK) und die Arbeitsmedizin für den Arbeitsschutz zuständig. Sie führen Evaluierungen (Arbeitsplatzbegehungen) durch und beraten die MitarbeiterInnen in Fragen zur Arbeitssicherheit und zum Gesundheitsschutz. Vor Ort in den Arbeitsbereichen stehen Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) zur Verfügung.
Ein wichtiges Instrument zur Vermeidung von Unfällen und Gefahren sind richtige und ausführliche Information und Unterweisungen von ArbeitnehmerInnen. Die Unterweisung muss nachweislich (Aufzeichnungen) und, falls erforderlich, in regelmäßigen Abständen erfolgen. Der/die ArbeitgeberIn muss sich vergewissern, dass Informationen und Unterweisungen von den ArbeitnehmerInnen richtig verstanden wurden.
Die ArbeitnehmerInnen sind verpflichtet, gemäß den Anweisungen ihrer ArbeitgeberInnen vorgeschriebene Schutzmaßnahmen anzuwenden (persönliche Schutzausrüstung ordnungsgemäß benutzen), die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel richtig einzusetzen und sich so zu verhalten, dass eine Gefährdung vermieden wird. Werden Mängel erkannt, geschieht ein Arbeitsunfall oder ein Ereignis, das beinahe zu einem Unfall geführt hätte, ist das unverzüglich den Verantwortlichen zu melden. Die Einnahme von Alkohol, anderen Suchtgiften oder Arzneien, die die Sicherheit anderer Personen gefährden können, ist am Arbeitsplatz verboten (vgl. RIS 2023b).
Das gesamte ArbeitnehmerInnenschutzgesetz in der geltenden Fassung finden Sie im Rechtsinformationssystem.
Brandschutz
ArbeitgeberInnen müssen geeignete Vorkehrungen treffen, um das Entstehen eines Brandes bzw. im Falle eines Brandes eine Gefährdung des Lebens und der Gesundheit der ArbeitnehmerInnen zu vermeiden. Es müssen ggf. geeignete Maßnahmen getroffen werden, die zur Brandbekämpfung und Evakuierung der anwesenden Personen erforderlich sind. Es müssen geeignete Löschhilfen wie Löschwasser, Löschdecken, Löschsand, Wandhydranten, Handfeuerlöscher oder fahrbare Feuerlöscher in ausreichender Anzahl bereitgestellt sein. Die Löschhilfen und deren Aufstellungsorte müssen gekennzeichnet sein. Weiters sind Brandschutzeinrichtungen wie eine Brandmeldeanlage, automatische Türschließeinrichtungen, Druckknopfmelder, Rauch- und Wärmeabzugsanlagen, Sprinkler- oder Gaslöschanlagen zu installieren.
In Gesundheits- und Sozialeinrichtungen sind aufgrund landesgesetzlicher Vorschriften Brandschutzbeauftragte zu bestellen und aufgrund der Arbeitsstättenverordnung ist eine Brandschutzordnung zu erstellen. In der Brandschutzordnung sind die zur Brandverhütung und zur Brandbekämpfung erforderlichen technischen und organisatorischen Vorkehrungen und durchzuführenden Maßnahmen festzuhalten. Die Brandschutzordnung ist jährlich auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergänzen. Sie ist allen ArbeitnehmerInnen zur Kenntnis zu bringen. Die Brandschutzordnung ist Bestandteil des Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokuments, in dem konkrete Abläufe anhand dokumentierter Prozesse im Brand- bzw. Katastrophenfall beschrieben sind.
Um sicherzustellen, dass die Alarmeinrichtungen von den ArbeitnehmerInnen korrekt bedient werden können, sind mindestens einmal jährlich während der Arbeitszeit Alarmübungen durchzuführen. Über die Durchführung sind Aufzeichnungen zu führen. Die Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Alarmeinrichtungen, Klima- oder Lüftungsanlagen und Brandmeldeanlagen sind mindestens einmal jährlich, längstens jedoch in Abständen von 15 Monaten, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Löschgeräte und stationäre Löschanlagen sind mindestens jedes zweite Kalenderjahr, längstens jedoch in Abständen von 27 Monaten, auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Auch über diese Prüfungen sind Aufzeichnungen zu führen, Prüfdatum und Mängelfreiheit werden durch einen Aufkleber bestätigt.
Das Einhalten von allgemeinen Brandschutzmaßnahmen unterstützt die Sicherheit der MitarbeiterInnen und der zu Pflegenden:
► kein Parken in Feuerwehrzufahrten (auch nachts)
► allgemeine Ordnung und Sauberkeit
► Fluchtstiegen, Gänge und sonstige Verkehrswege sind freizuhalten – keine Betten, Hilfsmittel abstellen
► ins Freie führende Türen und Notausgänge müssen unbehindert benutzbar sein
► Brand- und Rauchschutztüren sind ständig geschlossen zu halten (ausgenommen Türen mit selbsttätiger Auslösung), Schließvorrichtungen dürfen nicht blockiert oder außer Funktion gesetzt werden – Störungen sofort dem Brandschutzbeauftragten melden
► Brandmelde- und Brandbekämpfungseinrichtungen, Schilder und sonstige Hinweistafeln müssen sichtbar und frei zugänglich bleiben
► Druckgasbehälter (Sauerstoffflaschen, …) sind vor Wärmeeinwirkung geschützt, standsicher und leicht zugänglich zu lagern
► Rauchen und Hantieren mit offenem Licht und Flamme ist in allen inneren Bereichen verboten (Ausnahme ausgewiesene Raucherräume)
► Anwendung von ausschließlich elektrischer Beleuchtung auf Gestecken, Adventkränzen und Christbäumen
► Heiz-, Koch- und Wärmegeräte dürfen nur mit Genehmigung aufgestellt und in Betrieb genommen werden
► kein unbefugtes Hantieren an elektrischen Anlagen – Reparaturen nur durch befugte Personen
► Schäden und Störungen an Elektroinstallationen sind zu melden
Weiterführende Informationen und aktuelle gesetzliche Vorgaben zum Thema Brandschutz finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, Sektion Arbeitsrecht und Zentral-Arbeitsinspektorat.
Strahlenschutz(vgl. RIS 2023e, 2023f)
Das Strahlenschutzgesetz 2020 (StrSchG 2020), genauer das „Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz vor Gefahren durch ionisierende Strahlung“, bildet den gesetzlichen Rahmen für den sicheren Umgang bei Tätigkeiten mit radioaktiven Stoffen und sonstigen Strahlenquellen.
Das Ziel dieser gesetzlichen Grundlage ist es, Menschen vor Gefahren durch ionisierende Strahlung zu schützen.
Die Verordnungen beinhalten Regelungen betreffend:
► Anwendung von Strahlenquellen in Medizin, Industrie und Forschung,
► sichere Entsorgung von radioaktiven Abfällen,
► nukleare Sicherheit bei Forschungsreaktoren,
► Schutz von Personen vor Gefahren durch das natürliche radioaktive Edelgas Radon,
► Schutz des fliegenden Personals vor kosmischer Strahlung,
► behördliche Notfallvorsorge und Notfallreaktion in Bezug auf radiologische Notfälle,
► behördliche Radioaktivitätsüberwachung von Umwelt, Lebensmitteln und anderen Waren und Produkten sowie
► Schutz von Personen im Fall des Auffindens von radioaktiven Materialien (beispielsweise radioaktive Altlasten, kontaminierte Metalle oder sonstige kontaminierte Waren) (vgl. BMK 2023).
Die Allgemeine Strahlenschutzverordnung 2020 (AllgStrSchV 2020) regelt auf Basis des Strahlenschutzgesetzes den Umgang mit Strahlenquellen und die Maßnahmen zum Schutz vor ionisierenden Strahlen.
Grundsätzlich gilt:
► Möglichst großen Abstand halten – doppelter Abstand reduziert die Dosis auf ein Viertel!
► Abschirmung durch Schutzmaßnahmen
► möglichst geringe Aufenthaltsdauer im exponierten Bereich
Für MitarbeiterInnen von Gesundheitseinrichtungen kommen Schutzmaßnahmen laut Medizinischer Strahlenschutzverordnung zur Anwendung. Dazu gehören beispielsweise:
► Unterweisung von MitarbeiterInnen durch Strahlenschutzbeauftragte
► jährliche ärztliche Untersuchungen für beruflich strahlenexponierte Personen
► physikalische Strahlenschutzkontrolle und Grenzwerte der Strahlenexposition – Tragen von Schutzkleidung (Röntgenschürze) und Dosimeter
► Indikationsstellung – eine rechtfertigende Indikation besteht nur, wenn der gesundheitliche Nutzen einer Anwendung am Menschen gegenüber dem Strahlenrisiko überwiegt
► die Strahlenanwendung darf nur durch berechtigte Personen erfolgen (erforderliche Fachkunde im Strahlenschutz)
Die gesamte medizinische Strahlenschutzverordnung in geltender Fassung ist im Rechtsinformationssystem abrufbar.
Das österreichische Gesundheitssystem
Das österreichische Gesundheitssystem ist öffentlich organisiert. Das heißt, dass Bund, Länder, Gemeinden, Sozialversicherungen und gesetzliche Interessenvertretungen für verschiedene Teilbereiche des Gesundheitswesens verantwortlich sind. Die wesentlichen Teilbereiche des österreichischen Gesundheitssystems stellen die Gesetzgebung, die Verwaltung, die Finanzierung, die Leistungserbringung, die Qualitätskontrolle und die Ausbildung von Gesundheitsberufen dar.
Finanzierung von Gesundheitsleistungen
Die Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems beinhaltet mehrere Komponenten. Dazu gehören unter anderem die Finanzierung der Gesundheitsleistungen und die Finanzierung der Gesundheitseinrichtungen. Das österreichische Gesundheitswesen ist öffentlich organisiert und stellt sicher, dass kranke Menschen wieder gesund werden und die Gesundheit von Gesunden erhalten bleibt. Dazu gehören die Krankenversorgung, die Gesundheitsförderung und die Prävention. In Österreich wird ein Großteil der Mittel des Gesundheitswesens für die Krankenversorgung aufgewendet. Die Gesundheitsausgaben werden überwiegend aus öffentlichen Mitteln, aus den Sozialversicherungsbeiträgen und Steuergeldern, sowie aus privaten Beiträgen (Rezeptgebühr, Taggeld bei Spitalsaufenthalten, Selbstbehalte oder private Krankenversicherungen) finanziert.
Sozialversicherung
Die Sozialversicherung wird durch Beiträge der Versicherten und bei unselbstständig Erwerbstätigen zusätzlich durch die Dienstgeberbeiträge finanziert. Die Sozialversicherung ist nach dem Solidaritätsprinzip organisiert. Das heißt, dass sich der Leistungsanspruch nach dem Bedarf und der Bedürftigkeit richtet. Die Sozialversicherungsbeiträge werden einkommensabhängig berechnet. Die Solidarität der Besserverdienenden und Gesunden sichert die Finanzierung der medizinischen Leistungen und gewährleistet die Gleichbehandlung der finanziell schlechter gestellten Menschen. Ein weiteres Prinzip des österreichischen Gesundheitssystems ist der gleiche und einfache Zugang für alle zu allen Gesundheitsleistungen, unabhängig von Alter, Wohnort, Herkunft und sozialem Status. Der Versicherungsschutz besteht automatisch, wenn jemand eine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit beginnt oder eine Pension erhält. Jede/r Versicherte hat sofort Schutz, es besteht keine Wartezeit, keine Risikoprüfung und es sind keine Untersuchungen nötig.
Die österreichische Sozialversicherung beruht auf dem Prinzip der Umlagefinanzierung. In diesem Finanzierungsmodell werden die Beiträge der Versicherten und Beiträge aus Steuermitteln sofort zur Finanzierung von Leistungen weitergegeben. Die solidarische Finanzierung des österreichischen Gesundheitssystems ist im Sozialrecht, im Sozialversicherungsrecht und in zusätzlichen Vereinbarungen, wie der Vereinbarung gem. Art 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens, geregelt. Bei Art 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens handelt es sich um einen befristeten innerstaatlichen Vertrag zwischen dem Bund und den neun Bundesländern, in dem wesentliche Rahmenbedingungen festgelegt werden. Laut BMSGPK (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz) ist nahezu die gesamte österreichische Wohnbevölkerung von der gesetzlichen Krankenversicherung erfasst (99,9 Prozent). Zusätzlich zur sozialen Krankenversicherung sind rund 40 % der österreichischen Bevölkerung privat zusatzversichert. Die Pflichtversicherung ist, wie schon erwähnt, an eine Erwerbstätigkeit gebunden. Es können aber auch Familienangehörige oder LebenspartnerInnen mitversichert werden. PensionistInnen und Arbeitslose sind ebenfalls krankenversichert. Es ist auch möglich sich im österreichischen Sozialversicherungssystem selbst zu versichern. Personen ohne Krankenversicherung müssen die Kosten der Gesundheitsleistungen, mit Ausnahme von Erste-Hilfe-Leistungen, selbst finanzieren. Die unterschiedlichen Leistungen werden von der Unfall-, der Kranken-, und der Pensionsversicherung abgedeckt.
Leistungen der Krankenversicherung umfassen beispielsweise ärztliche Hilfe (ambulante Versorgung), Spitalspflege (stationäre Versorgung), medizinische Rehabilitation, Medikamente, medizinische Hauskrankenpflege und Leistungen von Hebammen, Psychotherapie und klinisch-psychologische Diagnostik, Behandlungen durch medizinisch-technische Dienste, Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen, Gesunden- und Vorsorgeuntersuchungen, Zuschüsse für Heilbehelfe und Hilfsmittel sowie Krankengeld.
Leistungen der Unfallversicherung umfassen beispielsweise Unfallheilbehandlung, Erste Hilfe bei Arbeitsunfällen, Rentenleistung (Entschädigung nach Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten), Rehabilitation, Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie arbeitsmedizinische Betreuung.
Leistungen der Pensionsversicherung umfassen beispielsweise Alterspension, Hinterbliebenenpension, Pflegegeld, Maßnahmen der Rehabilitation, Gesundheitsvorsorge und medizinische Rehabilitation.
In Österreich gibt es seit dem 1. Januar 2020 folgende Sozialversicherungsträger, die die Leistungen ihrer Versicherten finanzieren (vgl. BMSGPK 2023).
Dachverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger
Mit 1. Januar 2020 wurden die 21 Sozialversicherungsträger (siehe Abb. 6) auf fünf zusammengeführt. Die Rechtsgrundlage für die Zusammenführung der bisherigen Sozialversicherungsträger stellt das Sozialversicherungs-Organisationsgesetz (SV-OG) dar (vgl. RIS). Der Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungen wurde in einen Dachverband umgebaut. Durch die schlankere Organisationsstruktur sollen die Sozialversicherungsbeiträge der Versicherten und DienstgeberInnen verstärkt in den Ausbau von Leistungen fließen.
Die Sozialversicherungen der Selbstständigen und Bauern sowie die der öffentlich Bediensteten und Eisenbahner wurden fusioniert. Die regionalen Gebietskrankenkassen wurden zur Österreichischen Gesundheitskasse.
In den nachfolgenden Grafiken sind die alte und die neue Struktur gegenübergestellt.
Abb. 5: Hauptverband der Sozialversicherungsträger (https://www.optadata.at/journal/kassenreform/)
Abb. 6: Dachverband der Sozialversicherungsträger (https://www.optadata.at/journal/kassenreform/)
Österreichische Gesundheitskasse
Am 1. Januar 2020 wurden die neun Gebietskrankenkassen zur Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) zusammengeführt. Sie ist mit 7,5 Millionen Versicherten Österreichs größte Krankenversicherung.
Nähere Informationen finden sich auf der Website der Österreichischen Gesundheitskasse.
Sozialversicherung der Selbstständigen
Ab 1. Januar 2020 vereint die Sozialversicherung der Selbstständigen (SVS) die Versicherten der SVA (Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft) und der SVB (Sozialversicherung der Bauern). Die SVS ist eine Versichertengemeinschaft aus Gewerbetreibenden, Bauern/Bäuerinnen, Freiberuflern und Neuen Selbstständigen.
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau
Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) und die Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) wurden mit 1. Januar 2020 zur Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB).
Die Versicherungsanstalt des österreichischen Notariates wurde in eine eigenständige berufsständische Versorgungseinrichtung übergeführt.
Nähere Informationen zu den Sozialversicherungsträgern sind auf der Homepage der Österreichischen Sozialversicherung verfügbar.
Ambulante/extramurale Gesundheitsversorgung
Im österreichischen Gesundheitssystem gilt der Grundsatz: ambulant vor stationär! Das bedeutet, dass die erste Anlaufstelle für PatientInnen die niedergelassenen Allgemein-, Fach- oder ZahnmedizinerInnen in den Praxen sein sollte. Laut Österreichischer Ärztekammer lag mit Stichtag 31. Dezember 2022 die österreichweite Ärztedichte je 1000 EinwohnerInnen bei 5,32. Zur ambulanten Versorgung der Bevölkerung zählen auch die Ambulanzen der Krankenhäuser sowie die Ambulatorien der Krankenkassen und private selbstständige Ambulatorien (vgl. Österreichische Ärztekammer 2023).
Stationäre/intramurale Gesundheitsversorgung
Die intramurale oder stationäre medizinische Versorgung wird von öffentlichen, privatgemeinnützigen und rein privaten Krankenhäusern bereitgestellt. Zu den Trägern der Krankenhäuser zählen die Länder, Gemeinden, konfessionelle Träger (Ordenshäuser), Sozialversicherungsträger (z. B. AUVA) und private Träger.
Arten von Krankenanstalten
Es gibt drei Arten von Krankenhäusern:
Tab. 1: Arten von Krankenhäusern
Art der Krankenanstalt
Versorgung EinwohnerInnen
Standard-Krankenanstalten
medizinische Grundversorgung für 50.000–90.000 EinwohnerInnen
Vorhandensein von internen und chirurgischen Stationen sowie Anästhesie, Röntgendiagnostik und Pathologie ist notwendig
weitere medizinische Fächer werden durch Konsiliarärzte abgedeckt
Schwerpunkt-Krankenanstalten
Schwerpunktversorgung für 250.000–300.000 EinwohnerInnen
mit medizinischen Fächern, Anstaltsapotheke und Institut für Labordiagnostik ausgestattet
Zentral-Krankenanstalten
für mehr als 1 Million EinwohnerInnen
mit spezialisierten Einrichtungen nach dem aktuellen Stand der medizinischen Wissenschaft ausgestattet (Uniklinik)
Neben der Art der Krankenanstalten in Bezug auf das medizinische Angebot und die Anzahl der zu versorgenden EinwohnerInnen werden Krankenanstalten auch noch nach Versorgungssektor, Versorgungsbereich, Krankenanstaltentyp und Art der Finanzierung eingeteilt (siehe Abb. 7).
Versorgungssektor von Krankenanstalten
Grundsätzlich werden Krankenanstalten, die Akut-/Kurzzeitversorgung anbieten, und jene, die Nicht-Akut-/Kurzzeitversorgung anbieten, unterschieden.
Akut-/Kurzzeitversorgung: Dazu gehören Krankenanstalten, die über die Landesgesundheitsfonds finanziert werden (siehe Finanzierung (Fondszugehörigkeit) von Krankenanstalten) sowie alle weiteren Krankenanstalten, die eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 18 Tagen oder weniger aufweisen (laut Definition von OECD und WHO).
Nicht-Akut-/Kurzzeitversorgung: Dazu gehören alle restlichen Krankenanstalten (krankenanstaltenrechtlich bewilligte Rehabilitationszentren, Langzeitversorgungseinrichtungen und stationäre Einrichtungen für Genesung und Prävention). Alten- und Pflegeheime bzw. geriatrische Zentren, die nicht dem Krankenanstaltenrecht unterliegen, gehören NICHT zu dieser Kategorie.
Versorgungsbereich von Krankenanstalten
In dieser Kategorie werden Krankenanstalten unterschieden, die Allgemein- bzw. Spezialversorgung anbieten.
Allgemeinversorgung: Dazu gehören alle Krankenanstalten, die ein breites Leistungsspektrum aufweisen, zumindest aber Leistungen im Bereich der inneren Medizin und der Allgemeinchirurgie erbringen (Standard-Krankenanstalten).
Spezialversorgung: Dazu gehören Krankenanstalten, die nur Personen mit bestimmten Krankheiten (z. B. psychiatrische Krankenhäuser, Rehabilitationszentren) oder Personen bestimmter Altersstufen (z. B. Kinderkrankenhäuser) versorgen oder für bestimmte Zwecke eingerichtet sind (z. B. Heeresspitäler). Diese Krankenanstalten sind in der Regel Sonderkrankenanstalten.
Krankenanstaltentypen
Je nach Zweckwidmung können folgende Typen von Krankenanstalten unterschieden werden:
Allgemeine Krankenanstalten versorgen Menschen ohne Unterschied des Geschlechts, des Alters oder der Art der ärztlichen Betreuung. Dazu gehören gemeinnützige Krankenanstalten, die Allgemeinversorgung leisten.
Sonderkrankenanstalten versorgen Menschen mit bestimmten Krankheiten oder Personen bestimmter Altersstufen oder sind für bestimmte Zwecke wie beispielsweise Rehabilitation bestimmt.
Sanatorien entsprechen durch ihre besondere Ausstattung höheren Ansprüchen hinsichtlich Verpflegung und Unterbringung. Sanatorien können entweder Allgemeinversorgung im Akutsektor oder Spezialversorgung leisten.
Pflegeanstalten für chronisch Kranke versorgen Menschen, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedürfen. Sie gehören zu den Anbietern der nicht-akuten Spezialversorgung. Alten- und Pflegeheime bzw. geriatrische Zentren, die nicht dem Krankenanstaltenrecht unterliegen, gehören nicht in diese Kategorie.
In Österreich gibt es insgesamt 32 Sanatorien mit 2345 Betten, 91 allgemeine Krankenhäuser mit 61927 Betten, 122 Sonderkrankenanstalten und Genesungsheime mit 38570 Betten sowie 19 Pflegeanstalten für chronisch Kranke mit 4035 Betten (Stand 2021, vgl. Statistik Austria 2023).
Finanzierung (Fondszugehörigkeit) von Krankenanstalten
Krankenanstalten können auch nach Art der Finanzierung unterschieden werden (vgl. BMSGPK 2022a, S. 6–7):
Landesgesundheitsfonds: Krankenanstalten des Akutversorgungssektors werden aus öffentlichen Mitteln (über die neun Landesgesundheitsfonds) nach dem System der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF) finanziert. Die Landesgesundheitsfonds werden aus Mitteln des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Sozialversicherung gespeist.
PRIKRAF: In den Sanatorien werden jene Leistungen, für die eine Leistungspflicht der sozialen Krankenversicherung besteht, über den Privatkrankenanstalten-Finanzierungsfonds (PRIKRAF) nach dem LKF-System abgerechnet. Der PRIKRAF wird aus Mitteln der Sozialversicherung gespeist.
Sonstige: Die restlichen Spitäler (Rehabilitationszentren und Einrichtungen für chronisch Kranke) sind entweder in der Trägerschaft der Sozialversicherung oder sie verfügen über Einzelverträge mit Sozialversicherungsträgern.
Abb. 7: Klassifikation österreichische Krankenanstalten (BMSGPK 2022b, S. 7)
Finanzierung intra- und extramuraler Gesundheitsversorgung
Finanziert werden die öffentlichen Gesundheitsausgaben durch allgemeine Steuermittel und Sozialversicherungsbeiträge. Im Jahr 2021 wurden für die laufenden Gesundheitsausgaben insgesamt 49,128 Mio. Euro aufgewendet, das entspricht 12,1 % des BIP (Bruttoinlandsprodukt). Weiters wurden 2,992 Mio. Euro für Investitionen im Gesundheitsbereich verwendet. Die restlichen Kosten wurden durch Private (Privatversicherungen, SelbstzahlerInnen) abgedeckt (vgl. BMSGPK 2023a).
Die laufenden Kosten für die Fondsspitäler werden von der Sozialversicherung so- wie von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam getragen, die Finanzierung erfolgt über die Landesgesundheitsfonds. In der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens werden die Beiträge der Bundesgesundheitsagentur und der Sozialversicherung an die Landesgesundheitsfonds geregelt, diese machen in etwa die Hälfte der Mittel der Spitalskosten aus. Der restliche Anteil wird von den Ländern über die sogenannte Abgangsdeckung beglichen und ebenfalls über die Landesgesundheitsfonds abgewickelt.
Leistungsorientierte Krankenanstaltenfinanzierung
Die Finanzierung der laufenden Kosten der Fondsspitäler erfolgt mit der leistungsorientierten Krankenanstaltenfinanzierung (LKF). Beim LKF-System erfolgt die Honorierung der für PatientInnen erbrachten Spitalsleistungen auf Basis von Fallpauschalen. Die Fallpauschalen setzen sich aus Leistungspunkten für bestimmte Diagnosen und Leistungen (= leistungsorientierte Diagnosefallgruppen, LDF) zusammen. Bei jedem stationären Aufenthalt fallen so „LKF-Punkte“ an. Je nach Bundesland erhält das Krankenhaus für stationär aufgenommene PatientInnen einen bestimmten Euro-Betrag pro LKF-Punkt aus dem Landesgesundheitsfonds. Spitalsambulanzen werden über Pauschalen, also nicht über das LKF-System, finanziert. Die Abrechnung der LKF-Punkte deckt allerdings nicht alle Kosten der Krankenanstalten. Der restliche Betrag wird über die sogenannte Betriebsabgangsdeckung beglichen.
Auch die aus dem PRIKRAF finanzierten Spitalsleistungen werden nach dem LKF-System abgerechnet. Bei der LKF ist es wichtig, dass jede Leistung nach den LDF dokumentiert und an die zuständige Sozialversicherung weitergeleitet wird, nur dann erhält das Krankenhaus Geld von der zuständigen Sozialversicherungsanstalt.
Finanzierung ambulanter medizinischer Leistungen
Die Behandlungsleistungen der niedergelassenen Ärzte/Ärztinnen werden von der jeweiligen Sozialversicherung bezahlt. Die Finanzierung erfolgt dabei einerseits durch Tarife (Vergütung für spezifische Leistungen) und andererseits durch einen Fixbetrag für versorgte PatientInnen. Die Tarife und spezifischen Besonderheiten der Abrechnungen werden von der Sozialversicherung mit der Ärztekammer vereinbart. Beispielsweise werden Erstkontakt und Folgekontakt von PatientInnen bei einem Arzt/einer Ärztin unterschiedlich vergütet. In den Honorarordnungen sind die Beträge für die ärztlichen Leistungen festgelegt. Die Sozialversicherung hat auch Verträge mit anderen Leistungsanbietern wie Ambulatorien, Ergo-/Physio-/PsychotherapeutInnen etc.
Nehmen Sozialversicherte Leistungen von niedergelassenen Ärzten/Ärztinnen ohne Kassenvertrag (Wahlarzt) in Anspruch, wird ein Teil des Behandlungsentgelts von der Sozialversicherung rückerstattet, wenn der/die PatientIn darum ansucht. Es werden 80 Prozent des tarifierten Betrags rückerstattet.
Die Finanzierung ambulanter Leistungen in Spitalsambulanzen ist auf Länderebene geregelt.
Verschriebene Medikamente werden von der Krankenkasse finanziert. Es wird pro Medikamentenpackung eine Rezeptgebühr eingehoben. Eine Befreiung von der Rezeptgebühr kann bei Vorliegen der Voraussetzungen erfolgen.
Organisation der sozialen Dienste
Die Zuständigkeiten für die Gestaltung des Gesundheitssystems sind zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherung aufgeteilt. Der Bund ist für die Gesetzgebung (Grundlagengesetze wie Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, Ärztegesetz, Arzneimittelgesetz usw.) und für sonstige überregional wahrzunehmende Angelegenheiten des Gesundheitssystems zuständig. Die Länder sind beispielsweise für die Ausführungsgesetzgebung, die Sicherstellung der Spitalsversorgung und die Gesundheitsverwaltung verantwortlich. Die Sozialversicherung regelt gemeinsam mit der Ärztekammer die Versorgung mit niedergelassenen Ärzten/Ärztinnen.
Neben der beschriebenen Gesundheitsversorgung haben in Österreich lebende Menschen auch Zugang zu sogenannten „sozialen Diensten“. Darunter werden Maßnahmen der Beratung, Versorgung und Betreuung verstanden. Dazu gehören Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik, außerschulische Kinderbetreuung, Senioren- und Pflegeheime, tagesstrukturierende Einrichtungen und ambulante Dienste, Wohn- und/oder Beschäftigungseinrichtungen für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die Beratung und Betreuung von Personen in besonderen Situationen (von Gewalt bedrohte Frauen und deren Kinder, drogenabhängige bzw. suchtkranke Personen, wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen, überschuldete Personen, Haftentlassene oder Asylsuchende). Die Zuständigkeit für die sozialen Betreuungseinrichtungen liegt bei den Ländern. Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder, Gemeinden) betreiben die sozialen Dienste zum Teil selbst, es wird aber auch auf Leistungen von nicht gewinnorientierten Organisationen (Non-Profit-Organisationen/NPOs), Vereinen oder privaten Trägern zurückgegriffen. Im Gegensatz zu den meisten Geldleistungen und den Gesundheitsdiensten besteht für einen großen Teil der sozialen Dienstleistungen kein individueller Rechtsanspruch.
Im Jahr 2021 wurden mit 131 Mrd. Euro 98 % der gesamten österreichischen Sozialleistungen für die Sozialausgaben aufgewendet. Die restlichen 3 Mrd. der 134 Mrd. Euro Gesamtkosten entfielen auf Verwaltungskosten und sonstige Ausgaben (z. B. Zinsen).
Wie in Abb. 8 ersichtlich ist, werden in Österreich Sozialleistungen hauptsächlich als Geldleistungen zur Verfügung gestellt. 2021 entfielen zwei Drittel (87 Mrd. Euro) auf monetäre Transfers, dazu zählen vor allem die Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenpensionen, die Familienbeihilfe, das Arbeitslosengeld und das Pflegegeld (vgl. BMSGPK 2022a, S. 19–21).
Abb. 8: Sozialausgaben Österreich, Stand 2021 (Statistik Austria)
Alten- und Pflegeheime, betreutes Wohnen
In Österreich gibt es knapp 900 Alten- und Pflegeheime.
In Altenheimen, auch als Seniorenheime oder Pensionistenheime bezeichnet, wohnen ältere Menschen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen und eine geringe Pflegebedürftigkeit haben. Im Altenheim werden die Zubereitung der Mahlzeiten und die Reinigung der Zimmer übernommen.
In Pflegeheimen werden pflegebedürftige Menschen, die in ihrer Selbstpflege eingeschränkt sind, von Fachpersonal rund um die Uhr betreut. Ausgebildetes Pflegepersonal kümmert sich um deren persönliche und medizinische Bedürfnisse.
Es ist auch möglich vorübergehend (zeitlich auf bis zu drei Monate befristet) Kurzzeitpflege in einem Alten- und Pflegeheim in Anspruch zu nehmen. Kurzzeitpflege kann beispielsweise zur Überbrückung zwischen einem Krankenhaus- und einem Reha-Aufenthalt erforderlich sein, oder wenn pflegende Angehörige auf Urlaub fahren möchten.
Betreutes Wohnen